Da ist sie wieder, die Digitalsteuer. Letzte Woche hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eine Digitalabgabe für große Tech-Unternehmen wie Alphabet oder Meta ins Spiel gebracht. Ein Abgabesatz von 10 Prozent sei „moderat und legitim“, sagte der parteilose Konservative dem Magazin Stern. Sein Haus arbeite nun eine Gesetzesvorlage aus, als Vorbild soll eine Regelung aus Österreich dienen.
Für manche in der schwarz-roten Koalition kam der Vorstoß überraschend, abgestimmt war der Vorschlag augenscheinlich nicht. Dabei hatte der Koalitionsvertrag eine Abgabe für Online-Plattformen, die Medieninhalte nutzen, in Aussicht gestellt. Die Erlöse sollen demnach dem Medienstandort zugutekommen.
Indes ist nachvollziehbar, warum so eine Abgabe nicht auf der Prioritätenliste der Bundesregierung steht: Ein Alleingang Deutschlands könnte zur Eskalation des weiterhin ungeklärten Handelsstreits zwischen den USA und der EU beitragen und zugleich Brüssel im Verhandlungs-Poker einen Trumpf entziehen – etwas, was die EU-Kommission tunlichst vermeiden will.
Wiederkehrende Debatte
Dennoch lässt sich die Debatte um eine Digitalsteuer nicht vom Tisch wischen, sie flammt seit Jahren über Parteigrenzen hinweg immer wieder auf. Politisch wie wirtschaftlich lässt sich kaum vermitteln, warum manche Weltkonzerne jedes Quartal Milliardengewinne einstreichen, aber signifikant weniger Steuern zahlen als andere Unternehmen.
Laut Angaben der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 zahlen Unternehmen mit traditionellen Geschäftsmodellen im Schnitt rund 23 Prozent Steuern, Digitalunternehmen jedoch nicht einmal 10 Prozent. Es ist schlicht eine Frage der Gerechtigkeit, zumal auf den Kosten, die manche dieser Konzerne verursachen, oft der Rest der Gesellschaft sitzen bleibt.
Sinnvoll wäre eine Lösung auf EU-Ebene, von der Kommission zuletzt im Jahr 2018 vorgeschlagen. Doch im Streit um den Ansatz, auf den sich alle Mitgliedstaaten hätten einigen können, ist die Diskussion schließlich erfolglos versandet. Gebremst hatten vor allem Länder wie Irland, die Konzerne wie Google oder Apple mit großzügigen Steuervorteilen ins Land locken und zuweilen sogar vor Gericht ziehen, um kaum haltbares Steuerdumping betreiben zu können.
Einige Länder haben deshalb kurzerhand eigene Modelle in die Welt gesetzt, darunter Frankreich, Italien und eben auch Österreich. Wie könnte nun eine mögliche Digitalsteuer nach österreichischem Muster aussehen?
Die österreichische „Übergangslösung“
Die dortige Regelung zielt auf Online-Werbung ab. Seit dem Jahr 2020 entfällt auf beispielsweise Bannerwerbung auf Websites oder Suchmaschinen eine fünfprozentige Abgabe. Erfasst werden Unternehmen ab einem weltweiten Umsatz von 750 Millionen Euro und inländischem Umsatz von 25 Millionen Euro pro Jahr.
Als relevante Werbeleistung gelten Anzeigen, die von Geräten mit österreichischer IP-Adresse abgerufen werden und sich an österreichische Nutzer:innen richten. Es handelt sich um eine Selbstberechnungsabgabe, die Unternehmen ermitteln also selbst, was sie zu entrichten haben.
Rund 2,6 Milliarden Euro sollen Berechnungen des Standard zufolge vom Gesetz erfasste Tech-Konzerne im Jahr 2024 mit Werbung in Österreich eingenommen haben. Damit flossen circa 124 Millionen Euro ans österreichische Finanzministerium.
Online-Werbung ist ein rasant wachsender Markt: Einnahmen aus Werbeanzeigen, die früher ein wichtiges Standbein der Medienfinanzierung waren, landen zunehmend bei Google, Facebook & Co. In Österreich haben die Tech-Riesen die traditionelle Verlagsbranche etwa um das Jahr 2022 überflügelt. Letztere konnte im Vorjahr nur rund 2 Milliarden Euro aus Werbebuchungen einnehmen, wie in anderen Ländern sind die Zahlen seit Jahren rückläufig.
Wo die neuen Einnahmen genau landen, ist eine politische Frage. In Österreich gehen davon jährlich nur rund 20 Millionen Euro an einen Fonds zur Förderung der digitalen Transformation, zum Frust österreichischer Fachverbände. Der Fonds soll die Digitalisierung der Medienlandschaft vorantreiben und unterstützt eine Reihe an Digitalisierungsprojekten, darunter auch die Weiterbildung von Journalist:innen – aber nicht reine Online-Medien.
Wie eng sich ein konkreter deutscher Aufschlag letztlich am österreichischen orientieren wird, bleibt offen. In seiner eher vagen Ankündigung hatte Weimer die Tür für weiter reichende Ansätze offen gelassen, ganz abgesehen vom doppelt so hohen Abgabesatz. „Es geht nicht nur um Google-Ads. Es geht generell um Plattform-Betreiber mit Milliardenumsätzen“, sagte der Kulturstaatsminister.
Nicht alle Geschäftsmodelle der Digitalkonzerne bauen auf Online-Werbung auf, bekannte Steuervermeider wie Apple kämen ungeschoren davon. Außerdem wolle Weimer das Gespräch mit den „Plattformbetreibern auf Spitzenebene“ suchen, um „Alternativlösungen zu sondieren“.
Grundsätzlich sieht Österreich das eigene Modell aber weiterhin als „Übergangslösung“, während „auf OECD-Ebene und innerhalb der EU an umfassenden globalen Besteuerungsregeln für die digitale Wirtschaft gearbeitet wird“, wie das Finanzministerium letztes Jahr betonte.
Wackliges OECD-Säulenmodell
Tatsächlich hat sich die letzte, fruchtlos gebliebene EU-Debatte zur OECD hin verschoben, um zumindest einen Mindeststandard bei der Besteuerung insbesondere multinationaler Unternehmen zu schaffen. Diese beschäftigen ganze Heerscharen an Jurist:innen, die mit ausgeklügelten Tricks die Steuerlast der Konzerne so gering wie möglich halten.
Doch selbst die innerhalb der OECD erzielte und nach einigem Tauziehen von der EU bestätigte Einigung, einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent zu schaffen, wackelt, weil einmal mehr Donald Trump reingrätscht und US-amerikanische Unternehmen ungerecht behandelt sieht. Die Folgen für die Abgabengerechtigkeit wären jedoch ohnehin nur „schwach positiv“, auch bei einer relativ umfassenden Umsetzung, führt eine Studie des Centrums für Europäische Politik (CEP) aus.
In dieser aus dem Vorjahr stammenden Studie deklinieren die Autoren zudem weitere möglich Ansätze durch – vom Zwei-Säulen-Modell der OECD über Zölle auf Handel mit Software-Lizenzen bis hin zur sogenannten Datenmaut. Jeder dieser Ansätze bringt seine eigenen Vor- und Nachteile mit, ganz zu schweigen vom Problem der Umsetzbarkeit. Schließlich hat die derzeitige EU-Kommission nicht nur mit dem Trump-Problem zu kämpfen, sondern sich generell Erleichterungen für die europäische Wirtschaft auf die Fahnen geschrieben. Wirtschaftsverbände warnten denn auch umgehend vor möglichen negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit.
EU-Länder lassen sich ungern reinreden
Wie schwierig es ist, Einigkeit über sogar auf den ersten Blick scheinbar unkontroverse Vorhaben zu finden, zeigen etwa die zähen Verhandlungen zur „Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter“. Über drei Jahre lagen sich die EU-Länder in den Haaren, um sich letztlich auf die Digitalisierung von Meldepflichten oder auf Mehrwertsteuern für Kurzzeitvermietung von Unterkünften zu einigen. Das hat auch damit zu tun, dass die EU selbst nicht direkt Steuern einnehmen kann und sich die Mitgliedstaaten ungern in ihren Hoheitsbereich reinreden lassen.
Auf absehbare Zeit dürften deshalb eher nationale Vorstöße dominieren und dabei Fakten schaffen, die wiederum auf die EU zurückwirken könnten. Einer von der Grünen-Fraktion im EU-Parlament in Auftrag gegebenen Studie des Centre for European Policy Studies (CEPS) lässt sich etwa entnehmen, dass Online-Werbetreibende über die Hälfte des entsprechenden EU-Umsatzes in nur drei Ländern erwirtschaften: Deutschland, Frankreich und Italien. In diesem Trio fehlt also nur mehr Deutschland mit einem eigenen Modell.
Auch diese Studie zeigt die Spannweite des Handlungsrahmens auf, es muss nicht notwendigerweise bei Abgaben auf Online-Werbung bleiben. Frankreich besteuert etwa nicht nur Umsätze im Werbemarkt mit 3 Prozent, sondern ab einem gewissen Umsatz mittlerweile auch Musikstreaming-Dienste mit 1,2 Prozent. Italien und Spanien, zwei weitere EU-Länder mit bereits eingeführten und jeweils dreiprozentigen Steuern auf Online-Werbeumsätze, experimentieren unter anderem mit der Höhe inländischer Umsatzschwellen oder der steuerlichen Erfassung von Schnittstellen, über die personenbezogene Daten übertragen werden.
Vom rückblickend moderat wirkenden Vorschlag aus dem Jahr 2018, Digitalkonzerne mit bescheidenen drei Prozent zu besteuern, scheinen wir inzwischen meilenweit entfernt zu sein.

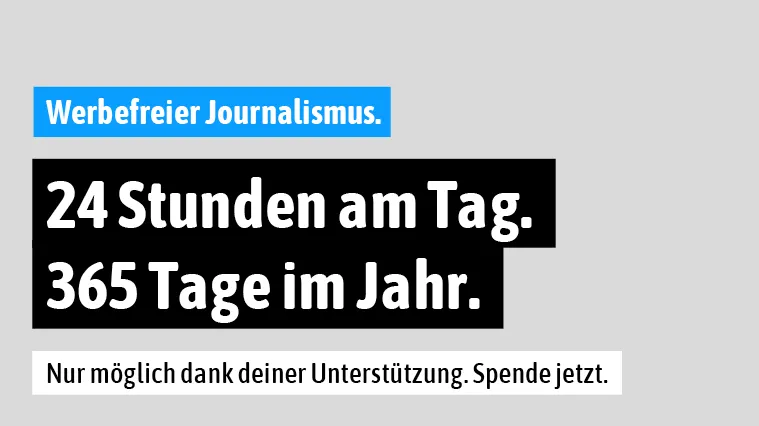

































Anya126Si
Juli 26, 2025 at 12:10 pm
Hello !!
I came across a 126 awesome platform that I think you should browse.
This resource is packed with a lot of useful information that you might find valuable.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
https://www.flaminiaedintorni.it/discord-ora-vale-15-miliardi-di-dollari-dopo-un-nuovo-round-di-investimenti/
Anya126Si
Juli 26, 2025 at 1:33 pm
Hello team!
I came across a 126 great resource that I think you should browse.
This resource is packed with a lot of useful information that you might find interesting.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
https://humanmag.pl/nowa-oferta-kryptowalut-na-xtb/