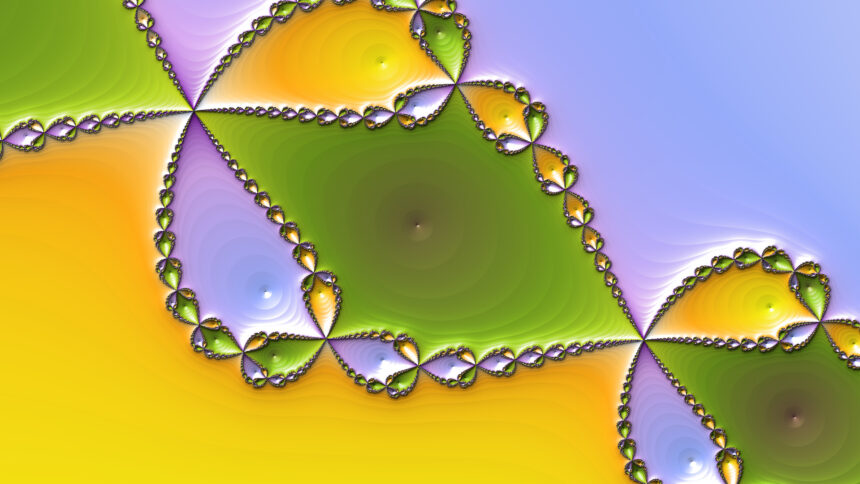Am 5. Juni gibt es Proteste in der südbadischen Kleinstadt Kenzingen. Die Demo vor dem Rathaus richtet sich gegen eine Erhöhung der Kindergartengebühren, welche am selben Tag im Gemeinderat behandelt wird. Auf der Demo protestieren nach Angaben des Veranstalters 150 Menschen. Bilder zeigen Familien, große und kleine Menschen, jung und alt, ein Querschnitt der Bevölkerung. Sie tragen bunte Schilder, auf denen eine bezahlbare Kinderbetreuung gefordert wird: „Kinder dürfen kein Luxus sein!“ steht da auf einem selbstgemalten Plakat, ein anderes fordert ein „Herz für Familien“. Ein Zeichen lebendiger Demokratie, auch wenn die Proteste am Ende die Erhöhung nicht verhindern konnten.
Die Demonstration hat der Familienvater und Unternehmer Alexander Feldberger ordnungsgemäß, wenn auch kurzfristig beim zuständigen Landratsamt Emmendingen angemeldet. Das Landratsamt, das hier als Versammlungsbehörde agiert, forderte in den Auflagen für die Versammlung eine Vollsperrung der Kundgebungsfläche – und liefert einen so genannten „Verkehrszeichenplan“ mit, auf dem die Sperrung samt Verkehrszeichen kartiert ist. Diese angeordnete Sperrung setzt die Stadt Kenzingen am 5. Juni kurzfristig um. Sie schickt den örtlichen Bauhof los, um die Schilder und Absperrungen aufzustellen.
Plötzlich kostet die Demo 374 Euro
Knapp drei Wochen später flattert bei Organisator Feldberger eine Rechnung ins Haus: 374 Euro soll er dem Betriebshof für die Absperrung zahlen, aufgeteilt in sieben Arbeitsstunden à 50 Euro und zwei Stunden Nutzung eines Mercedes Sprinters à 12 Euro. Plötzlich soll das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Geld kosten.
Feldberger wundert sich. Er weiß, dass bei einer Demo im Februar dieses Jahres gegen das Einreißen der Brandmauer zur rechtsextremen AfD durch Friedrich Merz keine Kosten auf die Veranstalter zukamen. Die überraschenden Gebühren begründet die Stadt Kenzingen mit der kurzfristigen Anmeldung der Demo: „Die Gebührenerhebung stützt sich maßgeblich darauf, dass die Versammlung entgegen der in § 14 VersammlG vorgesehenen Frist nicht mindestens 48 Stunden vorher angemeldet wurde, sondern erst am selben Tag“, heißt es in einem Schreiben an den Anmelder, das netzpolitik.org einsehen konnte. Die Stadt besteht darin auch darauf, dass eine „frühere Anmeldung ohne Weiteres“ möglich gewesen sei.
Dem widerspricht Feldberger entschieden. Die konkreten Zahlen der Gebührenerhöhung seien erst am 2. Juni im Ratsinformationssystem veröffentlicht worden, am 3. Juni hätten die Elternbeiräte gemeinsam einen Brief an den Bürgermeister geschrieben, dieser habe am 4. Juni einen Dialog per Mail abgelehnt. Daraufhin kündigte Feldberger telefonisch der Stadt Kenzingen die Demo an und meldete diese beim Landratsamt an. Am 5. Juni, dem Tag der Gemeinderatssitzung und des Protestes, kam dann der Bescheid mit der Absperr-Auflage aus Emmendingen.
„Gefährlicher Präzedenzfall“
„Was hier passiert, ist ein gefährlicher Präzedenzfall: Wenn Kommunen anfangen, Proteste finanziell zu sanktionieren, wird aus Meinungsfreiheit ein Kostenrisiko. Das kann und darf doch in einem demokratischen Rechtsstaat nicht Schule machen“, sagt Feldberger gegenüber netzpolitik.org.
Feldberger steht mit dieser Meinung nicht alleine. Der Rechtsanwalt David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hält es bereits für zweifelhaft, ob das baden-württembergische Gebührenrecht eine Grundlage für Kostenbescheide an Versammlungsleiter:innen enthält. Aus seiner Sicht könnten Versammlungsleiter:innen nur in Anspruch genommen werden, wenn sie selbst für eine Gefahr verantwortlich sind, die durch eine polizeiliche Maßnahme abgewehrt wird.
„Das ist hier erkennbar nicht der Fall“, sagt Werdermann gegenüber netzpolitik.org. „Der Aufbau der Absperrungen sollte offenbar den reibungslosen Ablauf der Versammlung gewährleisten. Das ist eine originäre Polizeiaufgabe, die wahrscheinlich auch angefallen wäre, wenn der Leiter die Versammlung 48 Stunden vor ihrem Beginn angemeldet hätte“, so der Jurist weiter.
„Einschränkende und einschüchternde Wirkung“
Bisher sei die Pflicht für Nichtverantwortliche, entstehende Kosten zu tragen, nur ausnahmsweise bei kommerziellen Großveranstaltungen anerkannt, insbesondere bei Fußballspielen. Hier dürfen die Veranstalter auf Grundlage einer speziellen gesetzlichen Grundlage auch für Polizeikosten herangezogen werden, wenn sie selbst nicht für die Gefahren verantwortlich sind, erklärt Werdermann. Das habe das Bundesverfassungsgericht Anfang des Jahres entschieden – das sei aber nach wie vor sehr umstritten.
„Auf Versammlungen ist das nicht übertragbar. Im Gegenteil: Das Bundesverfassungsgericht betont an mehreren Stellen, dass sich aus speziellen Freiheitsrechten strengere Anforderungen ergeben“, so Werdermann weiter. Das Bundesverfassungsgericht verweist zudem auf eine Entscheidung von 2007. Darin heißt es: „Eine grundsätzliche Gebührenpflicht für Amtshandlungen aus Anlass von Versammlungen würde dem Charakter des Art. 8 Abs. 1 GG als Freiheitsrecht widersprechen“.
Auch der Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Clemens Arzt hält die Gebührenerhebung mindestens für umstritten. Zwar habe der Verwaltungsgerichtshof Mannheim 2009 eine Gebührenerhebung für zulässig erklärt, dem stünden jedoch andere Urteile entgegen, so Arzt gegenüber netzpolitik.org. „Ein Rückgriff auf das Landesgebührenrecht, in dem Artikel 8 des Grundgesetzes nicht zitiert wird, ist mit Blick auf die faktischen Auswirkungen einer Gebühr und deren einschränkender und einschüchternder Wirkung mit Blick auf die Versammlungsfreiheit aus Sicht des Verwaltungsgericht Karlsruhe nicht zulässig.“
2025-07-14
8
1
– für digitale Freiheitsrechte!
Euro für digitale Freiheitsrechte!
„Alles getan, um Demo stattfinden zu lassen“
Wir haben beim Landratsamt Emmendingen und der Stadt Kenzingen nachgefragt. Wir wollten wissen, warum nicht einfach die Polizei den Verkehr rund um die Demonstration geregelt habe, so wie das normalerweise bei Demonstrationen üblich ist, und ob der Anmelder im Vorfeld informiert wurde, dass und welche Kosten ihm entstehen würden. Wir wollten wissen, warum Gebühren trotz einschlägiger Urteile und der bekanntermaßen einschränkenden Wirkung auf die Versammlungsfreiheit erhoben wurden. Das Landratsamt hat innerhalb der Frist nicht geantwortet.
Geantwortet hat der Kenzinger Bürgermeister Dirk Schwier (parteilos). Er verweist auf die Auflagen des Landratsamtes, an die sich die Stadt halten musste, damit die Demo ordnungsgemäß stattfinden konnte. „Durch die Kurzfristigkeit der Anmeldung und Eingang des Bescheides (wenige Stunden vor der Demonstration) haben wir alles getan, um diese Auflagen zu erfüllen und die Demo stattfinden zu lassen“, so Schwier gegenüber netzpolitik.org. Die Stadt habe wie auferlegt gehandelt, man habe auch keine eigenen Polizisten.
„Ich verwehre mich strikt gegen die Aussage, wir wollen durch Gebühren die Versammlungsfreiheit einschränken – im Gegenteil: wir haben sie durch unser schnelles Handeln ermöglicht“, sagt Schwier. Dass die Stadt Gebühren verlangt habe, begründet der Bürgermeister mit Gleichbehandlung. Auch gegenüber Vereinen würden bei Absperrungen Gebühren erhoben. Zudem seien nicht alle Kosten auferlegt worden.
Klärung „notfalls vor Gericht“
Die Stadt habe dem Anmelder ein Kulanzangebot vorgelegt, das dieser jedoch ausgeschlagen habe. Derzeit bewerte die Stadt die rechtliche Situation und prüfe die nächsten Schritte. Auch einen eingegangenen Antrag auf vollständigen Erlass der Rechnung prüfe man wohlwollend.
Alexander Feldberger hat mittlerweile Einspruch gegen den Gebührenentscheid erhoben. Doch es geht in dem Fall auch um Grundsätzliches. Das Land Baden-Württemberg bewege sich mit seiner Gebührenpraxis bei Versammlungen in einer juristischen Grauzone, sagt Feldberger. „Ich finde, dass eine abschließende Klärung überfällig ist, notfalls vor Gericht!“