Künstliche Intelligenz
Spotify: 15 Stunden mehr Hörbuch für 9 Euro im Monat
Wer intensiv Hörbücher auf Spotify hören möchte, bekommt in Deutschland, Österreich und der Schweiz nun eine neue Abo-Option: Mit der Zusatzoption „Hörbücher+“ können Nutzer 15 Stunden zusätzlich pro Monat hören. Gemeinsam mit den standardmäßig inkludierten zwölf Stunden ergibt das also eine Hörzeit von 27 Stunden pro Monat.
Um die Zusatzoption „Hörbücher+“ abonnieren zu können, muss man zuerst ein Premium-Abonnement haben. Die Zusatzoption kostet dann 9 Euro pro Monat obendrauf. Gemeinsam mit dem Premium-Abo Individual zahlt man also 20 Euro pro Monat, um uneingeschränkt Musik und 27 Stunden in der Hörbuch-Bibliothek von Spotify hören zu können.
Hörbücher: Spotify vs. Amazon
Eine Alternative zu Spotify bleibt Amazons Musikstreaming-Dienst Prime Music, in dem man seit Juni ein Hörbuch aus dem Audible-Katalog pro Monat hören darf. Amazons Ansatz funktioniert etwas anders als bei Spotify: User können ein Hörbuch pro Monat aus dem Audible-Katalog hören, die Länge des Hörbuchs spielt dabei keine Rolle. Ein neues Hörbuch darf erst in einem neuen Abo-Monat angefangen werden. Wer sein Hörbuch in einem Monat nicht schafft, kann es im zweiten Monat weiterhören, darf in diesem Monat dann aber kein zweites Hörbuch mehr anfangen.
Amazon Music Unlimited kostet standardmäßig 11 Euro pro Monat, Prime-Kunden zahlen lediglich 10 Euro pro Monat. Wer seinen Hörbuch-Konsum geschickt plant, kann aus der Amazon-Lösung also ein besseres Preisleistungsverhältnis herausschlagen als bei Spotify. Der schwedische Streaming-Dienst bietet bei seinem Hörbuch-Modell dagegen den Vorteil der Flexibilität – etwa die Möglichkeit, mehrere Hörbücher pro Monat auszuprobieren.
Zudem haben Hörbuch-Fans bei Amazon die Möglichkeit, ein Audbile-Abo zu buchen. Das eignet sich besonders für Personen, denen es nicht um Musik geht. Das Audible-Abo kostet 10 Euro im Monat und bietet monatlich einen Gutschein, der gegen ein beliebiges Hörbuch aus dem Portfolio eingelöst werden kann. Diese Hörbücher können in der eigenen Bibliothek über einen beliebigen Zeitraum angehört werden.
(dahe)
Künstliche Intelligenz
Kommentar: Reguliert endlich den Smart-Begriff!
Das smarte Home bleibt eine herstellerverursachte Hölle. Nichts deutet darauf hin, dass Kompatibilität über Einzelszenarien hinaus besser wird. Was Frickler und Fachbetriebe freut, ist für Menschen, die Technik vor allem nutzen wollen, ein Graus. Zeit für klare Regeln, was sich „Smart“ nennen darf!
Smart Home, das intelligente Heim, das ist eine Vision, die inzwischen schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Was anfing mit der Idee, nicht mehr im ganzen Haus selbst Rollläden steuern zu müssen, ist für viele Deutsche – und darunter sicher überproportional viele Leser von heise online – inzwischen zur modernen Alternative zur Modelleisenbahn geworden: Irgendwas lässt sich immer optimieren, und an neuen Modellen ist derzeit kein Mangel. Ergänzt wird das zudem von einer ganz anderen Entwicklung: dem Aufkommen von Solaranlagen, insbesondere kleineren solchen, bei denen jede eigenverbrauchte Wattstunde die Stromrechnung spürbar drückt. Wer würde da nicht versuchen, alles aufeinander abzustimmen?
Nur ein Bereich leistet bei den smarten Endgeräten bislang ganze Arbeit: die Marketingabteilungen. Elektrogeräten in jeder Form und Farbe, vom smarten Leuchtmittel über smarte Waschmaschinen bis zur Heizungs- und Stromsteuerung, Rollläden, Fernseher, Stecker, Uhren, Brillen, immer mehr Küchengeräte: Alles wird als smart gelabelt, sobald es einen Account in der Herstellercloud benötigt. Und das nicht mehr nur zur IFA in Berlin, wo die Branche traditionell ihre Neuerungen präsentiert. Und wo auch in diesem Jahr bis zur Fritteuse alles möglichst smart, vernetzt und intelligent sein soll. So schlau, dass der Mensch mit seinen beschränkten Fähigkeiten und daraus resultierenden Bequemlichkeitswünschen daneben schon sehr schlicht wirkt.
Über sieben Bridges solltst du gehen
In der Theorie wirkt dabei (Lichtstimmung: Party) alles schön: Balkonkraftwerk kaufen, anschließen, Strom ernten. Und damit das auch so richtig rund läuft und spart, lässt man bestimmte Geräte hinter smarten Steckdosen laufen. Und genau hier beginnt der harte Aufprall des Durchschnittsbürgers auf die technische Realität: Wolkige Versprechen, welche die meisten „smarten“ Geräte nicht im Ansatz halten (Lichtstimmung: Kalt). Das fängt mit einer banalen Grundfrage an: Wie soll zwischen den Geräten kommuniziert werden? Bluetooth-LE, DECT-ULE, ZigBee, WLAN, Matter oder etwas ganz anderes, proprietäres? Und wenn per WLAN, das Hausnetz, oder ein dafür eingerichtetes zweites Netz? Oder gar ein Insel-Access-Point, wie ihn etwa manche Wechselrichter dauerhaft aufspannen? Mit welcher Lösung soll dieser Zoo anschließend zentral gesteuert werden? App-basiert, per Cloudservice? Vom NAS aus? Welche Geräte sind überhaupt mit welcher Software über welchen Standard ansprechbar? Und wie lassen sich diese dann miteinander verknüpfen? Es ist das pure Chaos.
Lauter leere Versprechungen
Tatsächlich haben die Elektro- und Elektronikgerätehersteller vor allem eines geschafft: Die Lust an der Schlauerwerdung der eigenen vier Wände kräftig auszutreiben (Lichtstimmung: Grim, im Hintergrund beginnt die Waschmaschine zu rotieren). Denn wer sich wochenlang mit der Frage beschäftigen muss, welches Gerät überhaupt mit welchem sprechen kann, wenn die Herstellerangaben bei Geräten im besten Fall unvollständig, im schlechtesten Fall irreführend sind. Oder die mit Versprechungen werben, etwa der schon zur IFA 2023 angekündigten Unterstützung des Matter-Standards durch die Fritz-Produkte (Die Connect-Leuchte schaltet auf Dauerrot).
Zwei Jahre später kann immer noch nur ein Bruchteil der Geräte des Herstellers den gemeinsamen Standard, bei dem sich auch andere Anbieter weiterhin schwertun. Die einzige Frage, die sich bei so etwas dann wirklich stellt: Was soll das? (Der Rauchmelder versucht, aufgrund des Autoren-Schnaubens Qualm zu detektieren, die Dunstabzugshaube schaltet auf Höchstleistung).
Und so müssen sich die Nutzer weiterhin die Frage stellen: Über welche Bridge spricht welches Gerät mit welchem anderen? Wie kann ich die Glühbirne und den Wäschetrockner mit dem Stromspeicher und dem Bewegungssensor koordinieren lassen? Wie den Heizthermostat mit dem Fenstersensor? Was für den einen oder anderen heise-Leser, DIY-Freund, Kommandozeilenelektriker und selbstbewussten Maker primär eine sportliche Herausforderung sein mag, ist für die Nutzbarkeit durch breite Massen eine absolute Katastrophe.
Die EU sollte den „Smart“-Begriff scharf regulieren
Es ist daher höchste Zeit, dass Politik das tut, wofür sie nur selten geliebt wird: klare Regeln vorschreiben. Hier wäre das im Sinne aller Verbraucher. Denn so wie die EU nach Jahren mit den Vorgaben für USB-C-Anschlüsse das Steckerchaos und die Sonderwege zugunsten der Verbraucher beendet hat, ohne dass seitdem die Welt untergegangen ist, so wie die EU mit den Roamingvorschriften das Chaos für Reisende in Europa abgeschafft hat, wäre es jetzt an der Zeit, den Herstellern per Gesetz vorzuschreiben: Wenn ihr ein Gerät als Smart benennen wollt, dann müsst ihr dafür bestimmte Standards erfüllen.
Das kann auch ein Verweis auf technische Normen sein, welche die Branche selbst weiterentwickeln kann. Dann können Verbraucher sich darauf verlassen, dass „Smart“ nicht „Insellösung eines Herstellers der auf keinen Fall interoperabel sein will“ heißt. Und ganz nebenbei noch ein paar Vorgaben zum Thema Cloud-Unabhängigkeit mit auf den Weg geben. Wer Geräte als „Smart“ labeln will, sollte Mindeststandards bei Bedienbarkeit und Interoperabilität wahren müssen. Was spräche etwa gegen die Verpflichtung, die Konfiguration über eine lokal per Browser erreichbare Oberfläche verpflichtend zu machen? Und nicht nur über eine proprietäre App, die vielleicht noch einen Account beim Hersteller voraussetzt?
Der bisherige Wildwuchs, dass alles sich Smart nennt und in Wahrheit kaum etwas miteinander kompatibel ist, führt nur zu zwei Dingen: Frust und jeder Menge vermeidbarem Elektroschrott. Schluss damit! Dann hellt sich die Lichtstimmung in der Verbraucher-Smart-Welt auch wieder auf.

Falk Steiner ist Journalist in Berlin. Er ist als Autor für heise online, Tageszeitungen, Fachnewsletter sowie Magazine tätig und berichtet unter anderem über die Digitalpolitik im Bund und der EU.
(nen)
Künstliche Intelligenz
iX-Workshop: E-Rechnungspflicht – Anpassung von Faktura- und ERP-Software
Seit 2025 gilt in Deutschland die gesetzliche Verpflichtung zur strukturierten E-Rechnung im B2B-Bereich. Das betrifft insbesondere Softwareentwickler und Hersteller von Faktura- oder ERP-Software, die nun ihre Produkte entsprechend anpassen müssen.
Interaktiv und praxisnah
Unser Workshop E-Rechnungspflicht: Software richtig implementieren bietet Ihnen eine praxisnahe Anleitung, wie Sie die neuen XML-Formate des europäischen Rechnungsstandards EN16931, wie Cross Industry Invoice (CII), Universal Business Language (UBL), Factur-X und ZUGFeRD, sowie XRechnung im B2G-Bereich, unterstützen, prüfen und umwandeln können. Sie beschäftigen sich mit den Rollen, den Darstellungsdetails, der Umwandlung, der Prüfung und Umsetzung der X(ML)-Rechnung. Dazu gehören praktische Übungen, in denen Sie die verschiedenen XML-Formate kennen und anwenden lernen.
|
Oktober 06.10. – 10.10.2025 |
Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 07. Sep. 2025 |
Der nächste Workshop findet vom 06. bis 10. Oktober 2025 statt und richtet sich an Softwareentwickler und Projektleiter, die Software herstellen, Rechnungen erstellen oder einlesen, sowie an ERP-Softwarehersteller und Data Scientists, die Auswertungen erstellen. An drei Vormittagen (06., 08. und 10. Oktober) treffen Sie sich online in der Gruppe mit dem Trainer. Für den zweiten und vierten Tag nehmen Sie Aufgaben mit, die Sie selbstständig lösen und am Folgetag in der Gruppe besprechen können.
Durch den Workshop führen Andreas Pelekies, technischer Erfinder des ZUGFeRD-Standards und (Co-)Autor verschiedener internationaler Standards, sowie Jochen Stärk, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Backend-Entwickler. Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung und haben sich auf Themen rund um die E-Rechnung spezialisiert.
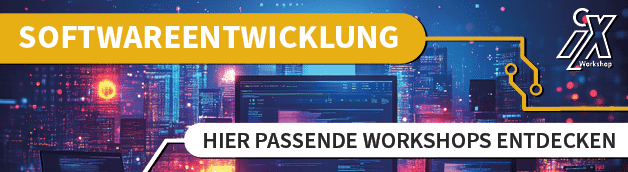
(ilk)
Künstliche Intelligenz
Strippenlos: Ladeständer für AirPods Max und weitere AirPods
Inzwischen lassen sich fast alle Apple-Mobilgeräte auf Wunsch auch drahtlos aufladen, sei es nun ein iPhone via MagSafe oder AirPods-Stöpsel und Apple Watch via Ladepuck. Bei den AirPods Max, Apples teuren Over-Ear-Kopfhörern, fehlt die Funktion hingegen. Zwar sind sie seit dem vergangenen Jahr erstmals mit einer USB-C-Ladefunktion (statt proprietärem Lightning-Anschluss) ausgerüstet, doch eine induktive Stromversorgung hat Apple nicht eingebaut. Stattdessen lädt man die Geräte mittels Strippe, deren Stecker man, sofern sich die AirPods Max in ihrer Hülle befinden, mehr schlecht als recht in die Buchse hineinfriemeln muss. Der langjährige Apple-Zubehöranbieter Mophie, ein Tochterunternehmen von Zagg, hat hier jetzt eine Lösung parat, von der man sich fragt, warum sie jetzt erst aufgetaucht ist: einen Ladeständer speziell für die Apple-Over-Ears, der zudem noch ein zweites Gerät mit Strom versorgen kann.
Magnetischer Dongle
Der AirPods Max Charging Stand hat zwei Einsätze aus Silikon, in die die Ohrmuscheln genau hineinpassen. Statt mit einem ausgefahrenen Stecker zu arbeiten – was einfacher gewesen wäre –, setzt Mophie zur Verbindungsherstellung auf einen USB-C-Dongle, der in die USB-C-Buchse der AirPods Max gesteckt wird.
Dieser ist magnetisch und sorgt dafür, dass die Kopfhörer stets korrekt über den Ladepins platziert werden. Den von Mophie publizierten Bildern nach zu urteilen ist der Dongle flach, dürfte aufgrund seiner dunklen Farbe aber je nach AirPods-Max-Variante hervorstechen.
Alu, aber hoher Preis
Nützlich ist, dass die AirPods Max sofort nach dem Auflegen in den Schlafmodus wechseln, also nicht unnötig weiter Strom verbrauchen. Der Schlafmodus wird auch aktiv, wenn man die AirPods Max in ihre Hülle einlegt. Neben der AirPods-Max-Ladefunktion hat der AirPods Max Charging Stand noch eine zweite Funktion: Unten befindet sich eine Qi-fähige Ladematte. Diese lässt sich etwa zum gleichzeitigen Laden regulärer AirPods-Stöpsel mit drahtlosem Ladecase nutzen – ob andere Geräte wie Handys genügend Platz finden und auch Apple-Uhren geladen werden können, blieb zunächst unklar.
Mophie macht auch keine Angaben dazu, ob der AirPods Max Charging Stand ein eigenes Netzteil mitbringt oder eine USB-C-Stromversorgung benötigt. Ein Kabel scheint beizuliegen. Mophie will für die AirPods-Max-Lader eine ganze Stange Geld: Das aus Alu und Silikon gefertigte Gerät steht mit 139,95 Euro in der Preisliste. Aktuell gibt es 5 Euro Rabatt, nach Deutschland zahlt man für das Porto nichts.
(bsc)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Woche
UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 3 Wochen
Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 4 Tagen
Entwicklung & Codevor 4 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events















