Datenschutz & Sicherheit
Das Geschäft austrocknen: Großbritannien will Ransomwarezahlungen verbieten
In Großbritannien soll es staatlichen Einrichtungen und Betreibern kritischer Infrastruktur verboten werden, nach einem Angriff mit Ransomware Lösegeld zu bezahlen. Unternehmen, die das nicht betrifft, sollen dazu verpflichtet werden, die Regierung zu informieren, bevor sie eine solche Zahlung tätigen. Das hat die Regierung angekündigt, nachdem der öffentliche Konsultationsprozess für die Maßnahme jetzt abgeschlossen wurde. Laut der Mitteilung haben sich fast drei Viertel der Beteiligten für die Pläne ausgesprochen. Ziel des Plans ist es, das Geschäftsmodell hinter den Ransomware-Attacken ins Visier zu nehmen und öffentliche Einrichtungen zu einem weniger interessanten Ziel zu machen.
Das Geschäft austrocknen
Das Verbot der Lösegeldzahlung würde demnach etwa für das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien, Kommunalverwaltungen und Schulen gelten, erklärt die Regierung. Unternehmen, die nicht darunter fallen und die eine Zahlung planen, sollen beraten und eventuell gewarnt werden, wenn sie damit möglicherweise gegen Sanktionen verstoßen würden. Das könnte der Fall sein, wenn das Geld an eine der vielen Ransomware-Gruppen geht, die aus Russland kommen. Zudem bereite man eine Berichtspflicht vor, die es den Strafverfolgungsbehörden erleichtern würde, gegen die Verantwortlichen solcher Schadsoftware vorzugehen.
In der Mitteilung drängt die Regierung die unterschiedlichen Organisationen im Land auch erneut, mehr für die Cybersicherheit zu tun. Dazu gehörten offline vorgehaltene Backups, Pläne für einen längeren Betrieb ohne IT und eine „gut eingeübte Praxis bei der Wiederherstellung von Daten aus Backups“. Cyberkriminalität, etwa mit Ransomware, habe Schäden in Milliardenhöhe verursacht und gefährde auch Menschenleben. Erst vor Kurzem wurde öffentlich gemacht, dass ein Cyberangriff erstmals zum Tod eines Menschen beigetragen hat. Der hatte nachweislich zu einer Verzögerung der Patientenversorgung und damit zu dem Todesfall geführt.
Lösegeldzahlungen nach Angriffen mit Ransomware sind 2024 merklich zurückgegangen, hat Anfang des Jahres ein Blockchain-Analysefirma ermittelt. Chainalysis hat dafür Maßnahmen von Strafverfolgungsbehörden, eine bessere internationale Zusammenarbeit und die häufigere Zahlungsverweigerung verantwortlich gemacht. Vor allem letztere möchte London nun weiter vorantreiben. Aber auch die geringe Zuverlässigkeit der Kriminellen hat wohl dazu beigetragen, die Opfer können einfach nicht davon ausgehen, dass sie nach der Zahlung ihre Daten zurückbekommen. Das war das Ergebnis einer Studie vor einem Jahr. In der hieß es damals auch, dass ein Verbot solcher Zahlungen bis dahin keinen merklichen Effekt gehabt hatte.
(mho)
Datenschutz & Sicherheit
Signal veröffentlicht plattformübergreifendes Cloud-Backup als Beta für Android
Signal-Backups werden besser: Beim Plattformwechsel zwischen Android und iOS war bislang stets mit einem Verlust des Chatarchivs des Signal-Messengers zu rechnen. Mit einer neuen Beta-Version des Messengers zieht ein hauseigener Cloud-Backup ein, mit dem sorgenfrei zwischen iPhones und Android-Geräten umgezogen werden können soll. Die Beta ist derzeit nur für Android-Geräte über Github als APK-Datei verfügbar.
Im Juni dieses Jahres hatte Signal bereits einen eigenen Cloud-Backupdienst angekündigt. Diesen will das Unternehmen selbst hosten und sämtliche Nachrichten und Medien mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung absichern, sodass nur der Nutzer oder die Nutzerin mit einem entsprechenden Schlüssel Zugriff darauf erhält.
Ein Vorteil dieser neuen Backup-Funktion ist laut Signal, dass im Unterschied zu den bisherigen Lösungen ein unabhängiges Backup-Format zum Einsatz, das alle Clients lesen können. Damit ist es etwa möglich, Backups auf Android zu erstellen und auf iOS wiederherstellen zu können – oder umgekehrt.
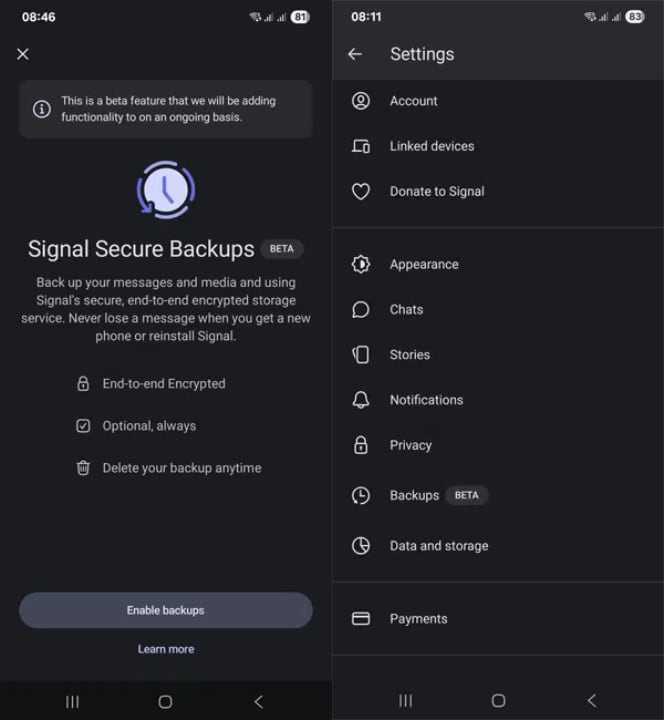
Der Signal.-Messenger erhält neue Backup-Funktionen. Derzeit als Beta für Android.
(Bild: Signal)
Ein weiterer Vorteil der Cloud-Backup-Lösung ist, dass Nutzer ihre Nachrichten und Medien auch nach Verlust oder Beschädigung ihres Geräts wiederherstellen können. Das war bislang bei Signal nicht möglich, da die Chatdaten des Messengers nur auf dem Smartphone gespeichert sind. Dennoch bleiben Backups weiterhin optional und jederzeit löschbar.
100 GByte Speicher für 2 Dollar
Überdies bietet das Unternehmen eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version des Backups an. Mit der kostenpflichtigen Variante können Nutzerinnen und Nutzer mithilfe einer dynamischen Medienverwaltung Speicherplatz auf dem Gerät sparen. Damit sollen Medien automatisch in die Signal-Cloud hochgeladen und beim Scrollen nach oben wieder automatisch heruntergeladen werden können.
Auch an verschwindende Nachrichten und einmalig anzeigbare Medien hat Signal gedacht. Diese schließt das Backup aus – dabei sei es egal, ob sie gelesen wurden oder nicht. „Signal ist der Ansicht, dass dies einen guten Mittelweg darstellt.“
Für die kostenpflichtige Version von Signal-Backups hat das Unternehmen einen Preis von monatlich zwei Dollar angedacht, wobei sich dieser noch ändern könne. Für diesen Betrag können Nutzer ihr Medien bis zu einer maximalen Größe von 100 GByte sichern. Bei der kostenlosen Version will Signal nach aktuellem Stand alle Textnachrichten sowie Medien der letzten 45 Tage sichern.
Bessere lokale Backups
Neben den Cloud-Backups sollen die lokalen Backups für Android erhalten bleiben und auch für iOS und Desktops folgen. Mit dieser Option sollen sich kostenlose vollständige lokale Backups erstellen lassen.
Zudem arbeitet Signal an einer verbesserten Version der lokalen Backups, die ein neues plattformübergreifendes Format verwendet und nur geänderte Medien speichern soll. Durch diesen Ansatz sollen lokale Backups deutlich weniger Speicherplatz benötigen und sich dadurch schneller erstellen lassen – „statt Minuten dauern sie nur noch Sekunden“, so das Unternehmen. Die verbesserten lokalen Backups werden kurz nach der Einführung der Signal-Backups verfügbar sein, heißt es.
Signal hat keine konkreten Angaben für die Veröffentlichung der fertigen Funktion gemacht. Es kann noch Woche oder Monate dauern, bis sie freigegeben wird.
(afl)
Datenschutz & Sicherheit
Sicherheitsvorfall bei Plex: Nutzerdaten beim Medienserver-Anbieter gestohlen
Beim Hersteller des Medienservers Plex haben Cyberkriminelle Nutzerdaten geklaut. Das teilte die Plex Incorporated ihren Kunden per E-Mail mit. Die Angreifer hätten eine „begrenzte Teilmenge“ der Daten einer Kundendatenbank unberechtigt abgerufen. Nun sind alle Plex-Nutzer aufgerufen, ihre Passwörter zu ändern und Medienserver neu zu verbinden.
Wie das Plex-Team weiter schreibt, sind E-Mail-Adressen, Benutzernamen und die Hashes der Passwörter abhandengekommen. Letztere seien „in Übereinstimmung mit anerkannten Praktiken“ gehasht und somit nicht durch Angreifer lesbar. Kreditkartendaten seien nicht betroffen, versichern die Plex-Betreiber. Man habe den Vorfall schnell eingedämmt und die Sicherheitslücke geschlossen – den Datenabfluss aber nicht verhindern können.
Nutzer des selbst gehosteten Medienservers sollen unverzüglich ihr Passwort ändern und zudem alle verbundenen Geräte von ihrem Konto entkoppeln. Das betrifft alle Abspielgeräte (wie Smartphones, Tablets oder Smart-TVs), aber auch den Medienserver selbst, der dann neu an das Konto gebunden (im Plex-Jargon „claimed“) werden muss. Für die Mehrarbeit entschuldigt sich das Plex-Team, rechtfertigt sie jedoch mit der erhöhten Kontosicherheit. Zudem legen sie ihren Kunden nahe, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.
Phishing-Gefahr und Stress im Forum
Da die Kriminellen Benutzernamen und E-Mail-Adressen der Plex-Kunden erbeuteten, können sie jetzt sehr realistisch wirkende Phishing-Mails verfassen. Vor dieser Gefahr warnt der Sicherheitshinweis und weist darauf hin, dass man weder per E-Mail nach Passwörtern noch nach Zahlungsdaten frage.
In den Hilfeforen des Herstellers sowie im Plex-Subreddit häufen sich kurz nach der Ankündigung die Anfragen gestresster Kunden. Mehrere Betroffene konnten auf ihren Medienserver nach der Passwortänderung nicht mehr zugreifen, häufig aufgrund Besonderheiten bei containerbasierten oder NAS-Installationen. Wen nach der Passwortänderung ähnliche Schwierigkeiten plagen, der sollte zunächst den Support-Artikel sowie Foreneinträge wie diesen und diesen zu Rate ziehen.
In den vergangenen Monaten hatten es Nutzer des populären Medienservers nicht leicht. Erst vergrämte Plex einige Kunden mit einer Veränderung des Geschäftsmodells, dann gab es im August eine Sicherheitslücke in der Serversoftware. Auch der ungebetene Besuch in der Plex-Kundendatenbank ist kein Einzelfall: Bereits 2022 kopierten Kriminelle Nutzerdaten und vor zehn Jahren crackten sie das Plex-Forum.
(cku)
Datenschutz & Sicherheit
„Single point of failure“: 400 Wissenschaftler gegen Chatkontrolle
Bereits zum dritten Mal seit 2023 wenden sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von europäischen Forschungseinrichtungen in einem offenen Brief gegen EU-Pläne für eine sogenannte Chatkontrolle. In dem Schreiben an EU-Kommission und Europaparlament warnen rund 400 Forscher vor negativen Folgen für Sicherheit und Grundrechte.
Chatkontrolle bricht Verschlüsselung
Die Forscher nehmen Stellung zu den neuesten Entwürfen für eine Verordnung zur Chatkontrolle. Damit soll die Suche nach Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs auf Endgeräten wie Smartphones verpflichtend werden – was nach Meinung der Wissenschaftler jegliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und andere Methoden für Gerätesicherheit aushebelt.
Solche Mechanismen stellen nach Ansicht der Forschenden einen „single point of failure“ dar, also einen Ansatzpunkt etwa für Schadsoftware. Zudem seien diese Detektoren nicht zuverlässig genug: „Bestehende Forschungsergebnisse bestätigen, dass Detektoren nach dem aktuellen Stand der Technik unannehmbar hohe Falsch-Positiv- und Falsch-Negativ-Raten aufweisen.“
KI ist auch keine Lösung
Auch KI sei dafür keine Lösung, weil sie unter anderem nicht erkennen könne, welche Parteien einander explizites Material schicken würden. Die Wissenschaftler verweisen hier auf Teenager, die einander eventuell Daten schicken könnten. Zudem böten heutige KIs ihrerseits eine große Angriffsfläche für Manipulation, die sich Kriminelle dann zunutze machen könnten, um die Mechanismen zu umgehen.
Überdies habe ein de-facto-Aus für verschlüsselte Chats auch Nebenwirkungen auf Menschen, die vertraulich kommunizieren müssen. Die Wissenschaftler nennen hier Politiker, Strafverfolger, Journalisten und Menschenrechtler. Diese seien auf Werkzeuge wie Signal angewiesen, das im Fall der Umsetzung der Chatkontrolle schon seinen Rückzug aus der EU angekündigt hat.
Dass die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen durch die Kontrolle auf Endgeräten nennenswert verhindert werden könnte, bezweifeln die Forschenden. Vielmehr käme es auf Bildung, sensibilisierte Meldestellen und gezielte Suche nach derartigen Inhalten an. Langfristig würde nur die Eindämmung von Missbrauch an sich auch die Verbreitung der Dokumentation dieser Verbrechen bewirken.
Unterstützung nicht nur aus Europa
Zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehören über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 33 Ländern, nicht nur den EU-Staaten. Vor allem technische Universitäten, aber auch Mitarbeiter von Einrichtungen wie dem Max-Planck-Institut oder der Fraunhofer-Gesellschaft zählen dazu. Auch aus den USA, Kanada, Israel und Taiwan gibt es Unterstützung.
Die genannten Einrichtungen unterstützen die Forderungen teils nicht direkt, geben ihren Wissenschaftlern aber die Freiheit, sich öffentlich dazu zu äußern. Darauf wies in einer vorab verbreiteten Mitteilung unter anderem das CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit aus Deutschland hin.
Die lose organisierten Wissenschaftler, die sich bisher nicht unter einer Initiative mit eigenem Namen zusammengefunden haben, haben ähnliche Briefe an die EU seit 2023 bereits dreimal geschrieben. Mit 400 Unterzeichnern hat der neue Brief die bisher größte Unterstützung. Die Wissenschaftler greifen dabei den aktuellen Vorschlag der Kommission auf, nachdem die Einigung auf einen Kompromiss im Mai 2025 gescheitert ist.
Lesen Sie auch
(nie)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Woche
UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Social Mediavor 3 Wochen
Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 6 Tagen
Entwicklung & Codevor 6 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events













