Künstliche Intelligenz
KI-Update: Trumps AI-Plan, Google, KI am Fraport, Chatbot mit Datenschutz
Trump: „Amerika wird das KI-Rennen gewinnen“
Donald Trump hat einen AI Action Plan vorgelegt, der erwartungsgemäß eine „America First“-Strategie verfolgt. Der Kern seines Plans ist radikal: Er verbietet sämtliche Regulierung von KI, auch bei urheberrechtlich geschützten Trainingsmaterialien. Dies stellt laufende US-Klagen zu diesem Thema in Frage.

Die Situation in den USA war bisher durch etwa 700 unterschiedliche, teils widersprüchliche KI-Gesetze auf Bundesstaatsebene geprägt – eine Rechtsunsicherheit, die selbst große KI-Anbieter kritisierten. Trump lockert zudem Umweltauflagen für KI-Infrastruktur wie Rechenzentren, trotz bereits bestehender Wasserversorgungsprobleme an solchen Standorten. Seine Forderung nach „Bias-freien“ Modellen zielt weniger auf echte Neutralität als auf die Vermeidung ihm unliebsamer KI-Aussagen.
US-Behörde FDA setzt fehleranfällige KI bei Medikamentenzulassungen ein
Die US-Arzneimittelbehörde FDA verwendet ein generatives KI-System namens „Elsa“, das regelmäßig Fakten erfindet. Mitarbeiter berichten, dass das zur Beschleunigung von Medikamentenzulassungen gedachte System nicht existierende Studien halluziniert und Forschungsdaten falsch darstellt.
„Alles, wofür man keine Zeit hat, es zu überprüfen, ist unzuverlässig“, erklärte ein aktueller FDA-Mitarbeiter. Trotz dieser bekannten Schwächen wird Elsa bereits aktiv zur Bewertung klinischer Protokolle und zur Inspektion von Laboren eingesetzt. In den USA fehlen bislang verbindliche Regeln für den KI-Einsatz im Gesundheitswesen, doch FDA-KI-Chef Jeremy Walsh verspricht baldige Verbesserungen des Systems.
Google: KI-Inhalte erlaubt, aber SEO-Grundregeln bleiben unverändert
Google hat auf seiner Konferenz Search Central Live klargestellt: KI-generierte Inhalte sind vollkommen zulässig, solange sie qualitativ hochwertig sind. Die Suchmaschinenoptimierung folgt weiterhin denselben Grundprinzipien – eine separate „AI SEO“-Strategie sei unnötig.
Die technische Infrastruktur bleibt auch für KI-Funktionen wie „AI Overviews“ unverändert: Derselbe Crawler, Index und dieselben Ranking-Systeme kommen zum Einsatz. KI ist mittlerweile in allen Phasen der Suchmaschine integriert, von der Planung optimaler Crawling-Zeitpunkte bis zur Erkennung unerwünschter Inhalte. Googles Behauptung, SEO bleibe unverändert wichtig, steht allerdings im Widerspruch zu Daten des Pew Research Center: Die Klickrate auf klassische Suchergebnisse sinkt von 15 auf nur 8 Prozent, wenn eine KI-Zusammenfassung erscheint.
Frankfurter Flughafen optimiert Abfertigung mit KI-Kameras
Am Frankfurter Flughafen soll eine KI-gestützte Kameratechnik die Flugzeugabfertigung beschleunigen. Fraport, der Flughafenbetreiber, und Lufthansa, eine Airline, setzen auf umfassende Bildaufzeichnungen mit präzisen Zeitstempeln, um den gesamten Abfertigungsprozess zu dokumentieren.
Die KI klassifiziert die aufgezeichneten Abläufe, ohne direkt einzugreifen – Ziel ist die Optimierung der Prozesse durch bessere Transparenz. Die Vorbereitung eines Flugzeugs für den Start dauert zwischen 25 und über 100 Minuten und umfasst verschiedene, von unterschiedlichen Dienstleistern durchgeführte Schritte. Das System ist bereits an fünf Positionen aktiv und soll bis Herbst auf 15 weitere ausgedehnt werden, bevor es flächendeckend zum Einsatz kommt.

Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im „KI-Update“ von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen. Freitags beleuchten wir mit Experten die unterschiedlichen Aspekte der KI-Revolution.
IETF diskutiert Maßnahmen gegen den Ansturm der KI-Crawler
Die Internet Engineering Task Force (IETF), eine Organisation zur Weiterentwicklung des Internets, kämpft mit einem massiven Ansturm von KI-Crawlern. Binnen eines Jahres stiegen die ChatGPT-Anfragen beim IETF Datatracker um 4.000 Prozent, von 3,5 Milliarden monatlichen Anfragen werden 3,23 Milliarden als Bot-Anfragen sofort verworfen.
Dieser dramatische Anstieg zwang die IETF zur Umstellung ihrer Infrastruktur. Ähnlich betroffen sind Cloudflare mit 300 Prozent mehr GPT-Bot-Verkehr und die Wikimedia-Stiftung mit 50 Prozent mehr Bot-Bandbreitenbedarf seit Januar 2024. Mehrere IETF-Arbeitsgruppen entwickeln nun Gegenmaßnahmen: Die Gruppe AIPref arbeitet an einem Robots.txt-Update, während WebBotAuth Bots zur kryptographischen Identifizierung verpflichten will. Google, OpenAI und Microsoft, allesamt KI-Entwickler, signalisieren Unterstützung für entsprechende Standards.
Proton veröffentlicht datenschutzfreundlichen KI-Chatbot Lumo
Der Schweizer Software-Anbieter Proton hat mit „Lumo“ einen datenschutzfreundlichen KI-Chatbot als europäische Alternative zu ChatGPT veröffentlicht. Die Anwendung, die bei Dokumentenzusammenfassungen oder Codeprüfungen helfen soll, verschlüsselt alle Chats, sodass sie nur auf dem Nutzergerät lesbar sind.
Gespräche werden weder an Dritte weitergegeben, zum Training genutzt noch auf Proton-Servern gespeichert. Lumo nutzt mehrere Open-Source-Sprachmodelle von Mistral, Nvidia und dem Allen Institute for AI, deren Zusammensetzung gelegentlich wechselt. Proton setzt auf einen multimodalen Ansatz mit spezialisierten kleineren Modellen statt großen General-Purpose-Modellen, was laut Unternehmen effizienter und kostengünstiger ist. Der Chatbot ist Open Source und kann ohne Nutzerkonto kostenlos ausprobiert werden.
Menschliche Fehler im KI-Benchmark „Humanity’s Last Exam“
Der KI-Benchmark „Humanity’s Last Exam“ (HLE), der als anspruchsvoller Test für moderne Sprachmodelle konzipiert wurde, weist selbst erhebliche Mängel auf. Eine Analyse von FutureHouse zeigt, dass etwa 29 Prozent der Biologie- und Chemiefragen im Test Antworten enthalten, die gemäß Fachliteratur falsch oder irreführend sind.
Der Test, der die Grenzen künstlicher Intelligenz messen sollte, scheitert somit an menschlicher Genauigkeit. Bei der ursprünglichen Erstellung war die Überprüfung durch Fachleute auf wenige Minuten begrenzt, eine vollständige Richtigkeitsprüfung nicht vorgesehen. Als Reaktion hat FutureHouse ein überprüftes Teilset des Tests auf der Plattform HuggingFace veröffentlicht.
KI unterliegt im Coding-Duell: Mensch gewinnt nach zehn Stunden
Bei den AtCoder World Tour Finals hat der polnische Entwickler Przemysław Dębiak eine KI von OpenAI in einem zehnstündigen Programmierwettbewerb knapp besiegt. Alle Teilnehmer mussten ein Optimierungsproblem ohne exakte Lösung bearbeiten und in 600 Minuten möglichst gute Näherungen finden.
Dębiak erreichte etwa 1,81 Billionen Punkte, während die KI auf 1,65 Billionen kam – ein Unterschied von rund 9,5 Prozent. Bemerkenswert ist, dass die KI den zweiten Platz belegte, noch vor zehn weiteren menschlichen Finalisten. OpenAI bezeichnete das Ergebnis als Meilenstein. Das verwendete Modell sei vergleichbar mit o3, einem System für strategisches Denken und langfristige Planung.

(mali)
Künstliche Intelligenz
Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Nvidias Super-Netzwerktechnik
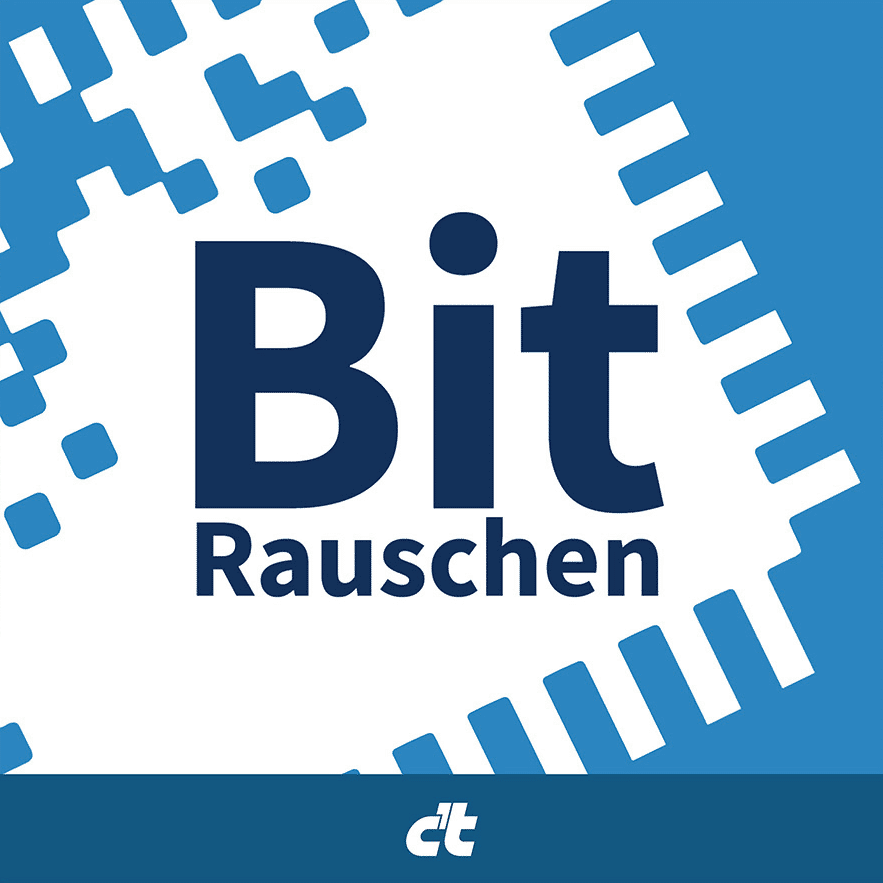
Den Prozessor-Podcast von c’t gibt es jeden zweiten Mittwoch …
Nvidia jagt von einem Umsatzrekord zum nächsten und ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Das liegt vor allem an den starken KI-Beschleunigern, die den aktuellen KI-Hype befeuern.
Doch KI-Chips alleine machen noch kein optimales KI-Rechenzentrum – sonst würden Konkurrenten wie AMD oder Cerebras viel mehr davon verkaufen. Es braucht noch mehr Zutaten, etwa die etablierte Programmierschnittstelle CUDA.
Weniger im Rampenlicht steht eine weitere wichtige Komponente: die Vernetzungstechnik NVLink. Nvidia hat sie geschickt fortentwickelt und tief in die KI-Beschleuniger integriert. Mit InfinityFabric und offenen Ansätzen wie Ultra Ethernet und Ultra Accelerator Link (UAL) wollen die Konkurrenten aufholen.
Was NVLink so besonders macht, erklärt c’t-Redakteur Carsten Spille in Folge 2025/19 von „Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t“.
Podcast Bit-Rauschen, Folge 2025/19 :
Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik zum Bit-Rauschen. Rückmeldungen gerne per E-Mail an bit-rauschen@ct.de.
Alle Folgen unseres Podcasts sowie die c’t-Kolumne Bit-Rauschen finden Sie unter www.ct.de/Bit-Rauschen
(ciw)
Künstliche Intelligenz
Marktanteil von Windows 10 steigt trotz Support-Ende, Windows 11 weniger gefragt
In den letzten Monaten haben immer weniger PC-Anwender Windows 10 genutzt, während der Marktanteil von Windows 11 langsam gestiegen ist. Im Sommer wurde Microsofts aktuelles Betriebssystem weltweit sogar erstmals öfter verwendet als der Vorgänger. Doch dieser Trend ist nicht nur gestoppt, sondern hat sich sogar umgekehrt. Nach jüngsten Zahlen von Marktforschern ist der Marktanteil von Windows 11 wieder gefallen, während die Nutzung von Windows 10 zunimmt – obwohl diese Betriebssystemversion in Kürze keinen Support mehr erhält.
Anfang dieses Jahres befand sich Windows 11 im Aufschwung, wohl aufgrund des nahenden Support-Endes von Windows 10. Doch die meisten Nutzer verwenden noch Windows 10. Erst von Juni bis Juli dieses Jahres konnte Windows 11 seinen Vorgänger als das meistgenutzte Microsoft-Betriebssystem überholen und erreichte laut Statcounter einen globalen Marktanteil von 53,5 Prozent. Windows 10 fiel zu diesem Zeitpunkt auf 42,9 Prozent.
Diese Entwicklung hat sich im August wieder umgedreht. Der Marktanteil von Windows 11 ist demnach weltweit auf 49,1 Prozent gefallen, während Windows 10 zuletzt auf 45,5 Prozent gestiegen ist. In Deutschland hatte sich dieser Trend zuvor bereits abgezeichnet. Seit Mai 2025 steigt der Marktanteil von Windows 10 hier wieder, zuletzt auf 58,6 Prozent, während Windows 11 in diesem Zeitraum stetig gefallen ist und jetzt bei 38,4 Prozent Marktanteil liegt. Das ist nur etwas mehr als im Februar dieses Jahres und weniger als noch im März.
Win-11-Kampagne offenbar nicht erfolgreich
Das irische Unternehmen Statcounter analysiert nach eigenen Angaben monatlich mehr als 5 Milliarden Zugriffe auf über 1,5 Millionen Websites. Die Messungen gelten als nicht repräsentativ für das gesamte Internet und die Prozentangaben sollten nicht überbewertet werden, aber Trends lassen sich daraus erkennen. Offenbar ist die von Microsoft gerührte Werbetrommel für den Umstieg auf Windows 11 weniger erfolgreich als erhofft. Denn seit dem letzten Jahr spielt Microsoft auf Windows-10-Rechnern bildschirmfüllende Werbung für Copilot+-Laptops aus. Diese Premiumgeräte enthalten einen neuronalen Prozessor, der Microsofts KI-Anwendungen in Windows 11 unterstützt.
Zwar verspricht Microsoft, dass Windows-10-Besitzer ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 erhalten. Doch dieses Gratis-Upgrade auf Windows 11 gibt es zum Support-Ende für Windows 10 nur unter bestimmten Voraussetzungen. Denn auf vielen PCs läuft der Windows-10-Nachfolger nicht, und dann heißt es entweder aufrüsten oder (öfter) neu kaufen, und das geht eben doch ins Geld. So setzt Windows 11 höhere Anforderungen an die Hardware-Ausstattung als dessen Vorgänger und verlangt etwa TPM-2.0-fähige Prozessoren. Zudem könnten Nutzer kein Gratis-Upgrade erhalten, wenn sie ihren PC bereits unter Windows 10 gewechselt oder aufgerüstet haben. Auch wer seinerzeit das Gratis-Upgrade von Windows 7/8/8.1 auf 10 angenommen hat, geht jetzt womöglich leer aus.
Win-10-Updates ab Oktober kostenpflichtig
Doch wenn Windows 10 ab Mitte Oktober keine Updates und vor allem keine Sicherheitsaktualisierungen mehr erhält, bleiben eventuelle Sicherheitslücken offen. Diese könnten von Cyberkriminellen ausgenutzt werden, um ihre Rechte in Systemen auszuweiten, sich einzunisten oder sich in Netzwerken fortzubewegen, für Spionage oder etwa für Ransomware-Angriffe. Für solche Systeme bietet Microsoft Supportverlängerungen für Windows 10 an, auch für Privatanwender.
Unternehmenskunden zahlen dafür im ersten Jahr 61 US-Dollar pro Gerät und können die Verlängerungsoption bis zu drei Jahre in Anspruch nehmen. Die Preise dafür steigen in den Folgejahren. Privatkunden erhalten die Option einmalig zum Preis von 30 US-Dollar für ein Jahr. Nach den aktuellen Statcounter-Messungen könnten diese Angebote ein lukratives Geschäft für Microsoft werden.
Lesen Sie auch
(fds)
Künstliche Intelligenz
Lumex statt Cortex: ARMs neue Kerne für Smartphones und Tablets
ARM erneuert sein Aufgebot an Standard-CPU-Kernen für Smartphones, Tablets und Notebooks. Während ARM bisher drei unterschiedliche CPU-Kerne in seinen Mobilprozessoren vorsah, sind es mit Lumex nun vier. Sie heißen C1-Ultra, C1-Premium, C1-Pro und C1-Nano. Die Namen geben Auskunft über die Leistungsfähigkeit: Der Ultra rangiert ganz oben und ist noch etwas stärker dimensioniert als die bisher dicksten Kerne der Klasse Cortex-X. Der neue C1-Premium sortiert sich zwischen dem bisherigen Cortex-X und der Cortex-A700-Serie ein. C1-Pro entspricht ebendieser A700-Serie, der C1-Nano ist das Pendant zu den bisherigen Cortex-A500-Kernen. Die Lumex-Cluster unterstützen die ARMv9.3-A-Architektur.
Chipdesigner sollen ihre Prozessoren mit den jetzt vier Standardkernen feiner nach den eigenen Bedürfnissen abstimmen können. Zu den Abnehmern der Standardkerne gehören bislang etwa Mediatek, Nvidia, Google und Samsung.
Um eine höhere Leistung zu erreichen, schraubt ARM unter anderem die maximalen Taktfrequenzen nach oben, setzt auf erneut größere Caches, größere Instruktionsfenster und eine überarbeitete Sprungvorhersage. Der C1-Ultra soll mit einem modernen 3-Nanometer-Fertigungsprozess für dauerhafte Taktfrequenzen von bis zu 4,1 GHz ausgelegt sein – kurzfristige Boost-Modi gehen noch etwas weiter. Mit dem C1-Premium sind 3,5 GHz möglich, Pro (2,5 GHz) und Nano (2 GHz) laufen entsprechend langsamer. Alternativ bietet ARM Designbibliotheken an, die zulasten der Leistung auf einen möglichst niedrigen Platzbedarf getrimmt sind. Diese Varianten bieten sich etwa für Billiggeräte an.
Das Octa-Core-Referenzdesign von ARM setzt sich aus zwei C1-Ultra und sechs C1-Pro zusammen. Für Mittelklassegeräte schlägt ARM den C1-Premium statt des Ultra vor. Der C1-Pro kann entweder der schwächere, stromsparende Teil eines schnellen Prozessors sein oder, in Kombination mit dem kleinen C1-Nano, als stärkerer Part in einem Einsteigerprozessor arbeiten. Lumex unterstützt wie der Vorgänger Designs mit bis zu 14 CPU-Cores. Firmen wie Mediatek und Nvidia lösen sich zunehmend von ARMs Referenzdesign und kombinieren bei ihren High-End-CPUs ausschließlich die zwei schnellsten Kernklassen.

Arm Lumex
(Bild: Screenshot: heise online)
Für das Lumex-Referenzdesign errechnet ARM Performancegewinne von 25 Prozent bei Singlethread-Aufgaben und 45 Prozent beim Multithreading, jeweils im Vergleich mit der letztjährigen Generation, bestehend aus Cortex-X925, -A725 und -A520. Die Gaming-Leistung will ARM um 16 Prozent nach oben geschraubt haben. Bei gleicher Performance soll die elektrische Leistungsaufnahme um 28 Prozent sinken.
Weiter keine NPU von ARM
Eine eigenständige KI-Einheit (Neural Processing Unit, NPU) für KI-Berechnungen sieht ARMs Design weiterhin nicht vor. Alle KI-Aufgaben kommen zunächst auf den CPU-Kernen an und werden dann gegebenenfalls an die GPU weitergereicht. Chipdesigner können jedoch weiterhin eine eigene NPU an das ARM-Cluster anflanschen. Mit der neuen Architekturerweiterung SME2 (Scalable Matrix Engine), die allen vier Core-Typen zur Verfügung steht, verspricht ARM deutliche Steigerungen bei KI-Berechnungen durch die CPU: Sie sollen im Durchschnitt um den Faktor 3,7 schneller ablaufen. Die Latenz bei Spracherkennung mit Whisper will ARM um den Faktor 4,7 verringert haben, LLM-Enkodierung mit Gemma 3 läuft nun mit 398 statt 84 Token pro Sekunde. Die KI-Sound-Generierung mit Stable Audio ist nun in 9,7 statt 27 Sekunden abgearbeitet, so der Hersteller.
SME2 ist eine optionale Erweiterung der CPU. Auf einem High-End-Prozessor empfiehlt ARM einen oder zwei dieser SME2-Erweiterungen einzubauen.

Arm Mali G1-Ultra
(Bild: Screenshot: heise online)
Bei der GPU kehrt ARM von der zuletzt verwendeten Bezeichnung Immortalis zurück zum Namen Mali. Mit einem bis fünf GPU-Kernen trägt sie den Namen Mali G1-Pro, sechs bis neun Kerne heißen Mali G1-Premium und alles darüber Mali G1-Ultra. Die G1-Ultra zeichnet sich neben der größeren Zahl Kerne durch eine neue Raytracing-Einheit (RTUv2) in jedem Kern.
In Raytracing-Benchmarks erreicht die Mali-G1 Ultra bis zu doppelt so hohe Ergebnisse wie ihr Vorgänger. Auch KI-Aufgaben erledigt sie schneller. Den größten Sprung sieht ARM in diesem Bereich bei der Spracherkennung, hier gibt der Hersteller einen Zuwachs von 104 Prozent gegenüber der Immortalis-G925 an.
Erster Chip von Mediatek?
Erste Chips mit den neuen Kernen werden noch in diesem Jahr erwartet. Bevorzugter Partner für ARM im High-End-Segment war zuletzt Mediatek. Die Vorstellung des neuen Dimensity 9500, dem Nachfolger des Dimensity 9400+, könnte in den kommenden Wochen stattfinden. Von Xiaomi sind zudem neue SoCs der XRing-Produktlinie zu erwarten. Auch von Qualcomm stehen neue Snapdragons ins Haus, die verwenden allerdings zumindest in der Oberklasse selbst entwickelte Rechenkerne statt der ARM-Designs.
Bei den diesjährigen ARM Tech Days ging es ausschließlich um die Lumex-Plattform. Unter dem Namen Niva arbeitet ARM erstmals an einem explizit für PCs konzipierten Kerndesign. Hierzu schwieg das Unternehmen auf der Veranstaltung, mehr zu Niva will ARM später verkünden. Auch die Frage, ob die C1-Kerne auch in Niva zum Einsatz kommen, bleibt daher zunächst unbeantwortet.
Hinweis: ARM hat die Reisekosten und Unterbringung des Autors für das Event übernommen.
(sht)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 3 Wochen
Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 7 Tagen
Entwicklung & Codevor 7 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events















