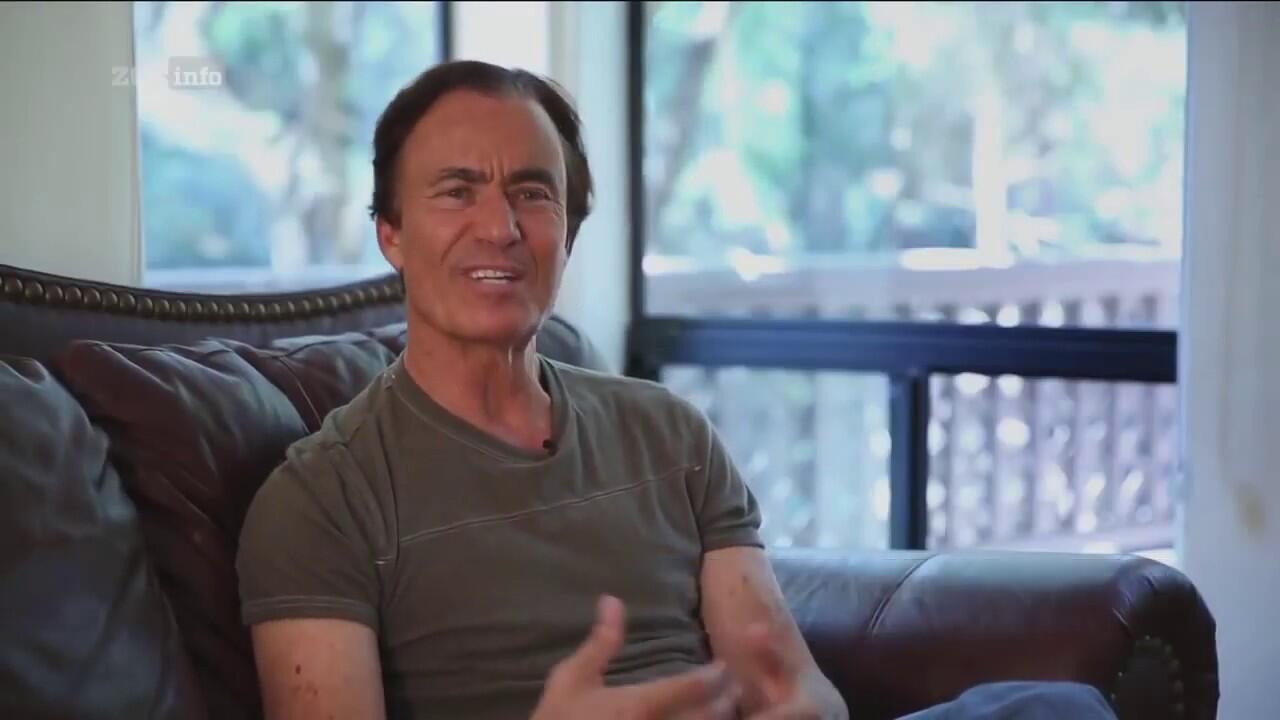Apps & Mobile Entwicklung
Amiga 1000: Vor 40 Jahren brach das Zeitalter der 16 Bit endgültig an
Mit dem Amiga 1000 stellte Commodore vor genau 40 Jahren einen Rechner vor, dessen Bedeutung für die Entwicklung moderner Computertechnik vielfach unterschätzt blieb, was nicht zuletzt auch daran lag, dass der später sehr erfolgreiche Amiga 500 nie wirklich aus dem Schatten des legendären Commodore C64 heraustreten konnte.
Computer für den berühmten Jedermann
Die Geschichte des Amiga, genauer gesagt des ersten Modells, des Amiga 1000, das zunächst nur aus einem Motherboard mit dem Code-Namen „Lorraine“ bestand, reicht zurück bis in die frühen 1980er-Jahre. Damals formierte sich eine Gruppe technikbegeisterter Computer-Entwickler mit dem Ziel, ein leistungsstarkes, aber dennoch erschwingliches System zu schaffen, das sowohl für den Heimgebrauch als auch im Büroalltag überzeugen konnte. Im Zentrum der Gruppe stand der Chipdesigner Jay Miner, ein Ausnahmetalent, der bereits maßgeblich an der Entwicklung der Spielkonsole Atari VCS 2600 sowie an den Computern Atari 400 und 800 beteiligt gewesen war.
Hoch gesteckte Ziele in Sachen Ausstattung
Der Amiga war von Beginn an darauf ausgelegt, echtes Multitasking zu ermöglichen, und sollte standardmäßig mit Tastatur, Diskettenlaufwerk, der Möglichkeit für eine Speichererweiterung sowie diversen Schnittstellen für externe Geräte ausgestattet werden. Herzstück des Systems war der Motorola 68000, einer der leistungsfähigsten Prozessoren seiner Zeit, der von mehreren eigens entwickelten Chips unterstützt wurde, welche unter anderem die Grafik- und Audioverarbeitung übernahmen.
Pakt mit dem Teufel
Da die Entwicklung zunehmend kostspieliger wurde, drohte das Projekt jedoch zeitweise zu scheitern. In dieser Phase konnte Atari als Kapitalgeber gewonnen werden, mit einem Darlehen über 500.000 US-Dollar wurde die Weiterentwicklung der Chips gesichert. Die Vereinbarung hatte jedoch einen entscheidenden Haken: Würde das Geld nicht bis zum 30. Juni 1984 zurückgezahlt, sollten die entwickelten Chips und ihre Technologie an Atari übergehen. Um dies zu verhindern, wurde Amiga an Commodore verkauft, wodurch die fällige Summe erst kurz vor Ablauf der 24-Stunden-Frist beglichen werden konnte.

Zunächst geringes Interesse
Der Amiga 1000 wurde am 23. Juli 1985 in den USA vorgestellt, während die Präsentation in Deutschland am 21. Mai 1986 stattfand – moderiert von Frank Elstner. Trotz seiner technischen Stärken blieb das Interesse gering, was unter anderem auf fehlendes Marketing und eine unklar definierte Zielgruppe zurückgeführt werden kann. Der Einstiegspreis von 5.900 DM (inflationsbereinigt etwa heute 6.500 Euro) dürfte ebenfalls eine Hürde dargestellt haben. Zudem versuchte Commodore 1985 gleichzeitig mit dem C128 den Nachfolger des C64 zu etablieren, was jedoch ebenfalls scheiterte. Mit der Fokussierung auf mehrere Modelle gleichzeitig agierte das Unternehmen über seinen Möglichkeiten und so schaffte es dieses nicht, zum Weihnachtsgeschäft 1985 ausreichende Stückzahlen des Amiga 1000 zu produzieren.
Aufteilung als Erfolg
Erst mit der Aufteilung der Produktlinie im Jahr 1987 in den für Heimanwender gedachten Amiga 500 und das für den professionellen Einsatz konzipierte Modell Amiga 2000 – letzteres entwickelt von der Commodore-Niederlassung in Braunschweig – konnte Commodore Erfolge verbuchen. Beide Modelle wurden zunächst zu Preisen von etwas über 1.000 DM beziehungsweise rund 3.000 DM angeboten. Besonders der Amiga 500 entwickelte sich zu einem Verkaufsschlager, nicht zuletzt durch die für diese Zeit außergewöhnlichen Spielefähigkeiten. Diese waren unter anderem den Chips Agnus als Adressgenerator, Denise (ursprünglich Daphne) für Grafik, Paula für Audio und Peripherie sowie Gary, der exklusiv im Amiga 500 verbaut war, zu verdanken. Denise ermöglichte eine Auflösung von bis zu 640 × 512 Pixel – zwar im Zeilensprungverfahren und dadurch mit starkem Flackern verbunden, aber immerhin mit bis zu 4.096 darstellbaren Farben. Eine derartige grafische Leistungsfähigkeit war in dieser Preisklasse bis dahin unerreicht.
Weltweit sollen bis zum Konkurs von Commodore im Jahr 1994 rund sechs Millionen Geräte verkauft worden sein – davon etwa eine Million in Deutschland und 1,5 Millionen in Großbritannien. Dennoch blieb der Amiga 500 deutlich hinter dem C64 zurück, der es während seiner elfjährigen Produktionszeit auf über 22 Millionen verkaufte Einheiten brachte.

Bis heute lebendig
Der Commodore Amiga hat bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt und lebt sowohl in der Popkultur als auch in Form zahlreicher Emulationen weiter, zuletzt etwa mit dem TheA500 Mini (Test) von Retro Games. Eine neue, größere Variante mit echter Tastatur war zuletzt ebenfalls geplant, doch kommt deren Entwicklung aufgrund von Schwierigkeiten bei den Lizenzverhandlungen rund um das Betriebssystem aktuell nicht voran.
Wer mehr über die Geschichte des Commodore Amiga erfahren möchte, dem sei die sehenswerte Dokumentation „Die Amiga-Story“ empfohlen, die auf YouTube und gelegentlich auch in der ZDF-Mediathek verfügbar ist und deutlich umfassendere Einblicke in die Entstehung des Systems bietet, als es dieser kurze Überblick leisten kann.
Apps & Mobile Entwicklung
A19 (Pro), N1 und C1X: Diese neuen Chips treiben iPhone 17, 17 Pro und Air an

Apple iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air werden von neuen Prozessoren der A19-Serie angetrieben, setzen aber auch an anderer Stelle auf „Apple Silicon“ – also Chips aus Apples eigenen Laboren. Neben der 2. Generation Modem (Apple C1X) hat Apple am Abend auch einen Netzwerk-Chip für iPhone (Apple N1) vorgestellt.
Apple A19 und A19 Pro: die neuen SoCs
Die neuen A19-Chips werden weiterhin in 3 nm bei TSMC gefertigt, Apple spricht von „der 3. Generation 3-nm-Fertigung“. Die 2-nm-Fertigung von TSMC ist dieses Jahr noch nicht so weit. Sie hatte im Frühling den ersten Tape-Out mit Chips von AMD gefeiert.
Der neue Apple A19 für das iPhone 17 belässt es bei einer 6-Core-CPU (2 Performance- und 4 Efficiency-Kerne) und 5 GPU-Cores, der Apple A19 Pro kommt im iPhone Air auf dieselbe Konfiguration, im iPhone 17 Pro sind hingegen 6 GPU-Cores aktiv. Informationen zum Cache der Kerne liegen noch nicht vor, hier dürfte sich mit Blick auf die Performance-Kerne der Vorgänger aber ebenfalls ein Unterschied zeigen.
Sowohl im A19 als auch im A19 Pro finden sich AI-Coprozessoren nicht mehr nur als separater Funktionsblock im Chip (weiterhin 16 Kerne), sondern sind auch integraler Bestandteil der GPU-Kerne. Ebenfalls überarbeitet wurden die Cache-Architektur der GPU. Sie nutzt die Dynamic-Caching-Architektur der 2. Generation, die Apple mit dem M3 eingeführt hatte.

Zur Stunde sind die detailliertere Informationen auf der bereits aktualisierten Apple Webseite, die die Unterschiede zwischen A19 und A19 Pro herausarbeiten, noch rar.
Apple C1X: die zweite Generation Mobilfunkmodem
Neue A-SoCs waren erwartet worden, eine zweite Generation Mobilfunkmodem hingegen noch nicht. Doch nur sechs Monate nach dem ersten Einsatz im iPhone 16e (Test) hat Apple mit dem Apple C1X bereits eine Überarbeitung vorgestellt, die doppelt so hohe Datenraten bei weniger Verbrauch ermöglichen soll.
Die kommt allerdings nur im iPhone Air zum Einsatz, iPhone 17 und iPhone 17 Pro dürften noch auf Modems vom Qualcomm setzen.

Apple N1: WiFi, Bluetooth und Thread
Eine Premiere feiert der Apple N1: Apples erster eigener WiFi-, Bluetooth- und Thread-Chip für iPhone. Er beherrscht WiFi 7 und Bluetooth 6.0 und soll im Vergleich zu Drittanbieter-Lösungen besonders effizient sein. Alle drei neuen iPhone nutzen diesen Chip.

Apps & Mobile Entwicklung
Mercedes GLC EQ 2026: Dieses Elektro-SUV sprengt alle Grenzen!

Entdeckt den neuen Mercedes GLC 2026: vollelektrisches Premium-SUV mit bis zu 713 km Reichweite, 800-Volt-Schnellladen & MBUX Hyperscreen.[mehr]
Apps & Mobile Entwicklung
Neue MLC-Inference-Benchmarks: Nvidia GB300 vaporisiert Rekorde, AMDs MI355X debütiert

Inferenz ist das große Thema bei AI, neben Nvidias GB300 ist hier auch AMD mit Instinct MI355X erstmals bei MLCommons vertreten. Während Nvidia seine eigenen Rekorde, die erst im letzten halben Jahr von GB200 aufgestellt wurden, vaporisiert, zeigt auch AMDs Wachstumskurve deutlich nach oben. Auch Intel liefert Ergebnisse.
Intel mit Arc Pro und Xeon 6
Die neue Intel Arc Pro B60 48GB Turbo hat es nämlich auch in die Liste geschafft. Sie soll eine Alternative für kleinere Projekte sein, dafür aber eben auch über den Preis punkten. Vier dieser Karten bieten 192 GByte VRAM für ein Workstation-System, damit lassen sich laut Intel Llama2-70b-Modelle bei verschiedenen Nutzern ausführen. Das soll laut Intels Pressemeldung dazu führen, dass im Bereich Performance pro Dollar gegenüber der RTX Pro 6000 oder L40S ein viel besseres Gesamtpaket verkauft wird.
Parallel dazu verweist Intel erneut darauf, dass man das einzige Unternehmen ist, welches auch Inference-Benchmarks von CPUs einreicht. Die neuen Xeon 6 sind hierbei im Schnitt von fünf Anwendungen 1,9 Mal schneller als die fünfte Generation.
AMD nun mit drei Generationen Instinct vertreten
Von AMD werden keine Epyc-Ergebnisse übermittelt, hier liegt der Fokus auf Instinct MI325X und den neuen 355X mit 1.400 Watt, aber auch der weiteren Optimierung auf MI300X. Nach viel Kritik in der Vergangenheit hat es AMD nun auch geschafft, Partner wie Asus, Dell, GigaComputing, MangoBoost, MiTAC, Quanta Cloud Technology, Supermicro und Vultr zu Einreichungen von Ergebnissen mit AMD-Hardware zu bewegen.

Dies soll gleichzeitig Vertrauen schaffen und der Kundschaft zeigen, dass man sich auf AMD verlassen kann. Denn Benchmarks bei MLCommons einzureichen, ist kein Selbstläufer, jede der teilnehmenden Parteien kann sich die Ergebnisse vor der Veröffentlichung ansehen und Fragen dazu stellen, erst wenn Probleme ausgeräumt sind, werden die Ergebnisse auch veröffentlicht.
Nvidia spielt noch in einer anderen Liga
In der Oberklasse ist auch Nvidia mit seiner 1.400-Watt-Lösung GB300 erstmals am Start. Das ist nur wenige Monate nach den ersten Tests mit GB200 und zeigt, wie schnell sich der Markt doch zu Blackwell Ultra hin entwickelt hat. Der neue Datentyp FP4 ist die neue Nvidia-Bastion, nur MI355X kann dies auch, AMD vermarktet dort aber lieber FP6.

Nvidias Stärke ist weiterhin, dass auch 16 Partner mit ihrer Hardware Ergebnisse zeigen, die nahezu stets auf gleicher Höhe zu Nvidias Werten liegen. Da die Serversysteme bei neuen Nvidia-Lösungen aber die gleiche Basis haben und mitunter sogar aus den gleichen Fabs kommen, liegt dies schnell auf der Hand. Vor allem die Möglichkeiten, die Blackwell-Systeme bieten, sollen nun weiter ausgeschöpft werden, erklärt Nvidia in einem Blog-Beitrag.

Wie sich die Kontrahenten in ML Commons schlagen, gibt die Pressemeldung preis.
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Woche
UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Social Mediavor 3 Wochen
Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 6 Tagen
Entwicklung & Codevor 6 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events