Datenschutz & Sicherheit
Damit müssen Menschen auf der Pride in Budapest rechnen
Dieser Plan könnte gründlich schiefgegangen sein. Mitte März beschloss das ungarische Parlament ein queerfeindliches Gesetz, das Veranstaltungen faktisch verbietet, die ein Leben jenseits von Heterosexualität und Cisgeschlechtlichkeit zeigen. Seitdem wächst die Solidarität mit der queeren Community. 15 EU-Staaten haben die EU-Kommission zu einem „schnellen Handeln“ aufgefordert. Aus ganz Europa werden Teilnehmer*innen für die Pride-Parade in Budapest erwartet – die trotz aller Hindernisse Ende Juni stattfinden soll.
„Das wird mit Sicherheit die bisher größte Pride-Parade in Ungarn werden“, sagte Viktória Radványi, Vorsitzende von Pride Budapest, bei der Eröffnung der Feierlichkeiten am vergangenen Wochenende.
Die Regierung rechtfertigt das Verbot mit der Behauptung, solche Veranstaltungen könnten die „körperliche, geistige und moralische Entwicklung“ von Kindern gefährden. Es ist das beliebte Muster autoritärer Regime: eine bedrohte, queere Minderheit wird zur angeblichen Gefahr erklärt; Homo- und Transfeindlichkeit werden zur Waffe gegen Demokratie und Menschenrechte.
Nach diesem Drehbuch entstand bereits das ungarische Kinderschutzgesetz von 2021, das Minderjährigen jede Information über Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit vorenthält. Werbung, Bücher, Filme zu diesen Themen sind seither für unter 18-Jährige tabu. Seit März gilt das Verbot nun auch für öffentliche Veranstaltungen wie die Pride, die diese Vielfalt feiern.
Demonstrieren als Ordnungswidrigkeit
Nicht nur die Veranstalter*innen, auch Teilnehmer*innen der Demonstration können auf dieser Grundlage bestraft werden. Das Verbot sieht vor, dass die Polizei sie per Gesichtserkennung identifizieren und mit Bußgeldern bis zu 500 Euro belegen darf.
Es steht viel auf dem Spiel im EU-Land Ungarn. Es geht um Menschenrechte aus der EU-Grundrechtecharta: Nichtdiskriminierung, Versammlungsfreiheit, freie Meinungsäußerung. Das wirft die Frage auf, wer es noch wagt, friedlich zu protestieren, wenn dafür biometrische Identifikation und Geldstrafe droht.
Was erwartet also die Teilnehmer*innen, die sich für die Pride angekündigt haben? Welche Rechte und Pflichten haben sie auf der Demonstration? Und was ist das für ein System zur Gesichtserkennung, mit dem Orbáns Regierung zu abschrecken will? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen.
1. Wird die Pride überhaupt in Budapest stattfinden können?
Noch kämpfen die Veranstalter*innen darum, wie in vergangenen Jahren durch die Budapester Innenstadt ziehen zu dürfen, und zwar entlang der Prachtstraße Andrássy ut. Die Polizei hat die Route nicht genehmigt, mit der Begründung, es könne auf der Demonstration zu verbotenen Handlungen kommen. Demnach sei es nicht auszuschließen, dass auch Minderjährige teilnehmen; außerdem drohten auch „passive Opfer“ unter den Zuschauer*innen, so die Begründung. Stattdessen soll die Demonstration auf einer abgelegenen Pferderennbahn am Stadtrand stattfinden. Das wollen Veranstalter*innen nicht hinnehmen.
Am Montag schaltete sich dann Budapests liberaler Bürgermeister ein: Die Stadt werde die Pride als kommunales Fest für Liebe und Freiheit ausrichten, gemeinsam mit den Veranstalter*innen. Dafür brauche es keine Genehmigung der Polizei.
2. Warum darf die ungarische Polizei Gesichtserkennung bei der Pride einsetzen?
Bis vor Kurzem durfte die ungarische Polizei Gesichtserkennung nur bei Straftaten oder Delikten nutzen, die mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden können. Mit der im März verabschiedeten Gesetzesänderung gilt das nicht mehr. Nun darf die Polizei die Technologie bei allen Arten von Gesetzesverstößen anwenden. Das heißt, sie kann jetzt auch Personen damit identifizieren, die eine geringfügige Ordnungswidrigkeiten begehen – etwa bei Rot über die Straße gehen oder bei der verbotenen Pride-Parade mitlaufen.
3. Wie funktioniert die biometrische Gesichtserkennung in Ungarn?
Ermittlungsbehörden arbeiten für die Identifikation unbekannter Personen mit dem Ungarischen Institut für Forensische Wissenschaften zusammen, eine dem Innenministerium unterstellte Behörde. Das Institut betreibt eine Datenbank zur biometrischen Gesichtserkennung, in die Bilder aus verschiedenen staatlichen Quellen fließen.
Gespeichert werden nicht die Bilder selbst, sondern ihre biometrische Entsprechung. Dazu erfasst das Institut die einzigartigen Merkmale der Gesichter, etwa die Abstände von Augen, Nase und Kinn. Das Ergebnis wird in Form einer mathematischen Repräsentation gespeichert.
Bekommt das Institut über eine Schnittstelle von der Polizei ein Bild zur Identifizierung übermittelt, kommt es zu einem automatisierten Abgleich mit der Datenbank. Die Polizei bekommt daraufhin die Treffer mit der höchsten Übereinstimmung angezeigt.
4. Wer ist in Ungarns Gesichter-Datenbank gespeichert?
Gesichter-Suchmaschinen für die Strafverfolgung wie Clearview AI durchsuchen des gesamte öffentliche Internet und speichern die biometrischen Profile der dort gefundenen Gesichter.
Im Gegensatz dazu hat das Forensische Institut in seiner Datenbank nur biometrische Daten aus staatlichen ungarischen Quellen: Personalausweise oder Führerscheine, Aufnahmen aus dem Melderegister und Bilder aus Polizeidatenbanken, die bei der Strafverfolgung, Einreise oder Flucht erstellt wurden.
Gesichtserkennung in Ungarn verstößt gegen EU-Gesetze
5. Womit müssen Pride-Protestierende aus dem Ausland rechnen?
Bürger*innen anderer Staaten tauchen in der Datenbank der ungarischen Behörden nicht auf, solange sie keine Aufenthaltsgenehmigung oder andere ungarische Dokumente besitzen. Das erklärt die NGO Hungarian Helsinki Committee, sie sich mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn befasst. Laut ihrer Aussage kann die Polizei diese Personen daher nicht per Gesichtserkennung identifizieren.
Demonstrant*innen können jedoch sofort vor Ort mit einer Geldstrafe belegt werden. Das Hungarian Helsinki Committee weist darauf hin, dass Teilnehmer*innen das Recht haben, die sofortige Geldstrafe abzulehnen und nichts unterschreiben müssen. In diesem Fall leitet die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und die Betroffenen werden per Post über die Geldstrafe informiert. Sie können dann darauf bestehen, von der Polizei angehört zu werden und Widerspruch vor Gericht einlegen. Das Gericht kann die Rechtmäßigkeit der Strafe überprüfen, diese aufheben oder reduzieren.
6. Wie schnell kann die ungarische Polizei Protestierende identifizieren?
Schneller als etwa einen Bankräuber oder Steuerflüchtigen. Im Fall einer Straftat ist vorgesehen, dass zwei Fachleute des Forensischen Institutes die Ergebnisse des automatisierten Abgleichs unabhängig voneinander bestätigen müssen – erst damit gilt das Ergebnis als Treffer. Geht es dagegen nur um ein geringfügiges Vergehen wie die Teilnahme an der Pride, entfällt diese Kontrolle.
Die Polizei hat nun eine direkte Schnittstelle zur Datenbank und kann darüber einen automatisierten Abgleich beantragen. Die Hungarian Civil Liberties Union (HCLU), die sich für den Schutz von Grundrechten in Ungarn einsetzt, spricht von einer Identifikation in „Echtzeit oder annähernder Echtzeit“.
Wie schnell der Prozess genau abläuft, weiß allerdings auch die HCLU nicht. Das Forensische Institut hat auf ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz nur ausweichend geantwortet: Der automatisierte Abgleich falle nicht in den Zuständigkeitsbereich des Institutes, heißt es dazu.
Laut der neuen KI-Verordnung der EU wäre eine Identifikation in Echtzeit nur bei Verdacht auf eine Straftat erlaubt; in keinem Fall dürfte Ungarn sie für die Ermittlung der Identität bei einer Ordnungswidrigkeit einsetzen.
7. Wäre die Gesichtserkennung nicht von den Menschenmassen überfordert?
Wahrscheinlich ja. „Das System ist nicht für die Massenüberwachung von Zehntausenden von Menschen konzipiert“, sagt der Jurist Ádám Remport, der sich für die HCLU mit dem Fall beschäftigt.
Das liegt an den Verfahren: Um eine Person identifizieren zu lassen, muss die Polizei händisch einen Fall im System anlegen. Bei mehreren Zehntausend Teilnehmenden würde das sehr viel Zeit erfordern. Zwar könnten auch mehrere Personen im System zu einem Fall zusammengezogen werden, rechtlich wäre das kein Problem. Aber ob das auch in einer Größenordnung von mehreren Zehntausend Personen funktioniert, da ist sich auch Ádám Remport nicht sicher. Bisher sei so ein Fall nicht vorgekommen.
Sollte die Polizei die zu identifizierenden Personen hingegen einzeln im System bearbeiten müssen, würde das sehr lange dauern, sagt Remport. Und: „Wenn die Behörden versuchen würden, alle Teilnehmer einer so großen Demonstration zu identifizieren, könnte das möglicherweise die Gesichtserkennungssysteme Ungarns überlasten.“
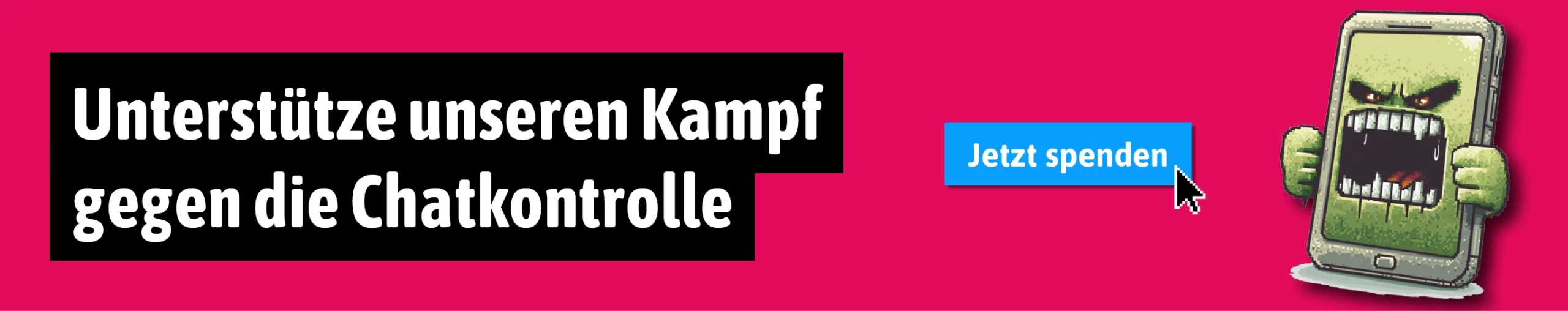
Der Jurist sieht noch ein weiteres Nadelöhr im System: Verdächtige hätten das Recht auf eine polizeiliche Anhörung, wenn sie wegen einer Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe belegt werden. Wenn die Polizei das Verfahren nicht einstellt oder die Geldstrafe nicht herabsetzt, können sie sich an ein Gericht wenden. „Bei einem massiven Einsatz der Gesichtserkennung könnte die schiere Menge der Verfahren die Polizei und die Justiz überfordern.“
Eine Entwarnung ist das jedoch nicht: Teilnehmer*innen müssten auch Wochen später noch damit rechnen, verfolgt zu werden. Aktuell dürfen Aufnahmen aus Überwachungskameras in Ungarn 30 Tage lang gespeichert werden.
8. Wie gefährlich sind falsche Treffer bei der Gesichtserkennung?
Mit dem Wegfall der menschlichen Kontrollen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass falsche Treffer bei der Polizei landen, warnt Ádám Remport. Das heißt, die Polizei verdächtigt Personen, die nicht in der Aufnahme zu sehen waren. „Rechtlich gibt es so gut wie keine Sicherheitsvorkehrungen“, so Remport. Einzelne Beamt*innen werden dann entscheiden müssen, ob ein Treffer tatsächlich die gesuchte Person zeigt.
„Bei Tausenden solcher Anfragen, wird der Druck groß sein, so schnell wie möglich zu arbeiten“, erklärt Remport. Auch würden viele ausländische Teilnehmende auf der Demonstration sein, die nicht in der ungarischen Datenbank erfasst sind. Das System könne für sie aber womöglich ähnliche Gesichter in der Datenbank finden. So könne es zu vielen falschen Entscheidungen kommen.
Hier werden Protestierende mit Gesichtserkennung verfolgt
9. Welche Software nutzt Ungarn zur Gesichtserkennung?
Bislang ist nicht bekannt, welche Software das Forensische Institut und damit die Polizei für die Gesichtserkennung einsetzt. Auf eine Frage des HCLU nach Marke und Typ antwortete das Institut, es nutze die verwendete Software nur als Klient und machte darüber hinaus keine Angaben.
Mehrere Tech-Konzerne und Unternehmen bieten Gesichtserkennungssoftware als Dienstleistung für Strafverfolgungsbehörden an, darunter US-Konzerne wie Microsoft und Amazon, aber auch chinesische Unternehmen für Überwachungstechnologien wie Dahua.
10. Wo wird der öffentliche Raum in Budapest bereits per Kamera überwacht?
Für die Identifikation von Teilnehmer*innen kann die Polizei auf Bilder aus Tausenden Überwachungskameras zurückgreifen. Laut einer Datenvisualisierung des Investigativmediums Atlo waren bereits 2019 mindestens 2.500 Kameras im Budapester Stadtgebiet installiert, betrieben von der Polizei, den Verkehrsbetrieben und den einzelnen Bezirken. Die höchste Überwachungsdichte haben dabei die Bezirke der Innenstadt – und damit auch die von den Veranstalter*innen gewünschte Route der Pride, die entlang der Prachtstraße Andrássy út führen soll.
Zusätzlich zu den fest installierten Kameras kann die Polizei außerdem mobile Kameras einsetzen, um die Demonstration zu filmen – und tut das auch regelmäßig, schreibt etwa das Hungarian Helsinki Committee.
11. Wie können sich Pride-Protestierende vor Gesichtserkennung schützen?
Das ist schwer zu sagen, weil nicht bekannt ist, welches System die ungarische Polizei zur Erkennung einsetzt. Leitfäden der Polizei zur Beschaffenheit der einzureichenden Bilder deuten aber darauf hin, dass maskierte Gesichter vom System nicht oder schlechter erkannt werden.
Das Hungarian Helsinki Committee rät allerdings davon ab, eine Maske zu tragen, sei es auch nicht eine medizinische. Denn auch in Ungarn gilt ein Vermummungsverbot auf Demonstrationen: Wer eine Maske trägt, begeht damit eine Straftat – während der Besuch der Pride nur eine Ordnungswidrigkeit wäre. Auch könnte die Maskierung eher dazu führen, dass man von der Polizei aufgefordert wird, sich auszuweisen. Und ja: Demonstrant*innen müssen einen Ausweis bei sich tragen und auf Aufforderung vorzeigen können.
12. Müssen Protestierende in Budapest mit Festnahmen oder Polizeigewalt rechnen?
Wer sich in Ungarn auf Aufforderung der Polizei nicht ausweist und sich anderen Anweisungen widersetzt, kann auch mit auf die Wache genommen und dort bis zu 12 Stunden lang festgehalten werden. Auch physische Gewalt darf die Polizei bei Widerstand einsetzen. Das gilt für die gesamte Demonstration, sollte diese aufgelöst werden und nicht freiwillig den Platz verlassen. Wie man sich in solche riskanten Situationen verhalten sollte, dazu informiert das Hungarian Helsinki Committee in einem ausführlichen FAQ. Die NGO hat zudem angekündigt, Betroffene rechtlich zu unterstützen.
Datenschutz & Sicherheit
Polizei hackt alle fünf Tage mit Staatstrojanern
Polizei und Ermittlungsbehörden durften 2023 in Deutschland 130 Mal IT-Geräte mit Staatstrojanern hacken und haben es 68 Mal getan. Das hat das Bundesjustizamt bekannt gegeben. Damit hat sich die Anzahl der Trojaner-Einsätze in zwei Jahren mehr als verdoppelt.
Das Bundesjustizamt veröffentlicht jedes Jahr Statistiken zur Telekommunikationsüberwachung. Wir bereiten sie regelmäßig auf.
Anlass für den Einsatz von Staatstrojanern waren wie immer vor allem Drogen, so das Justizamt in der Pressemitteilung: „Wie in den vergangenen Jahren begründete vor allem der Verdacht einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz die Überwachungsmaßnahmen.“
62 kleine Trojaner
Die „Quellen-Telekommunikationsüberwachung“ hackt Geräte, um laufende Kommunikation auszuleiten. Dieser „kleine Staatstrojaner“ wurde 104 Mal angeordnet. In 62 Fällen wurde der Einsatz „tatsächlich durchgeführt“. Im Vorjahr waren es 49 Einsätze.
Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen, dort haben Ermittler 23 Mal gehackt. Danach folgt Niedersachsen, dort kamen kleine Staatstrojaner zehn Mal zum Einsatz. Bayern und Sachsen haben je sieben Mal Geräte infiziert. Hamburg, Hessen und der Generalbundesanwalt hackten drei Geräte. Sachsen-Anhalt hat zweimal die Quellen-TKÜ eingesetzt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen je einmal.
Damit hackt mittlerweile die Mehrzahl der Bundesländer. Nur fünf Länder haben keine Quellen-TKÜ eingesetzt: Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland.
Die Justizstatistik enthält leider keine Angaben, bei welchen Straftaten der kleine Staatstrojaner eingesetzt wird. Das Bundesjustizamt sagt, dass „vor allem“ Drogendelikte Anlass für Überwachung sind.
Sechs große Trojaner
Die „Online-Durchsuchung“ hackt Geräte, um sämtliche Daten auszuleiten. Dieser „große Staatstrojaner“ wurde 26 Mal angeordnet. In sechs Fällen wurde der Einsatz „tatsächlich durchgeführt“. Im Vorjahr waren es vier Einsätze.
Der Generalbundesanwalt hat 19 Anordnungen bekommen, aber nur zweimal gehackt. Anlass waren kriminelle oder terroristische Vereinigungen. Das könnten Rechtsterroristen wie die Patriotische Union oder Klimaaktivisten wie die Letzte Generation sein.
Bayern hat zweimal gehackt, wegen krimineller Vereinigungen oder Mord. Baden-Württemberg hackte einmal, wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung bzw. kinderpornografischer Inhalte. Hessen hackte einmal, wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Hamburg wollte einmal hacken, wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit, war aber nicht erfolgreich.
Für und gegen Sicherheit
Politisch werden Staatstrojaner meist mit Terrorismus, Mord und Totschlag oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begründet. Spitzenreiter sind jedoch auch weiterhin Drogendelikte. Damit verhindert der Staat, dass Sicherheitslücken geschlossen werden, um ein paar Drogen-Dealer zu bekämpfen.
Die Polizeibehörden besitzen mehrere Staatstrojaner, die sie einsetzen können. Das BKA hat selbst einen Trojaner Remote Communication Interception Software programmiert. Seit 2013 hat das BKA den Trojaner FinSpy von FinFisher. Seit 2019 hat und nutzt das BKA auch Pegasus von NSO. Welche weiteren Trojaner Polizei und Geheimdienste besitzen, will keine Bundesregierung öffentlich sagen.
Polizei hackt immer öfter
Erst seit fünf Jahren gibt es offizielle Statistiken, wie oft die deutsche Polizei Staatstrojaner einsetzt. Seitdem steigen die Zahlen Jahr für Jahr.
Die Ampel-Regierung wollte die Eingriffsschwellen für Staatstrojaner hochsetzen, hat das aber nicht umgesetzt. Die aktuelle Bundesregierung will den Einsatz von Staatstrojanern ausweiten. Die Bundespolizei soll Staatstrojaner gegen Personen einsetzen, die noch gar keine Straftat begangen haben.
Datenschutz & Sicherheit
Sonicwall untersucht mögliche Attacken auf Firewalls
Das IT-Unternehmen Sonicwall untersucht derzeit mögliche Attacken auf seine Firewalls der Gen-7-Serie. Davor warnen mehrere Sicherheitsforscher unabhängig voneinander. Auch intern wurden eigenen Angaben zufolge Unregelmäßigkeiten dokumentiert. Möglicherweise nutzen Angreifer derzeit eine Zero-Day-Sicherheitslücke aus. Dabei handelt es sich um eine Schwachstelle, für die es noch kein Sicherheitsupdate gibt.
Hintergründe
Nun nimmt Sonicwall zu den Berichten der Sicherheitsforscher von unter anderem Huntress Stellung. Bei den möglichen Attacken sollen Angreifer Gen-7-Firewalls mit aktivierter SSL-VPN-Funktion im Visier haben.
Die Sicherheitsforscher von Huntress geben in ihrem Bericht an, dass Angreifer durch das Ausnutzen einer Zero-Day-Lücke die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) umgehen und so Ransomware auf Systeme schieben. Sie berichten, dass Angreifer nach erfolgreichen Attacken Domänencontroller übernehmen. Die Forscher empfehlen, den VPN-Service, der offensichtlich das Einfallstor ist, zu deaktivieren oder ihn nur für bestimmte IP-Adressen zugänglich zu machen.
Instanzen absichern
Auch wenn derzeit noch vieles unklar ist und Sonicwall davon noch nichts konkret bestätigt hat, empfiehlt auch das IT-Unternehmen den VPN-Service temporär zu deaktivieren oder Zugriff streng zu filtern. Außerdem sollten Kunden die Sicherheitsfeatures Botnet Protection, MFA und Geo-IP Filtering aktivieren. Zusätzlich sollten Admins ihnen unbekannte Accounts umgehend entfernen.
Sonicwall erläutert, mit den Sicherheitsforschern zusammenzuarbeiten und neue Erkenntnisse umgehend mit Kunden zu teilen. Außerdem versichern sie, im Falle einer Sicherheitslücke umgehend ein Update auszuliefern. Derzeit dauern die Untersuchungen noch an.
(des)
Datenschutz & Sicherheit
Helsing plant Drohnenbomber mit großer Reichweite
Das Rüstungs-Start-up Helsing entwickelt unbemannte Luftkampfsysteme, die Bomben von mehreren Hundert Kilo tragen können. Dies geht aus internen Dokumenten hervor, über die das Handelsblatt berichtet.
Nach der kürzlich bekannt gegebenen Übernahme des deutschen Flugzeugherstellers Grob Aircraft will das ursprünglich auf Software fokussierte Unternehmen das unbemannte Luftfahrzeug selbst bauen. Damit würde sich Helsing als Komplettanbieter für einen solchen Drohnenbomber positionieren, der mehrere Tonnen wiegen soll.
Die von Helsing als „streng geheim“ eingestuften Pläne vom Mai 2025 sehen dem Handelsblatt zufolge Drohnenflotten mit über 1.000 Kilometer Reichweite vor, die selbstständig aufklären und Missionsziele autonom umsetzen sollen. Die Langstreckendrohne könnte demnach Aufgaben klassischer Kampfjets übernehmen: Angriffe auf Bodenziele, Luftkämpfe, Aufklärung und elektronische Kampfführung.
Anwält*innen wollten Veröffentlichung stoppen
Helsing versuchte laut dem Handelsblatt die Berichterstattung zu verhindern. Ein „eiligst“ eingeschalteter Rechtsanwalt einer Wirtschaftskanzlei habe gewarnt, die Verbreitung würde „zu gravierenden und nicht wiedergutzumachenden Schäden führen“ – sowohl für Helsing als auch für „die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland“. Ein offizieller Geheimstatus liegt aber offenbar nicht vor, jedenfalls soll das Dokument keine Einstufung als Verschlusssache tragen.
Das erst vier Jahre alte Unternehmen Helsing hat bereits über eine Milliarde Euro Wagniskapital eingesammelt, zuletzt flossen im Juni – angeführt von Spotify-Gründer Daniel Ek – 600 Millionen Euro frisches Kapital. Damit positioniert sich Helsing aggressiv gegen etablierte Drohnen-Konkurrenten wie Rheinmetall und Airbus sowie kleinere Firmen wie Quantum Systems.
Mit dem Grob-Zukauf erhält Helsing auch Expertise für die Zertifizierung von Flugzeugen und kann dadurch wertvolle Zeit zur Beantragung einer solchen Lizenz sparen. In dem bayerischen Standort Tussenhausen im Unterallgäu, wo 275 Mitarbeiter*innen bisher kleine Trainingsflugzeuge bauten, könnten künftig die anvisierten autonomen Luftkampfsysteme entstehen.
Bedrohung für Airbus
Trotz seiner vergleichsweise frischen Gründung hat Helsing gute Kontakte zum deutschen Verteidigungsministerium. Helsings Co-Geschäftsführer Gundbert Scherf beriet die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Das Handelsblatt vermutet deshalb, dass der Konzern auf eine Direktvergabe ohne reguläres Wettbewerbsverfahren hofft. Das Verteidigungsministerium beantwortete Fragen der Zeitung dazu aber nicht.
Gefährlich ist die Offensive besonders für die Verteidigungssparte von Airbus. Noch vor einem Jahr hatte der Konzern mit Sitz in Bremen angekündigt, mit Helsing einen unbemannten „Loyal Wingman“ zu entwickeln – eine Kampfdrohne, die Kampfjets begleitet oder vorausfliegt und Bedrohungen am Boden oder in der Luft bekämpft. Mit dem Grob-Kauf liegt nahe, dass Helsing Airbus nicht mehr als Partner benötigt.
Helsing positioniert sich damit auch als Alternative zum stockenden „Future Combat Air System“ – dem von Deutschland und Frankreich geplanten Cyberkampfjet, der an Streitigkeiten zwischen Airbus und Dassault zu scheitern droht.
Das hochmoderne und atomwaffenfähige Kampfflugzeug der „sechsten Generation“ ist das ambitionierteste europäische Rüstungsprojekt der kommenden Jahrzehnte und soll ab 2040 serienreif sein. Insgesamt könnte die Entwicklung des FCAS rund 100 Milliarden Euro kosten.
Deutschland könnte Cyberkampfjet mit Großbritannien entwickeln
Jedoch will Frankreich Airbus ausbooten und fordert einen Anteil von 80 Prozent am Workshare für den „New Generation Fighter“. Diese französische Forderung würde die bisher vereinbarte gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen den Partnern aushebeln. Bislang war vereinbart, dass die französische Dassault Aviation und die deutsch-dominierte Airbus Defense die Entwicklung und Produktion paritätisch untereinander aufteilen, wobei Frankreich die Führung beim eigentlichen Kampfflugzeug übernehmen sollte.
Bislang reagierte Airbus zurückhaltend auf derartige Forderungen des Konkurrenten Dassault. In einem ungewöhnlichen Statement stellte der Chef von Airbus Defence and Space die gemeinsame Entwicklung FCAS kürzlich ebenfalls infrage. Eine Abkehr von einem milliardenschweren Rüstungsprojekt bedeutet dies aber nicht: Stattdessen könne sich Deutschland auch an einem ähnlichen Vorhaben mit Großbritannien beteiligen.
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 Online Marketing & SEOvor 2 Monaten
Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat
Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten
















