Datenschutz & Sicherheit
Degitalisierung: Bewusstsein
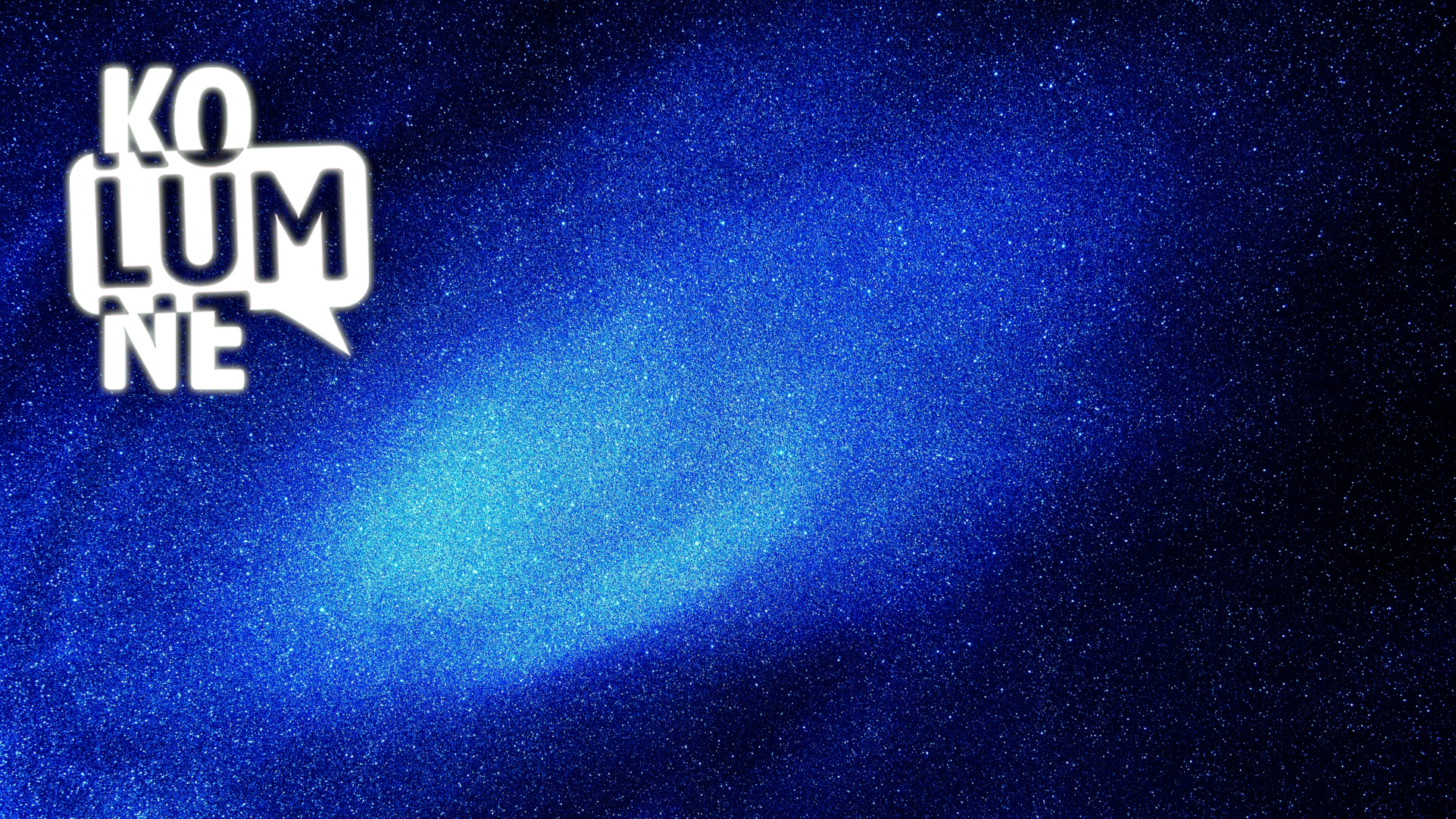
Diese Kolumne wird auch tief in die eher dunklen Sphären der menschlichen Psyche hinabsteigen. Es ist mir daher wichtig, darauf hinzuweisen, dass es für so dunkle Momente Hilfsangebote gibt.
Wenn es dir nicht gut geht oder Du selbst von Suizidgedanken betroffen bist, versuche, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund*innen oder Verwandte sein, es gibt aber auch Hilfsangebote. Bei der anonymen Telefonseelsorge findest Du rund um die Uhr Ansprechpartner.
Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 – www.telefonseelsorge.de
Telefonberatung für Kinder und Jugendliche: 116 111 – www.nummergegenkummer.de
Populistische Holzhammermethoden
In der letzten Zeit wird, speziell nach den Anschlägen oder Attacken von Hamburg, Magdeburg oder Aschaffenburg, nicht selten der Ruf lauter, Menschen mit psychischen Erkrankungen stärker zu überwachen. Es begann mit der Forderung Carsten Linnemanns (CDU) nach einem „Register für psychisch kranke Gewalttäter“ Anfang des Jahres. Dabei blieb es aber nicht.
Schleswig-Holsteins Justiz- und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) forderte etwa die Abschaffung des Widerspruchsrechts für die elektronische Patientenakte. Dabei fabulierte [€] sie im gleichen Atemzug von den Vorteilen für den Datenaustausch bei einer automatischen Befüllung der ePA, auch im Kontext psychischer Erkrankungen.
Ebenfalls aus Schleswig-Holstein, ebenfalls von der CDU, kam die Ansicht von Innenministerin Sütterlin-Waack, dass Datenschutz und die ärztliche Schweigepflicht die größten Probleme für eine bessere Vernetzung von Behörden zur Verhinderung von Gewalttaten durch psychisch Erkrankte seien.
In der Diskussion um die sehr eilige Reform des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in Hessen vergriffen sich dann Abgeordnete der CDU derart im Ton, dass die Kommentare irgendwann bei Vergleichen mit der Zeit des Nationalsozialismus und deren menschenverachtenden Praktiken endeten. Neben diesem Fehlgriff wurde in Hessen der zuständige Datenschutzbeauftragte für die geplante Gesetzesänderung gar nicht eingebunden.
In der Folge kommt nach dem Zurückrudern, das alles nicht so gemeint zu haben, oftmals der Wunsch, doch sachlich über das Thema zu sprechen. Bewusste Deeskalation des Contra nach bewusster Eskalation.
Sachlich
Hier also nun ein Versuch, das Thema so sachlich und sensibel wie möglich darzustellen:
Jeder Mensch kann in die Situation kommen, psychische Probleme zu bekommen, sei es wegen traumatischer Erlebnisse, wegen Krankheiten oder schlichtweg wegen ungünstiger Lebensumstände, für die diese Person selbst oft gar nichts kann. In den allermeisten Fällen haben psychisch Erkrankte im Vergleich zu anderen Personengruppen grundsätzlich kein erhöhtes Gewaltpotenzial. Manchmal richten psychisch Erkrankte die Gewalt im Stillen auch einzig gegen sich selbst.
Stille.
Für bestimmte Fälle, wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Gefahr für sich oder andere darstellen, gibt es Gesetze wie das hessische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das Zwangsmaßnahmen ermöglicht. Darin enthalten sind auch sehr harte Maßnahmen wie die „Aufhebung der Bewegungsfreiheit an allen Gliedmaßen“ oder Fixierungen, rechtlich nicht unstrittig, aber auch nach gewissen Anpassungen unter Auflagen zumindest möglich. In so einem extremen Fall, der solche Maßnahmen nötig macht, müssten Behandelnde auch ihre ärztliche Schweigepflicht brechen.
Symptompolitik
Der Änderungsvorschlag in Hessen möchte nun die Möglichkeit schaffen, Daten von psychisch Erkrankten unter den Behörden besser auszutauschen.
In Hessen soll nun nach der geplanten Änderung des Gesetzes – wohlgemerkt in Eilausfertigung – eine Meldung an die zuständige örtliche Ordnungsbehörde und Polizeibehörde von einer bevorstehenden Entlassung gemacht werden, sofern aus medizinischer Sicht die Sorge bestehe, „dass von der untergebrachten Person ohne ärztliche Weiterbehandlung eine Fremdgefährdung ausgehen könnte.“
Ähnliche Pläne gibt es auch in Niedersachsen und anderen Bundesländern. Hier passiert im Hinblick auf eine vermeintliche Problemlösung für die Sicherheitspolitik, in dem Fall die der inneren Sicherheit, in letzter Zeit oft Symptomatisches. Mit einem Datenaustausch zu den Sicherheitsbehörden wird die Gefahr vermeintlich gebannt, es sei ja Meldung gemacht.
Mediziner*innen, über verschiedene Fachbereiche hinweg, rufen uns hier aber einen gefährlichen Seiteneffekt ins Bewusstsein: Dass die anlasslose und ungehemmte Speicherung derart sensibler Informationen letzten Endes dazu führt, dass Diskriminierung und Stigmatisierung zunehmen.
In Folge werden sich Menschen, die bei psychischen Erkrankungen Hilfe benötigen, zukünftig weniger gut Behandelnden öffnen – weil neben dem gesellschaftlichen Stigma auch die Gefahr von Repression durch weitere Behörden zumindest plausibler wird.
Statt mehr Sicherheit zu schaffen, schaffen Vorschläge wie diese eine andere Art von Präventionsparadox: Sie verhindern Prävention aktiv, weil Menschen weniger Unterstützung bei psychischen Problemen suchen werden.
Verschärft wird das Problem dadurch, dass Gesetzesvorhaben in den Bundesländern auch die Schwelle für den Anlass solcher Meldungen an Polizeibehörden senken. In Hessen zählen nach dem Entwurf nun auch „eine mit dem Verlust der Selbstkontrolle einhergehende Abhängigkeit von Suchtstoffen“ zu den meldepflichtigen Erkrankungen.
Darüber hinaus durchforstet die hessische Polizei bereits schon jetzt Datenbanken nach Auffälligkeiten mit psychischen Erkrankungen. In Niedersachsen wünschen sich Beteiligte ebenfalls eine niedrigere Schwelle für den Informationsfluss.
Bei all diesen Vorschlägen scheint entweder das Bewusstsein für die Wirkung solcher Vorschläge auf die Erfolgschancen der Behandlung zu fehlen – oder es wird für den politischen Erfolg bewusst in Kauf genommen, weil es eigentlich nur um symbolische Symptompolitik geht.
Algorithmen als Rettung?
Angesichts der Erfahrungen aus Anschlägen wie in Magdeburg, bei denen der Täter und seine Vorgeschichte mit mehr als 100 Behördenkontakten mehr als bekannt waren, steht sowieso eine Frage im Raum: Können mehr Daten in Registern oder Daten aus Meldungen allein überhaupt etwas zur Besserung der Sicherheitslage beitragen?
In der politischen Diskussion wird daher oftmals schnell der Ruf nach weiteren technischen Möglichkeiten zur Erkennung von Gefährdungspotenzial laut. In Niedersachsen wird etwa in der Entwicklung des Gesetzes von „Algorithmen“ abgewogen, die bei der Menge von Daten unterstützen sollen.
Im Zeitalter der sogenannten Künstlichen Intelligenz liegt der Schluss nahe, dass Technik auch in der Psychoanalyse und Therapie helfen könnte. Aber auch hier fehlt das Bewusstsein für die Folgen eines Technikeinsatzes in sensiblen Bereichen.
Generell nimmt der KI-Einsatz auch in der medizinischen Disziplin der Psychologie zu, auch wenn dies vor ein paar Jahren noch eher als schwerlich realisierbar angesehen wurde. Sozial-medizinische oder psychotherapeutische Bereiche sind aber nach wie vor Gebiete, in denen der Einsatz von KI zumindest noch stärker abgewogen wird, er nimmt nach Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aber kontinuierlich zu.
Die Vorzüge der Künstlichen Intelligenz werden oftmals mit Teilaspekten der Behandlung von psychischen Krankheiten angepriesen; der Teilbereich der eigentlichen Diagnose etwa kann durch Chatbots verbessert werden.
Chatbots seien etwa auch gute Zuhörer mit unendlich viel Zeit und auch simulierte Empathie könne prinzipiell helfen, so eher die Sicht der Technologieanbieter. Mediziner*innen widersprechen dem sehr stark, die Patientensicherheit sei nicht gegeben. KI-Lösungen sind in ihrer Art oftmals nur sehr freundliche, devote Ja-Sager, die bestimmte psychische Erkrankungen sogar verstärken können. So etwa 2023 schon mal geschehen, als ein Chatbot einer Hilfsorganisation gegen Essstörungen ziemlich schnell wieder offline genommen werden musste, weil er schädigende Ratschläge gab.
Hinzu kommt, dass der Aufbau einer Vertrauensbeziehung wie in einer Therapie sehr schnell gefährlich werden kann: In den USA beging der 14-jährige Sewell Setzer aus Florida nach langanhaltender Konversation mit einem Chatbot Suizid. Auch hier fehlt im Umgang mit Technologien oftmals das Bewusstsein, dass es eben nicht nur ein Programm ist, was dort läuft. Sondern dass Menschen speziell mit Technologien, die wie KI sehr stark anthropomorphisiert oder vermenschlicht dargestellt werden, in eine Beziehung treten, die erhebliche negative Auswirkungen auf die echte Welt haben kann.
Es wird also keine schnellen, allumfassenden technischen und politischen Lösungen für psychische Krankheiten geben, vielmehr schafft Digitalisierung auch einige neue. Was hilft also wirklich?
Neben den oftmals wiederholten, aber nach wie vor nicht erfüllten Forderungen nach mehr Therapieplätzen und besserer Prävention, die inzwischen auch hinlänglich durch die mediale Landschaft gewandert sind, sollten wir uns am Ende dieser Kolumne zwei Aspekte in unser Bewusstsein rufen:
Ein Staat, der kein Bewusstsein für die abschreckende, diskriminierende und stigmatisierende Wirkung seiner Maßnahmen auf Menschen mit psychischen Erkrankungen hat, wird Menschen mit psychischen Erkrankungen nie helfen können.
Ein Programm, das selbst keinerlei Bewusstsein hat, wird Menschen nie dabei helfen können, ihr eigenes menschliches Bewusstsein für einen guten Umgang mit ihren individuellen psychischen Erkrankungen zu entwickeln.
Das sollten wir uns immer mal wieder bewusst machen.
Datenschutz & Sicherheit
Stealerium-Malware macht heimlich Webcam-Fotos für Erpressung
Eine frei verfügbare Malware namens Stealerium hält für Opfer eine besonders unangenehme Bedrohung bereit. Die Schadsoftware ist dazu in der Lage, nach einer Infektion zu erkennen, wenn der Nutzer im Browser pornografische Seiten aufruft. Wenn dies erkannt wird, fertigt die Software heimlich Screenshots und Webcam-Aufnahmen an, die per Internet verschickt werden. Damit können Cyberkriminelle an Aufnahmen gelangen, mit denen sie ihre Opfer später erpressen können.
Bereits seit Jahren kursierten Scam-E-Mails, die vorgeben, dass Kriminelle an Fotos von einer Selbstbefriedigung des Nutzers vor dem Computer gelangt seien. Damit sollten die Opfer dazu erpresst werden, Geldzahlungen zu leisten. Allerdings handelte es sich hierbei nur um einen Bluff.
Vielfältige Malware
Die Gefahr, die von Stealerium ausgeht, sei hingegen real, befinden Sicherheitsforscher der Firma Proofpoint, die die auf GitHub frei verfügbare Malware untersucht haben. Die in der Programmiersprache C# verfasste Software wird dabei zunächst auf klassischem Wege verbreitet, indem Opfer eine E-Mail mit einem Anhang erhalten, die sie öffnen sollen. Statt eines Bestellbogens oder einer Tabelle installiert sich in Wirklichkeit die Malware.
Stealerium verfüge über eine Vielzahl von Funktionen, um das Gerät des Opfers nach verwertbaren Informationen zu durchsuchen. Dazu zählen ein Keylogger, der Tastatureingaben aufzeichnet, das Auslesen von Bank- und Kryptowährungsdaten, das Ausspähen von Passwörtern, der Zwischenablage und Browser-Datenbanken. Inmitten dieser vielen Funktionen verbirgt sich die Webcam-Funktion zur sogenannten Sextortion (Erpressung, bei der Täter mit der Veröffentlichung von Nacktfotos des Opfers drohen). Die Malware sei in der Lage, verschiedene Schutzmechanismen eines Computers auszuhebeln und zu umgehen.
Wie man sich vor der Malware schützt
Die gefundenen Daten verschickt Stealerium wahlweise per E-Mail, über Discord, Telegram oder andere Dienste. Seit Mai 2025 sei eine vermehrte Zahl von Stealerium-basierten Angriffen zu verzeichnen. Der anonyme Urheber der Malware hat diese angeblich zu „Bildungszwecken“ online gestellt.
Zum Schutz vor Stealerium gelten die üblichen Verhaltenstipps: Ausführbare Dateien sollten idealerweise blockiert werden. Besonders Vorsicht gilt bei Anhängen mit den Dateiendungen .js, .vbs, ISO und IMG. Benutzer sollten zudem sensibilisiert werden, verdächtige E-Mails mit Zahlungsaufforderungen, Gerichtsvorladungen und Spendenanfragen mit besonderer Vorsicht zu behandeln und im Zweifel nicht zu öffnen.
(mki)
Datenschutz & Sicherheit
Unsere Einnahmen und Ausgaben und mehr Reichweite

Wir haben uns ein Ziel gesetzt: mehr Reichweite. Das kann erstmal vieles bedeuten. Beim Auto ist es die Zahl der Kilometer, die mit einer Tankfüllung oder Akkuladung zurückgelegt werden. In der Werbung geht’s um möglichst viele Menschen, die eine Anzeige zu sehen bekommen. Wir aber wollen vor allem neue Leser:innen erreichen. Denn wir sind überzeugt, dass unsere Artikel noch weit mehr Menschen interessieren könnten – vor allem jene, die uns vielleicht bislang gar nicht kennen.
Drei Dinge möchten wir dafür in den kommenden Monaten tun. Erstens frischen wir unsere Website auf. So viel sei verraten: Wir sichten bereits die ersten Entwürfe und sind schon sehr gespannt, wie ihr den neuen Anstrich finden werdet! Zweitens hat vor wenigen Tagen Fio bei uns angefangen. Als Werkstudierender wird er uns dabei unterstützen, unsere Texte, Recherchen und Kampagnen in den sozialen Medien bekannter zu machen. Und drittens hilft uns ab kommenden Jahr eine neue Software dabei, mehr und schnelleren Überblick zu unseren Spendeneinnahmen zu bekommen und die besser auszuwerten. Monat für Monat unterstützen uns viele Tausend Menschen mit durchschnittlich 8 Euro, damit wir unsere Arbeit machen können. Wir freuen uns auf das Upgrade!
Die harten Zahlen
Das Projekt Reichweite erstreckt sich vorerst bis Ende 2027. Aus unseren Rücklagen sind dafür insgesamt 200.000 Euro reserviert. Ungefähr ein Drittel davon geben wir für den Website-Relaunch und für die Implementierung der neuen Spendensoftware aus. Die neu geschaffenen Stellen für die Kampagnenarbeit in den sozialen Medien und für die Spendenverwaltung sind mit diesem Projekt auf bis zu drei Jahre langfristig finanziert. Da wir vorsichtig haushalten, haben wir einen Puffer von 7 Prozent einkalkuliert. Über die weitere Umsetzung und zur Mittelverwendung im Projekt Reichweite halten wir euch in den kommenden Transparenzberichten auf dem Laufenden.
Und damit zu den Zahlen des zweiten Quartals dieses Jahres. In den Monaten April, Mai und Juni erreichen uns bisher die geringsten Spendeneinnahmen im Jahresdurchschnitt. Gespendet habt ihr uns im zweiten Quartal insgesamt 174.320 Euro. Das ist quasi eine Punktlandung zu den von uns geplanten 174.000 Euro.
Unsere Spendeneinnahmen
Der Anteil der Einnahmen aus Spenden beträgt im zweiten Quartal 93 Prozent unserer Gesamteinnahmen, die sich auf 190.700 Euro belaufen. Das sind im Durchschnitt pro Monat 63.600 Euro. Um unsere monatlichen Ausgaben zu finanzieren, brauchen wir rund 100.000 Euro an monatlichen Einnahmen. Diese Lücke tut sich jedes Jahr ab Februar auf und schließt sich erst wieder zur Jahresendkampagne ab Mitte November. Wir halten unterjährig eine mittlere sechsstellige Summe aus dem Spendenergebnis der vorangegangenen Jahresendkampagne an Liquidität vor. Damit zahlen wir die Gehälter und Rechnungen in den Monaten, in denen die Einnahmen unter unseren Ausgaben liegen.
Ihr wisst, dass wir von all unseren Unterstützer:innen schwer begeistert sind. Und je mehr Menschen uns regelmäßig unterstützen, desto langfristiger können wir planen. Deshalb bitten wir euch regelmäßig, Dauerspender:in zu werden. Ende August haben wir eine Dauerspendenkampagne abgeschlossen. Wie die gelaufen ist, erzählen wir im nächsten Quartalsbericht.
Bei den Ausgaben im zweiten Quartal liegen die Personalkosten bei 217.313 Euro und damit rund 9.600 Euro unter den anvisierten Kosten unseres Stellenplans. Das liegt am Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. netzpolitik.org zahlt Einheitslohn und fühlt sich bei der Gehaltshöhe dem TVöD Bund (EG 13, Stufe 1) verpflichtet. Die mit dem Tarifabschluss einhergehende erste Phase der Gehaltserhöhung seit April haben wir bei der Budgetrechnung höher kalkuliert als sie eingetroffen ist.
In den Sachkosten haben wir für das erste Quartal 70.236 Euro ausgegeben, rund 4.500 Euro weniger als gedacht. Hier sind alle Ausgabenbereiche unauffällig oder liegen unter dem Plan, da zum Beispiel Beratungskosten (noch) nicht abgerufen wurden. Im Bereich Spendenverwaltung haben wir für die Datenaufbereitung mehr verausgabt als geplant. Diese Kosten entstehen jährlich vor der Versendung der Zuwendungsbestätigungen. Dieses Jahr haben wir für eine Teilautomatisierung dieser Datenaufbereitung Geld in die Hand genommen.
Insgesamt haben wir für Sach- und Personalkosten im zweiten Quartal 287.549 Euro verausgabt. Hier liegen wir mit rund 14.220 Euro unter unserer Kalkulation für dieses Quartal. Im Verhältnis zu unseren gesamten Ausgaben wenden wir für die Redaktion inklusive der IT-Infrastruktur einen Anteil von 70 Prozent auf.
Im Bereich „Unvorhergesehenes“ – kalkulatorische fünf Prozent der Sachkosten – haben wir mit 6.800 Euro fast doppelt so viel ausgegeben als im Budget vorgesehen. Damit haben wir einen Schaden bereinigt, der uns von der Versicherung erstattet wurde. Daher fallen unsere sonstigen Einnahmen entsprechend höher als geplant aus.
Das vorläufige Ergebnis
Wir schließen das zweite Quartal mit einem Ergebnis in Höhe von -96.850 Euro ab. Erwartet hatten wir -123.120 Euro. Somit haben wir dank eures Spenden-Engagements und den zuvor beschriebenen Minderausgaben derzeit 26.270 Euro weniger zu finanzieren als geplant. Wir setzen darauf, dass sich diese Tendenz im Jahresverlauf hält. Danke für euren substanziellen Support!
Wir sind ein spendenfinanziertes Medium
Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.
Wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr hier alle Möglichkeiten. Am besten ist eine monatliche Dauerspende. Damit können wir langfristig planen:
Inhaber: netzpolitik.org e.V.
IBAN: DE62430609671149278400
BIC: GENODEM1GLS
Zweck: Spende netzpolitik.org
Wir freuen uns auch über Spenden via Paypal.
Wir sind glücklich, die besten Unterstützer:innen zu haben.
Unseren Transparenzbericht mit den Zahlen für das 1. Quartal 2025 findet ihr hier.
Vielen Dank an euch alle!
Datenschutz & Sicherheit
Attacken laufen auf Schwachstellen in Linux, Android und Sitecore
Die US-amerikanische IT-Sicherheitsbehörde CISA warnt vor derzeit laufenden Angriffen auf Schwachstellen in Android, Linux und Sitecore. IT-Verantwortliche sollten die bereitstehenden Updates installieren, um die Lücken abzudichten.
Details nennt die CISA in ihrer Meldung nicht, sondern schreibt lediglich, auf welche Sicherheitslücken bereits Angriffe beobachtet wurden. Etwa im Linux-Kernel attackieren bösartige Akteure eine Time-of-Check Time-of-Use (TOCTOU)-Schwachstelle. Der Beschreibung nach handelt es sich um eine Race-Condition bei den Posix-TImern in den Funktionen handle_posix_cpu_timers() und posix_cpu_timer_del() (CVE-2025-38352 / EUVD-2025-22297, CVSS 7.4, Risiko „hoch„). Informationen zu der Schwachstelle sind seit dem 22. Juli des Jahres bekannt; Patches stehen bereit, die die Linux-Distributionen seitdem aufnehmen konnten. Anfällig sind laut Enisa-Eintrag die Linux-Versionen bis 2.6.36, 5.4.295, 5.10.239, 5.15.186, 6.1.142, 6.6.94, 6.12.34, 6.15.3, 6.16-rc2 und 6.16.
Im Android-Betriebssystem können Angreifer aufgrund einer Use-after-Free-Schwachstelle aus der Chrome-Sandbox ausbrechen und system_server von Android attackieren. Das mündet in einer Rechteausweitung und erfordert keinerlei Nutzerinteraktion (CVE-2025-48543 / EUVD-2025-26791, CVSS 8.8, Risiko „hoch„). Die Lücke hat Google mit den Updates zum September-Patchday geschlossen. Sie betrifft Android 13, 14, 15 und 16.
CMS-Schwachstelle missbraucht
Zudem bestätigt die CISA auch den Missbrauch einer Schwachstelle im Sitecore-CMS. Es handelt sich um eine Schwachstelle des Typs „Deserialisierung nicht vertrauenswürdiger Daten“, durch die Angreifer Schadcode einschleusen können, der zur Ausführung gelangt (CVE-2025-53690 / EUVD-2025-26629, CVSS 9.0, Risiko „kritisch„). Die hat Mandiant bei der Untersuchung eines Angriffs entdeckt. Sie basiert auf einer fehlerhaften Konfiguration mit Beispiel-Maschinen-Schlüsseln in ASP.NET. Gegenmaßnahmen finden sich in unserer Schwachstellenmeldung.
Da Aktualisierungen zum Stopfen der Sicherheitslecks bereitstehen, sollten IT-Verantwortliche nicht zögern, diese auch anzuwenden.
(dmk)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Social Mediavor 2 Wochen
Social Mediavor 2 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 UX/UI & Webdesignvor 6 Tagen
UX/UI & Webdesignvor 6 TagenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Entwicklung & Codevor 2 Wochen
Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Digital Business & Startupsvor 2 Monaten
Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick








