Datenschutz & Sicherheit
Degitalisierung: Vom Fach
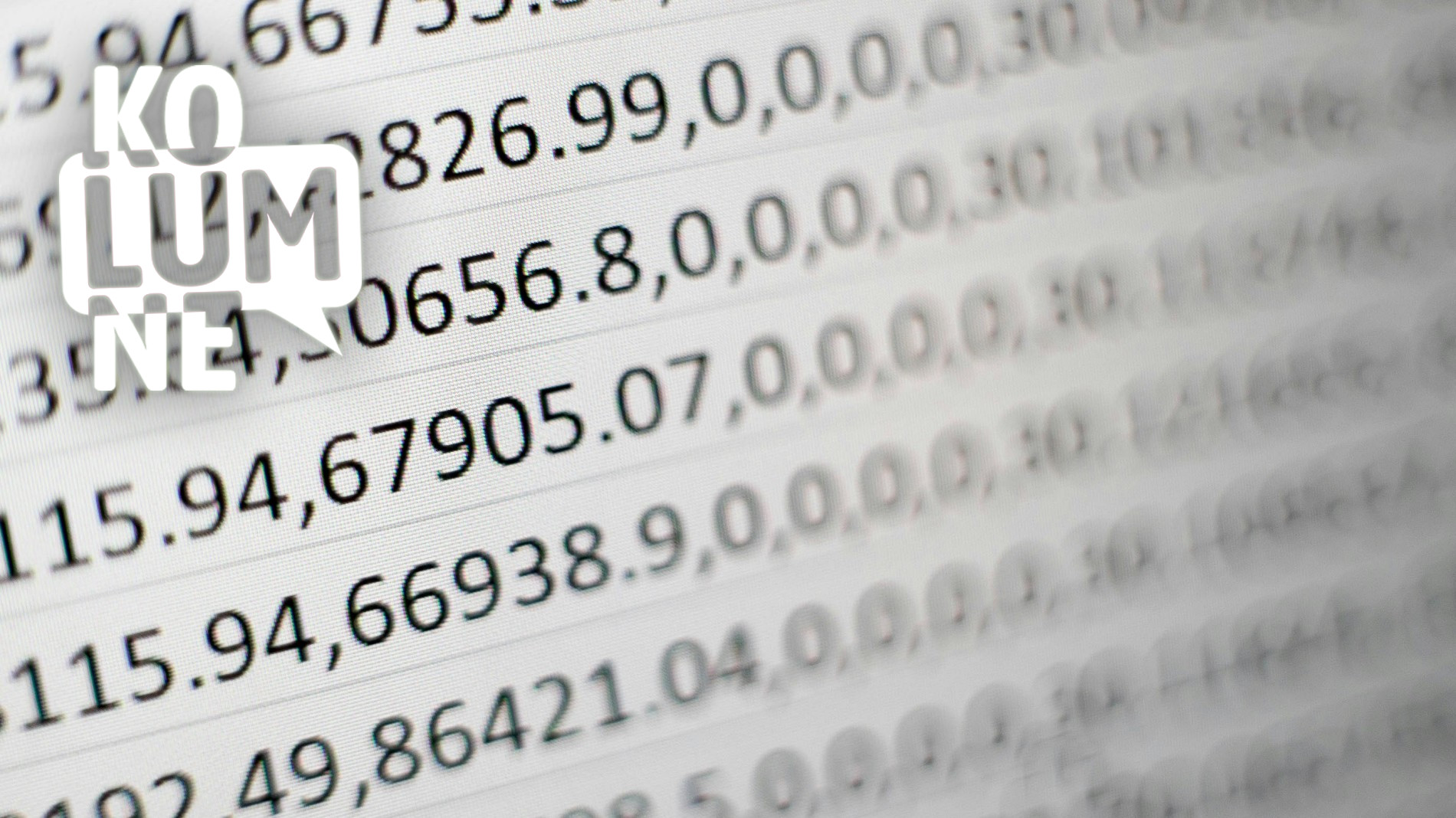
In der heutigen Degitalisierung geht es um eines der am langweiligsten scheinenden Themengebiete der Informationstechnik: Fachanwendungen. Oder genauer gesagt: Um die teils sehr schräge Beziehung, die Staat und Politik zu eben diesen Fachanwendungen haben. Denn auf der einen Seite sind Fachanwendungen eigentlich viel zu wichtig, um sie zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite sind sie aber wiederum auch nicht so wichtig, dass im politischen Diskurs um sie gleich alle Grundrechte aufgegeben werden müssten. Aber der Reihe nach.
Die wundersame Welt der Spezialanwendungen
Fachwendungen sind, vereinfacht gesagt, individuelle Softwarelösungen, die auf die Bedürfnisse einer einzelnen Kund*in maßgeschneidert werden, nicht immer neu entwickelt, manchmal auch sehr individuell aus bestehenden Lösungen konfiguriert. Es gibt Fachanwendungen nicht nur in der Verwaltung oder im Gesundheitswesen, sondern auch im Maschinenbau oder in anderen produzierenden Branchen.
Was macht so eine Fachanwendung? Mindestens Daten verarbeiten, oft auch irgendwie bei der Datenverwaltung helfen, teils auch auf bestehende Datenbanken zugreifen, diese visualisieren oder entsprechende spezifische Berechnungen oder Plausibilisierung durchführen. Mit etwas Feenstaub vermarktet, könnte die schon länger stattfindende Automatisierung in mancher Fachanwendung neudeutsch auch als „Künstliche Intelligenz“ bezeichnet werden, wenngleich Fachanwendungen schon seit Jahrzehnten irgendwelche Arten von Berechnungen in Form von Algorithmen auf Daten durchgeführt haben.
So weit, so theoretisch. In der Praxis des Verwaltungshandelns fällt bei vielen dieser Fachanwendungen oftmals ein Hang zum Scheitern auf.
Der wundersame Lehrerschwund
Im vergangenen Monat fiel eine Fachanwendung aus dem Land Baden-Württemberg durch einen sonderbaren, langanhaltenden Schwund an reell nicht besetzten Stellen von Lehrer*innen auf. Wegen einer Softwarepanne wurden 1440 Stellen jahrelang nicht besetzt. Ein Softwarefehler im Personal- und Stellenprogramm der Landesverwaltung, der über 20 Jahre lang unbemerkt blieb. Weder im Finanz- noch im Kultusministerium ist klar, wie es dazu kommen konnte.
Bemerkenswert ist dann aber auch die teilweise Beschwichtigung des Problems: Mehr Stellen könnten jetzt auch nicht besetzt werden, weil die bestehenden ja schon nicht besetzt werden konnten. Es sei auch kein Schaden an den Steuerzahlenden entstanden, zur Freude der sprichwörtlich sparsamen schwäbischen Hausfrau, denn das Geld sei ja nicht im Haushalt verplant gewesen. So groß sei der Schaden nun auch wieder nicht, es betreffe ja nur 1,5 Prozent der gesamten Stellen für Lehrpersonal im Lande. Was für ein Glück, nicht?
Die Verniedlichung des datenbasierten Bildungsproblems verkennt dabei eines vollkommen: Durch auch nur ein paar betroffene Schüler*innen entstehen große Schäden im Bereich einer ausbleibenden Bildungsrendite, die in Deutschland laut OECD immerhin bei 6 bis 10 Prozent liegen. Durch die Ungerechtigkeit des deutschen Bildungssystems, die sich oft über Generationen durchzieht, reduzieren sich Chancen auf einen sozialen Aufstieg der potenziell betroffenen Schüler*innen wahrscheinlich sogar noch weiter. Kleiner Fehler, große unentdeckte Wirkung.
Fachanwendungen und ihre korrekte Funktion sind eigentlich immens wichtig für die Gesamtgesellschaft und die Daseinsvorsorge. Das scheint nur nicht immer verstanden zu werden. Die Betreuung und kritische Begleitung von Fachanwendungen braucht kontinuierliche fachliche Begleitung und konstante IT-Expertise, nicht nur vom klischeehaften Mathelehrer, der in seiner Freizeit mal ein Programm geschrieben hat. Es braucht Menschen, die Software und deren Entwicklung wirklich vom Fach her verstehen.
Die wundersame Langsamkeit der Anpassung
Die Wichtigkeit von Fachanwendungen und ihrem Ökosystem für das Vertrauen in den Staat scheint ohnehin seit längerem konstant heruntergespielt zu werden. Nur ist das bei manchen dadurch verschleppten politischen Wirkungen bisher vielleicht nicht so stark aufgefallen wie bei einem wundersamen Stellenschwund auf Landesebene. Und keine Sorge, die Beispiele verwenden jetzt explizit keine faxenden Gesundheitsämter in der Pandemie.
Beispiel 1 wäre da die Ehe für alle von 2017. Die Möglichkeit, dass gleichgeschlechtliche Paare zum Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Oktober 2017 auch wirklich in allen staatlichen Datenbanken offiziell heiraten konnten, gab es durch Verzögerungen in der Anpassung der dahinterliegenden Personendatenstandards nicht. Die Standesamtsoftware könne das, klar, das Register dahinter aber, na ja. Dass eine daraus resultierende Softwareanpassung schon mal neun Monate dauern könnte, sei ein „normaler administrativer Prozess“.
Beispiel 2 wäre da das Selbstbestimmungsgesetz, das wegen Änderungen an den technischen Verfahren erst später in Kraft treten konnte – so die Aussage des Bundesrates:
Da die Änderungen, die zum 1. November in Kraft treten, bereits zum 31. Januar des Jahres fertiggestellt sein müssen, damit die Verfahrenshersteller für das Fach- und das Registerverfahren ausreichend Zeit für die technische Umsetzung haben, kann das Gesetz frühestens zum 1. November 2025 in Kraft treten.
Langsamkeit in der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben als „normaler administrativer Prozess“ eben.
Beispiel 3 wäre da die Ersatzfreiheitsstrafe. Die Strafen also, bei der Menschen, die zum Beispiel wegen Fahrens ohne Fahrschein und dem darauffolgenden Nichtzahlen von Geldstrafen ersatzweise eine Freiheitsstrafe absitzen. Wurde von der abzusitzenden Zeit eigentlich halbiert, sollte eigentlich am 1. Oktober 2023 in Kraft treten. Ging aber nicht, die Softwareanpassung der Justizsoftware brauchte länger. Kannste nichts machen, steht halt weiter so im Computer.
Die wundersame Schnelligkeit für innere Sicherheit
Es ist aber nicht alles mit Software so langsam ablaufend und finanziell schlecht ausgestattet. Es kommt nur auf den Verwendungszweck eben dieser Software an. In der Diskussion um die Ausstattung von Sicherheitsbehörden und Polizei mit einer Softwareplattform wie Palantirs Gotham kann es oft gar nicht schnell genug gehen, Millionenbeträge für Lizenzen sind auch kein Thema. Weil durch Knausrigkeit, übertrieben gewissenhafte Prüfung einer Software im Bereich innere Sicherheit auf rechtliche Probleme und Langsamkeit bei der Umsetzung ja quasi morgen schon die innere Ordnung komplett zusammenbrechen würde, so wirkt es. Gotham sei dabei konkurrenzlos.
Es tut der aktuellen Diskussion um Palantir durchaus gut, hier auch das eher sehr nüchterne Wort einer Fachanwendung zu verwenden beziehungsweise einer Plattform für Fachanwendungen. Denn letztendlich ist auch die scheinbar allmächtige Intelligence-Plattform Gotham im Kern auch das: Software, die Daten entsprechend aggregieren, visualisieren und automatisch analysieren kann. Kein mythischer sehender Stein, sondern vor allem Software und Algorithmen.
Der Knackpunkt bei Gotham ist aber nun, welche Automatismen, welche Ontologien und welche Technikfolgen sich Staaten dadurch einkaufen. Wir wissen es quasi nicht, weil alles um Gotham eher intransparent ist. Gerade im Bereich der inneren Sicherheit, bei dem es sehr schnell um sehr intensive Grundrechtseingriffe gehen kann, ist Software wie Gotham und die mit ihr verbundenen Algorithmen oder neudeutsch KI als eine potenzielle „Weapon of Math Destruction“ zu sehen – um den Titel eines Buches von Cathy O’Neil aufzugreifen.
Mit möglichen Vorurteilen behaftete allumfassende automatisierte Datenauswertung auf immer mehr bisher getrennten Daten, wie sie sich gerade in der aktuellen politischen Entwicklung zeigt, ist eben ein Thema, das in seinen Folgen gesamtgesellschaftlich betrachtet werden müsste – in der Diskussion um Palantir politisch aber nicht wird, wie die überhastete, heimliche Beschaffung in Baden-Württemberg zeigt.
Der wundersame Umgang mit Software in der politischen Diskussion
Die Welt der Fachanwendungen mag erst mal langweilig klingen, wir sollten diese Welt aber als Gesellschaft immer kritisch begleiten. Die Spannweite reicht vom schlecht rechnenden Dialogisierten Integrierten Personalverwaltungssystem „DIPSY-Lehrer“ in Baden-Württemberg zu Palantirs Gotham.
Bei Fachanwendungen gilt unabhängig von ihrem Zweck: Nicht alle sind in ihrer Wirkung bekannt, sollten es aber sein. Nicht alle sind transparent, sollten es aber sein. Nicht alle ihre Fehler und Vorurteile sind bekannt, sollten es aber sein. Nicht alle Nutzungen von Fachanwendungen sind ihrer Rechtmäßigkeit vollkommen klar umrissen und begrenzt, sollten es aber sein. Nicht alle ermöglichen eine zügige Anpassung an das freiheitlich demokratisch abgestimmte Handeln, sollten es aber ermöglichen. Keine Anwendung sollte antidemokratische Techmogule in irgendeiner Form unterstützen, ein paar tun es aber.
Dass es hier so eklatante Unterschiede gibt, zeigt, dass wir immer noch nicht verstanden haben, dass Software und ihre Wirkung inzwischen als Teil der Daseinsvorsorge und Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens gesehen werden muss – ob wir das wollen oder nicht. Wir sollten entsprechend verantwortlich mit dieser Erkenntnis umgehen.
Datenschutz & Sicherheit
Sicherheitsupdate: Schadcode-Lücken bedrohen HCL Domino
Admins sollten ihre Instanzen mit dem Anwendungsentwicklungssystem HCL Domino zügig gegen mögliche Angriffe absichern. Geschieht das nicht, kann Schadcode Systeme kompromittieren.
Sicherheitspatch installieren
Wie aus einer Warnmeldung hervorgeht, haben die Entwickler zwei Sicherheitslücken (CVE-2025-53630, Risiko „hoch„; CVE-2025-49847, Risiko „hoch„) geschlossen. Beide Schwachstellen finden sich in der Open-Source-Komponente llama.cpp für den Umgang mit großen Sprachmodellen (LLM). Im Kontext des Vocabulary-Loading-Codes können Angreifer Speicherfehler auslösen und so im schlimmsten Fall eigenen Code ausführen. Das führt in der Regel zur vollständigen Kompromittierung von Computern.
Die Entwickler geben an, dass davon HCL Domino 14.5 betroffen ist. Die Ausgabe DominoIQ Release 0825 (LlamaServerforDominoIQ_0825) soll gegen die geschilderten Angriffe geschützt sein.
Zuletzt haben die HCL-Entwickler im Mai dieses Jahres Schwachstellen in dem Anwendungsentwicklungssystem geschlossen.
(des)
Datenschutz & Sicherheit
Abhören von Mobiltelefonen mit Radartechnik und KI möglich
Einem Team von Informatikern der Penn State University ist es gelungen, Mobiltelefongespräche mittels eines Millimeterwellenradars abzuhören. Das Radar erfasst die Vibrationen an der Oberfläche des Handys, die beim Sprechen entstehen. Die Entschlüsselung der Vibrationsmuster übernimmt eine Künstliche Intelligenz (KI).
Bereits 2022 hatten die Forscher ein ähnliches Verfahren angewendet, um Gespräche abzuhören, die mit einem Mobiltelefon geführt werden. Damals war jedoch die Abhörleistung niedriger. Das System erreichte eine Genauigkeit von 83 Prozent bei nur zehn vordefinierten Schlüsselwörtern.
Das nun entwickelte Verfahren kann mehr Wörter entschlüsseln. Verwendet wird dazu ein Millimeterwellen-Radarsensor. Die Technik wird etwa in autonomen Fahrzeugen neben Lidar verwendet, um Abstände einschätzen zu können. Bei der Abhörtechnik werden damit kleine Vibrationen erfasst, die an der Geräteoberfläche eines Mobiltelefons durch die Sprache entstehen. Die Daten sind jedoch qualitativ eher minderwertig, wie die Forscher in ihrer Studie „Wireless-Tap: Automatic Transcription of Phone Calls Using Millimeter-Wave Radar Sensing“ schreiben, die in den Proceddings der Sicherheitskonferenz ACM WiSec 2025 erschienen ist. Die sehr stark verrauschten Daten müssen daher interpretiert werden können.
Transkription durch KI
Dazu verwenden die Wissenschaftler das Open-Source-KI-Spracherkennungsmodell Whisper. Eigentlich dient Whisper dazu, eindeutige Audiodaten zu transkribieren. Die Forscher wendeten eine Low-Rank-Adaption-Technik des Maschinellen Lernens an, um Whisper für die Interpretation der Radardaten zu trainieren. So mussten die Wissenschaftler das Spracherkennungsmodell nicht von Grund auf neu erstellen.
Das so speziell abgestimmte KI-Modell konnte aus den Daten Transkriptionen für einen Wortschatz von bis zu 10.000 Wörtern erstellen. Die Genauigkeit betrug dabei 60 Prozent. Insgesamt ist das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verfahren von 2022, das nur zehn Wörter erkennen konnte. Das Abgehörte muss aber auch beim neuen System in den Kontext gestellt, gegebenenfalls interpretiert und korrigiert werden. Das ist ebenfalls bei Abhörverfahren durch Lippenlesen so, bei dem nur zwischen 30 Prozent und 40 Prozent der gesprochenen Wörter erfasst werden. In den Kontext gebracht, ergibt sich aber ein hohes Sprachverständnis.
Das Abhörsystem per Radar und KI funktioniert derzeit nur in einer Entfernung bis zu 6 m. Die Wissenschaftler möchten mit ihren Forschungsergebnissen darauf aufmerksam machen, wie einfach Schwachstellen von Angreifern ausgenutzt und sensible Informationen abgehört werden können. Sie wollen deshalb künftig ihr Augenmerk auf mögliche Abwehrmaßnahmen richten.
(olb)
Datenschutz & Sicherheit
Anonymisierendes Linux: Tails startet Test der 7er-Version
Die Linux-Distribution Tails zum anonymen Surfen im Internet steht jetzt als Testversion der Fassung 7.0 bereit. Die Maintainer haben Tails auf eine neue Basis gestellt und liefern aktualisierte Desktopumgebungen und Softwarepakete mit.
In der Release-Ankündigung erörtern die Tails-Macher die Neuerungen. Die Basis stellt das ganz frische Debian 13, Codename „Trixie“. Für den Desktop setzen sie auf Gnome 48, das bereits seit März verfügbar ist. Weitere Änderungen, die die Tails-Maintainer nennen, umfassen etwa den Gnome Terminal, der nun der Gnome Console weicht. Bei dem Wechsel haben die Programmierer das „Root Terminal“ kaputt gemacht. Als temporäre Gegenmaßnahme sollen sich Nutzer mittels des Befehls sudo -i in der regulären Console die Root-Rechte beschaffen.
Den Gnome Image Viewer ersetzen die Entwickler durch Gnome Loupe. Kleopatra fliegt aus dem Favoriten-Ordner und lässt sich nun über „Apps“ – „Zubehör“ – „Kleopatra“ starten. Die obsolete Netzwerk-Verbindungsoption auf dem „Willkommen“-Bildschirm haben die Tails-Macher ebenfalls entfernt.
Aktualisierte Softwarepakete
Diverse Softwarepakete bringt Tails 7.0rc1 in aktualisierten Fassungen mit: Tor Client 0.4.8.17, Thunderbird 128.13.0esr, Linux-Kernel 6.1.4 (mit verbesserter Unterstützung neuer Hardware für Grafik, WLAN und so weiter), Electrum 4.5.8, OnionShare 2.6.3, KeePassXC 2.7.10, Kleopatra 4:24.12, Inksacpe 1.4, Gimp 3.0.4, Audacity 3.7.3, Text Editor 48.3 sowie Document Scanner 46.0. Die Pakete unar, aircrack-ng und sq sind hingegen nicht mehr Bestandteil von Tails.
Tails 7.0rc1 benötigt 3 GByte RAM anstatt ehemals 2 GByte, um flüssig zu laufen. Das betreffe Schätzungen zufolge etwa zwei Prozent der Nutzer. Zudem benötigt die Distribution nun länger zum Starten. Das wollen die Entwickler jedoch bis zum endgültigen Release korrigieren. Final soll Tails 7.0 schließlich am 16. Oktober 2025 erscheinen. Die Release-Candidates sollen Interessierte die Möglichkeit bieten, die neue Fassung bereits zu testen und potenzielle Fehler aufzuspüren. Diese wollen die Entwickler dann bis zur Veröffentlichung der Release-Version ausbügeln.
Ende Juli haben die Tails-Entwickler die Version 6.18 der Distribution herausgegeben. Darin haben sie im Wesentlichen die Unterstützung von WebTunnel-basierten Bridges ins Tor-Netzwerk ergänzt. Die sollen anders als „obfs4“-Brücken die Verbindung als herkömmlichen Webtraffic tarnen. Auch die Version 6.17 von Tails hatte lediglich kleine Aktualisierungen der zentralen Pakete wie Tor-Browser im Gepäck.
(dmk)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Online Marketing & SEOvor 2 Monaten
Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 2 Monaten
Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen
















