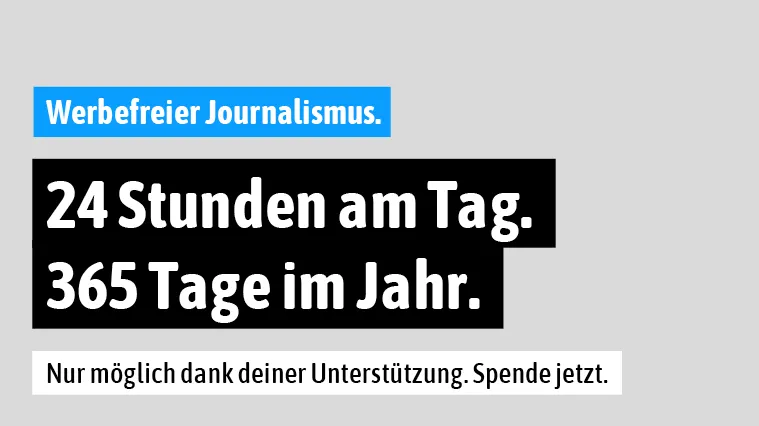Die heutige Degitalisierung blickt zu Beginn auf Werte und das, wofür Unternehmen im Digitalbereich stehen wollen. In der sich selbst als offen, demokratisch sehenden westlichen Welt ist der Juni eigentlich immer noch Pride-Month – in Erinnerung an den Juni 1969, als von Stonewall aus die Pride-Umzüge und der Kampf für Gleichberechtigung ihren Ursprung fanden.
Also eigentlich. Zumindest war das mit dem Pride-Month in Zeiten noch einfacher, in denen die gesamtpolitische Stimmung, der gesamtpolitische Vibe, noch etwas freundlicher der LGBTQIA+-Community gegenüber war, speziell in den USA. Die zweite Amtszeit Donald Trumps begann bereits am 20. Januar mit einem Dekret, das Diversity-, Equality- und Inklusions-Programme in den USA in der letzten Zeit mehr oder weniger gegen null zurückfahren ließ. Dieser Vibe, der sich als vermeintliche „Anti-Wokeness“ positioniert, bleibt dabei aber nicht alleinig bei US-Unternehmen wie T-Mobile USA stehen. Auch deutsche oder europäische Unternehmen wie Roche, UBS oder Novartis ändern daraufhin ihre DEI-Ziele in Europa – aus Angst um gute Geschäftsbeziehungen mit den USA.
Hervorzuheben ist dabei aber das Beispiel von SAP, dem aktuell wertvollsten Unternehmen im Deutschen Aktienindex. Dort wurde klammheimlich mit dem Hinweis auf mögliche Nachteile auf dem US-Markt die bisher angestrebte Frauenquote von 40 Prozent im Konzern aufgegeben. SAP stehe im harten Wettbewerb mit US-Unternehmen, die sich alle an die rechtlichen Vorgaben in den USA halten würden, so SAP-CEO Christian Klein. Ohne großen Widerstand scheinen sich Unternehmen aus der Digitalwirtschaft trotz vermeintlicher Versprechen von „digitaler Souveränität“ mit der protofaschistischen Kleptokratie in den USA gemein zu machen.
Anlass genug, etwas genauer auf das zu schauen, was Unternehmen, speziell im Digitalbereich, meinen, wenn sie von „Werten“ ihres Unternehmens oder der jeweiligen Produkte sprechen. Auch weil uns das auch sehr viel darüber verrät, wie Unternehmen mit der Digitalisierung und ihren zukünftigen Folgen umgehen werden.
Werte und Zahlen
Zugegeben, die sich seit ein paar Jahren alljährlich wiederholenden Pride-Bekundungen von Unternehmen sind oftmals sehr scheinheilig gewesen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass Pride bei global agierenden Unternehmen immer nur dort stolz in der Unternehmenskommunikation offen gezeigt wurde, wo dies opportun war. Opportun ist das aber eher nicht im Mittleren Osten, also lieber niemanden dort verschrecken, zumal dort etwa Homosexualität strafbar ist. Also lieber weiter so tun, als wäre die Welt grau in grau.
Unternehmen, speziell solche mit Aktionärsauftrag, stehen zwar primär für finanzielle Werte, werden aber zugleich nicht müde zu betonen, für welche tollen immateriellen Werte sie stehen. Bei SAP etwa geht es um „langfristigen sozialen Impact“, darum, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens die Welt besser machen, so zumindest die nach wie vor vollmundigen Versprechungen der Corporate Social Responsibility.
Speziell vor dem Hintergrund des allzu schnellen Aufgebens der DEI-Ziele muss aber wieder attestiert werden: (Aktien-)Unternehmen erzeugen lieber Zahlen, die auf hoffentlich gute finanzielle Werte hindeuten, aber keine gesellschaftlichen Werte im eigentlichen Sinne. Grundrechte aller, sei es von Frauen, der LGBTQIA*-Community, migrantischer Menschen und sonstiger Gruppen, die nicht leichtfertig als „Minderheiten“ geframt werden können, lassen sich nur durch eine konstante, langanhaltende Unterstützung auch der Unternehmen erkämpfen. Stonewall was a riot – und eben keine Marketingkampagne.
Dieser scheinheilige, nur zu Marketingzwecken dienende Pseudowertekanon gilt freilich nicht nur für SAP, sondern auch für viele andere Unternehmen, die Support für Pride oder DEI eher als Feel-Good-Kommunikation nutzen. Guckt mal, wie offen und freundlich wir sind, da fällt es doch gleich viel leichter, unsere Produkte und Dienstleistungen zu kaufen, oder?
Am Ende ist der allzu schnelle Verrat der eigenen non-finanziellen Werte aber nur ein Beleg dafür, nie echte Werte gehabt zu haben. Tech-Unternehmen sind da in besonderer Weise anfällig für eine wertebasierte Flexibilität, die sich vor allem dann zeigt, wenn es um die Technikfolgen neuer Technologien und Dienste geht. Problematisch wird das aber besonders dann, wenn Unternehmen aus Wettbewerbsgründen auf die Abschaffung ganz anderer, bisher als unstrittig geltende Grundrechte hinarbeiten.
Voss will einpacken
Eine durchaus sehenswerte Unterhaltung fand auf der diesjährigen re:publica statt, und zwar zwischen dem ehemaligen Datenschutzbeauftragten und nun selbsternannten Aktivisten Ulrich Kelber und Axel Voss, seines Zeichens Mitglied im Europäischen Parlament für die konservative Europäische Volkspartei (EVP). Bekannter ist Voss vielleicht für digitalrechtliche Vorhaben wie die Uploadfilter, das Leistungsschutzrecht und andere Glanzleistungen der konservativen Digitalrechtsannihilation.
In der Diskussion zwischen Kelber und Voss kamen ein paar mögliche Rechtsanpassungen und -initiativen zur Sprache. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sollte etwa optimiert werden, aber natürlich nicht abgeschafft. Auch die Bürokratie sollte heruntergefahren werden. Anpassung an ein „technologisches Level“ nannte Voss das schelmisch schmunzelnd.
Ohne dringende Überarbeitung von anderen Grundrechten und Rechten wie etwa dem Urheberrecht in Hinblick auf sogenannte Künstliche Intelligenz sei es aber so, dass wir „einpacken“ können, würden wir hier nicht schnellstens rechtliche Anpassungen durchführen. Axel Voss’ Diktum „Ja, dann können wir einpacken“ stach in der Diskussion hervor. Würde das nicht passieren, „dann müssen wir uns nicht mehr überlegen, ob wir überhaupt noch im digitalen Rennen irgendwie mitmachen wollen“.
Eher nicht so überzeugend klang der Hinweis am Ende, dass der europäische Wertebezug nicht verhandelbar sei, wenn die Grundrechte im digitalen Raum wirtschaftsorientiert angepasst werden. Auch hier gilt: Grundrechte, die nicht verhandelbar sind, dürfen nicht dann zur Diskussion gestellt werden, wenn der wirtschaftlich getriebene Vibe gerade Schwierigkeiten mit Copyright und Rechten aus der DSGVO hat.
Vielleicht ist das Problem dann eher, dass Techniken sogenannter künstlicher Intelligenz in der Form, wie sie heute betrieben werden, schlicht nicht mit Grundrechten harmonisierbar sind? Wer sich mit dem europäischen demokratischen Wertebezug schmücken will, darf diesen nicht je nach Stimmungslage zur Verhandlung stellen. Auch Grundrechte waren das Ergebnis von Aufständen – und eben keine politischen Marketingkampagnen zur Befriedigung von Wirtschaftsinteressen.
Werte sind keine Vibes
Der Aufstieg der sogenannten künstlichen Intelligenz und ihren gesamtgesellschaftlichen und scheinbar unausweichlichen, auch auf Grundrechte durchdringenden Veränderungen wurde seit Jahren begleitet von technokratischer Stimmungsmache, von der Furcht, etwas zu verpassen. Oftmals grandios übertrieben.
Betrieben wird sie auch von führenden Köpfen im Feld der KI-Forschung. Wie etwa von Geoffrey Hinton, der vor Jahren noch davor warnte, bloß keine neuen Radiolog*innen mehr auszubilden, die Technik würde sie bald schon obsolet machen. Eingetreten ist dieses Szenario in dieser Form nicht.
Ebenso ist das Narrativ von mehr Daten, mehr Rechenleistung, bessere Modelle wiederholt nicht eingetreten, trotz vermeintlich „nachdenkender“ Reasoningmodelle. Probleme wie Halluzinationen aber sind geblieben, sie sind sogar noch schlimmer als zuvor.
Speziell im Kontext der sogenannten künstlichen Intelligenz muss der Vibe, die Stimmung, dass der verheißene technologische wundersame Fortschritt jetzt ganz bald kommen werde, aber immer neu am Leben gehalten werden. Waren es erst große Sprachmodelle, brauchte es dann Reasoning-Modelle und jetzt eben KI-Agenten, die das nächste große Ding sein werden. Vorangetrieben wird all das von einer Kaste von Manager*innen, die das nächste große Tech-Ding in ihren Produkten haben müssen, ohne Rücksicht darauf, dass dies Sinnhaftigkeit ihres Kernproduktnutzens zerstört. Aber auch die Erstellung dieser sinnentleerten Digitalprodukte selbst ist nur noch Vibe Coding – ganz egal, ob das irgendwie besser ist.
Am Ende gibt es nur selten Neuerungen, die der Gesellschaft zugutekommen. Stattdessen erleben wir die weitere Aushöhlung von Grundrechten. Ganz egal, ob das einhergeht mit schon länger offensichtlichen großen Problemen wie Bias, digitalem Kolonialismus, immensem Ressourcen- und Energieverbrauch, hoher Machtkonzentration, ungehemmtem Datenkonsum, Wegbereitung des Faschismus, Plagiarismus und Desinformation. Für vermeintlich verheißungsvolle market opportunites einer sehr kleinen Gruppe an Tech-Unternehmern sollen immer wieder die Grundrechte und die Grundlagen einer gemeinsamen, lebenswerten Zukunft geopfert werden.
Das ist leider kein Vibe mehr, das ist die harte Realität.