Künstliche Intelligenz
Deutschlands Hightech-Agenda: KI soll 10 Prozent der Wirtschaftsleistung bringen
Die Bundesregierung möchte mit ihrer Agenda für Hochtechnologie Deutschland in sechs Bereichen auf Spitzenniveau bringen, wie das Handelsblatt berichtet. Insgesamt 5,5 Milliarden Euro sollen demnach in die Felder Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Mikroelektronik, Fusionsforschung, klimaneutrale Mobilität und Biotechnologie investiert werden. Das gehe aus einem Entwurf des Strategiepapiers aus dem Bundesforschungsministerium hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) habe den Entwurf vergangene Woche zur Abstimmung an die anderen Bundesministerien gegeben, ein Beschluss könne darüber bereits in der kommenden Woche erfolgen.
„Neue Technologien ‚made in Germany‘ sollen wieder zum Markenzeichen unseres Landes werden“, ist laut Handelsblatt-Bericht der Anspruch der Strategie. Der Bund wolle die zahlreichen Vorhaben als Ankerkunde und als Partner der Wirtschaft in Form öffentlich-privater Partnerschaften voranbringen. Erste Maßnahmen sollen auch schon 2025 starten und langfristig soll eine „lebendige Innovationskultur“ entfesselt werden.
Mehr Wirtschaftsleistung mit KI
Unter anderem seien „groß angelegte Förderinitiativen für Künstliche-Intelligenz-Modelle der nächsten Generation“ geplant. Hochschulen sollen Rechenkapazitäten, Dateninfrastrukturen und Kompetenzen für KI aufbauen und führende Forschungseinrichtungen besser mit Start-ups vernetzt werden. Das ambitionierte Ziel lautet demnach: Bis 2030 sollen zehn Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung KI-basiert erzeugt werden. Wichtige Bereiche für den KI-Einsatz seien Robotik, Medizin, ferner klassische deutsche Schlüsselbranchen wie die Automobil- und Chemieindustrie.
Als wichtige Infrastruktur für diesen KI-Boom sieht die Bundesregierung auch die mit EU-Geldern im Land errichteten KI-Gigafactories. „Die Betriebsaufnahme ist für Mitte 2027 geplant“, heißt es im Entwurf. Allerdings ist noch gar nicht klar, an welchen Standorten die EU die Errichtung von KI-Fabriken fördern will. 76 Firmen und Organisationen aus 16 Mitgliedsstaaten haben zum Stichtag Ende Juni Interesse bekundet, um – teils über Konsortien – bis zu 60 AI Gigafactories zu bauen. Die EU plant, 230 Milliarden Euro über die nächsten Jahre dafür auszugeben.
Chip-Produktionsstandort Nummer eins?
Auch bei der Halbleiterindustrie hat sich die Bundesregierung einiges vorgenommen: „Wir holen neue Chipfabriken nach Deutschland und etablieren Deutschland als Chip-Produktionsstandort Nummer eins.“ 2026 soll etwa ein „Kompetenzzentrum Chipdesign“ entstehen, das die Entwicklung effizienter KI-Chips antreiben soll. Die Bundesregierung hat gerade bei den KI-Chips für die Industrie Chancen für Deutschland ausgemacht.
Ausrüstung und Vorprodukte für Halbleiterfertigung sollen auch vermehrt hierzulande entstehen. „Mindestens drei neue Werke“ sollen dafür Anreize schaffen, ebenso Partnerschaften mit internationalen Technologieführern. Die Abhängigkeit von Dritten sei außerdem zu reduzieren und im internationalen Wettbewerb wichtige Fähigkeiten müssten im Land gehalten werden.
Quantencomputing und Fusions-Weltmarktführer
Beim Quantencomputing geht die Bundesregierung davon aus, dass 2030 „Quantencomputer auf europäischem Spitzenniveau“ zur Verfügung stehen. Ein „missionsgetriebener Hardware-Wettbewerb“ soll bei der Erreichung dieses Ziels helfen. Forschungseinrichtungen und Hochleistungsrechenzentren will der Bund auch beim Kauf von Quantencomputern unter die Arme greifen – ein Standortwettbewerb soll die geeigneten Kandidaten ermitteln. Bereits 2025 soll ein erster deutscher Forschungssatellit zur Erprobung von Quantenkommunikation ins All gehen, 2026 ein zweiter.
Weltmarktführerschaft erhofft sich Bundesregierung laut dem Bericht in Sachen Kernfusion. Bis Ende des Jahres soll ein Plan zur Entstehung des ersten Fusionskraftwerks in Deutschland stehen. Darüber hinaus will die Regierung die Entwicklung klimaneutraler Energie beschleunigen, mit Förderung zur Forschung bei Windrädern, Photovoltaik, Batteriespeichern, Geothermie und Wasserstoff.
Bei der klimaneutralen Mobilität lautet das Ziel, bis 2035 in Deutschland eine wettbewerbsfähige Batterieproduktion inklusive Recycling zu etablieren. Den Weg dafür soll unter anderem ab 2026 ein Batteriekompetenzcluster ebnen. Aber E-Fuels sollen auch gefördert werden. Von den Fördermaßnahmen in der Biotechnologie wiederum erhofft sich die Bundesregierung, mehr „Souveränität in der Entwicklung der Medizin von morgen“ sowie bessere Nutzpflanzen und mehr Pflanzenschutz.
Was aus all diesen Hightech-Ansätzen wird, soll auch evaluiert werden: „360-Grad Hightech-Monitoring“ mit digitalem Dashboards werde die Fortschritte zeigen, heißt es dem Handelsblatt zufolge in der Strategie.
(axk)
Künstliche Intelligenz
Zulieferer ZF: Erreichen Sparziel – aber das reicht nicht
Der Chef des kriselnden Autozulieferers ZF Friedrichshafen, Holger Klein, sieht sein Unternehmen beim Erreichen selbst gesteckter Sparziele trotz Erfolgen noch nicht am Ziel. „Wir sind bei rund 5,8 Milliarden, die wir erreicht haben, und werden jetzt die Lücke zum Ende des Jahres noch schließen. Aber wir sehen eindeutig, das reicht nicht“, sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur. ZF hatte 2023 ein erstes Einsparziel von sechs Milliarden Euro für die Jahre 2024 und 2025 angekündigt. Eine Summe für ein neues Sparziel nannte der Manager aber nicht.
Aktuell sprechen Management und Betriebsrat über die Neuausrichtung der Sparte für Antriebe, intern „Division E“ genannt. „Ich glaube, allen Beteiligten ist klar, dass die Division E sich in der Mitte eines perfekten Sturms befindet“, sagte Klein. Sie ist in Teilen nicht wettbewerbsfähig. Der Bereich umfasst das Geschäft mit Getrieben für alle Antriebsarten. Er leidet besonders unter dem verzögerten Anlauf der E-Mobilität sowie unter hohen Kosten und geringen Margen im traditionellen Getriebegeschäft.
Mehrere Optionen für die Antriebssparte
Für den Manager gibt es mehrere Optionen: „Eine Partnerschaft für die E-Division wäre für uns eine gute Lösung, denn sie böte die Möglichkeit, Kosten und Risiken für die Weiterentwicklung neuer Produkte mit dem Partner zu teilen und damit auch mehr Beschäftigung zu sichern.“ Auch eine Restrukturierung ohne Partner könne erfolgreich sein – erfordere jedoch stärkere Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität. „Beides besprechen wir mit den Arbeitnehmervertretern.“ Details zum Stand der Gespräche nannte er nicht. Sie sollen bis Ende September abgeschlossen sein.
Der Betriebsrat hatte zuletzt mit Protesten gegen die geplanten Einschnitte bei ZF mobil gemacht. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Achim Dietrich, hatte erklärt: „Die geplante Ausgliederung oder gar der Verkauf der Division E ist keine Strategie, die wir mittragen können“. Eine Ausgliederung oder ein Verkauf wären ein fataler Fehler, wurde Dietrich damals in einer Mitteilung zitiert. ZF-Chef Klein sagte nun: „Meine feste Überzeugung ist, mit Partnern haben wir durchaus weitere Wachstumspotenziale und das würde sich auch positiv auf unsere Arbeitsplätze in Deutschland auswirken.“ Das Unternehmen streicht aktuell Tausende von Stellen im Inland.
Verlust im ersten Halbjahr
ZF hatte im ersten Halbjahr einen Verlust von 195 Millionen Euro verzeichnet. ZF leidet – wie die Konkurrenten Bosch, Continental und Schaeffler – aktuell wegen der niedrigen weltweiten Fahrzeugproduktion unter ausbleibenden Aufträgen der Hersteller. Klein sagte, beim Umsatz sei man aufgrund drastisch verringerter Abrufe der Hersteller im laufenden Jahr unter Plan. Das bekomme man durch die Maßnahmen aufgefangen. Aber: „Wir glauben auch nicht, dass 2026 besser wird.“
Der Manager mahnte eine Überprüfung der EU-Regeln für die Autoindustrie an. „Wenn wir in der EU bei einem Aus für den Verbrenner im Jahr 2035 bleiben, dann wird das auch jetzt schon Effekte auf unsere Beschäftigung haben, weil wir jetzt eigentlich die nächsten Getriebe-Generationen für Hybridantriebe entwickeln müssten.“ Wenn aber nicht absehbar sei, dass diese dann regulatorisch erlaubt seien, dann habe man für die Ingenieure, die das normalerweise machten, nichts zu tun.
Das Unternehmen hat neben Getrieben unter anderem auch Lenksysteme, Antriebe, Bremsen, Sicherheitstechnik und Fahrwerkskomponenten im Angebot. ZF ist hoch verschuldet. Die Nettoverbindlichkeiten beliefen sich Ende Juni auf rund 10,5 Milliarden Euro. Die Schulden haben ihren Ursprung vor allem im Erwerb des Autozulieferers TRW und des Bremsenspezialisten Wabco.
(nen)
Künstliche Intelligenz
Kommentar: Reguliert endlich den Smart-Begriff!
Das smarte Home bleibt eine herstellerverursachte Hölle. Nichts deutet darauf hin, dass Kompatibilität über Einzelszenarien hinaus besser wird. Was Frickler und Fachbetriebe freut, ist für Menschen, die Technik vor allem nutzen wollen, ein Graus. Zeit für klare Regeln, was sich „Smart“ nennen darf!
Smart Home, das intelligente Heim, das ist eine Vision, die inzwischen schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Was anfing mit der Idee, nicht mehr im ganzen Haus selbst Rollläden steuern zu müssen, ist für viele Deutsche – und darunter sicher überproportional viele Leser von heise online – inzwischen zur modernen Alternative zur Modelleisenbahn geworden: Irgendwas lässt sich immer optimieren, und an neuen Modellen ist derzeit kein Mangel. Ergänzt wird das zudem von einer ganz anderen Entwicklung: dem Aufkommen von Solaranlagen, insbesondere kleineren solchen, bei denen jede eigenverbrauchte Wattstunde die Stromrechnung spürbar drückt. Wer würde da nicht versuchen, alles aufeinander abzustimmen?
Nur ein Bereich leistet bei den smarten Endgeräten bislang ganze Arbeit: die Marketingabteilungen. Elektrogeräten in jeder Form und Farbe, vom smarten Leuchtmittel über smarte Waschmaschinen bis zur Heizungs- und Stromsteuerung, Rollläden, Fernseher, Stecker, Uhren, Brillen, immer mehr Küchengeräte: Alles wird als smart gelabelt, sobald es einen Account in der Herstellercloud benötigt. Und das nicht mehr nur zur IFA in Berlin, wo die Branche traditionell ihre Neuerungen präsentiert. Und wo auch in diesem Jahr bis zur Fritteuse alles möglichst smart, vernetzt und intelligent sein soll. So schlau, dass der Mensch mit seinen beschränkten Fähigkeiten und daraus resultierenden Bequemlichkeitswünschen daneben schon sehr schlicht wirkt.
Über sieben Bridges solltst du gehen
In der Theorie wirkt dabei (Lichtstimmung: Party) alles schön: Balkonkraftwerk kaufen, anschließen, Strom ernten. Und damit das auch so richtig rund läuft und spart, lässt man bestimmte Geräte hinter smarten Steckdosen laufen. Und genau hier beginnt der harte Aufprall des Durchschnittsbürgers auf die technische Realität: Wolkige Versprechen, welche die meisten „smarten“ Geräte nicht im Ansatz halten (Lichtstimmung: Kalt). Das fängt mit einer banalen Grundfrage an: Wie soll zwischen den Geräten kommuniziert werden? Bluetooth-LE, DECT-ULE, ZigBee, WLAN, Matter oder etwas ganz anderes, proprietäres? Und wenn per WLAN, das Hausnetz, oder ein dafür eingerichtetes zweites Netz? Oder gar ein Insel-Access-Point, wie ihn etwa manche Wechselrichter dauerhaft aufspannen? Mit welcher Lösung soll dieser Zoo anschließend zentral gesteuert werden? App-basiert, per Cloudservice? Vom NAS aus? Welche Geräte sind überhaupt mit welcher Software über welchen Standard ansprechbar? Und wie lassen sich diese dann miteinander verknüpfen? Es ist das pure Chaos.
Lauter leere Versprechungen
Tatsächlich haben die Elektro- und Elektronikgerätehersteller vor allem eines geschafft: Die Lust an der Schlauerwerdung der eigenen vier Wände kräftig auszutreiben (Lichtstimmung: Grim, im Hintergrund beginnt die Waschmaschine zu rotieren). Denn wer sich wochenlang mit der Frage beschäftigen muss, welches Gerät überhaupt mit welchem sprechen kann, wenn die Herstellerangaben bei Geräten im besten Fall unvollständig, im schlechtesten Fall irreführend sind. Oder die mit Versprechungen werben, etwa der schon zur IFA 2023 angekündigten Unterstützung des Matter-Standards durch die Fritz-Produkte (Die Connect-Leuchte schaltet auf Dauerrot).
Zwei Jahre später kann immer noch nur ein Bruchteil der Geräte des Herstellers den gemeinsamen Standard, bei dem sich auch andere Anbieter weiterhin schwertun. Die einzige Frage, die sich bei so etwas dann wirklich stellt: Was soll das? (Der Rauchmelder versucht, aufgrund des Autoren-Schnaubens Qualm zu detektieren, die Dunstabzugshaube schaltet auf Höchstleistung).
Und so müssen sich die Nutzer weiterhin die Frage stellen: Über welche Bridge spricht welches Gerät mit welchem anderen? Wie kann ich die Glühbirne und den Wäschetrockner mit dem Stromspeicher und dem Bewegungssensor koordinieren lassen? Wie den Heizthermostat mit dem Fenstersensor? Was für den einen oder anderen heise-Leser, DIY-Freund, Kommandozeilenelektriker und selbstbewussten Maker primär eine sportliche Herausforderung sein mag, ist für die Nutzbarkeit durch breite Massen eine absolute Katastrophe.
Die EU sollte den „Smart“-Begriff scharf regulieren
Es ist daher höchste Zeit, dass Politik das tut, wofür sie nur selten geliebt wird: klare Regeln vorschreiben. Hier wäre das im Sinne aller Verbraucher. Denn so wie die EU nach Jahren mit den Vorgaben für USB-C-Anschlüsse das Steckerchaos und die Sonderwege zugunsten der Verbraucher beendet hat, ohne dass seitdem die Welt untergegangen ist, so wie die EU mit den Roamingvorschriften das Chaos für Reisende in Europa abgeschafft hat, wäre es jetzt an der Zeit, den Herstellern per Gesetz vorzuschreiben: Wenn ihr ein Gerät als Smart benennen wollt, dann müsst ihr dafür bestimmte Standards erfüllen.
Das kann auch ein Verweis auf technische Normen sein, welche die Branche selbst weiterentwickeln kann. Dann können Verbraucher sich darauf verlassen, dass „Smart“ nicht „Insellösung eines Herstellers der auf keinen Fall interoperabel sein will“ heißt. Und ganz nebenbei noch ein paar Vorgaben zum Thema Cloud-Unabhängigkeit mit auf den Weg geben. Wer Geräte als „Smart“ labeln will, sollte Mindeststandards bei Bedienbarkeit und Interoperabilität wahren müssen. Was spräche etwa gegen die Verpflichtung, die Konfiguration über eine lokal per Browser erreichbare Oberfläche verpflichtend zu machen? Und nicht nur über eine proprietäre App, die vielleicht noch einen Account beim Hersteller voraussetzt?
Der bisherige Wildwuchs, dass alles sich Smart nennt und in Wahrheit kaum etwas miteinander kompatibel ist, führt nur zu zwei Dingen: Frust und jeder Menge vermeidbarem Elektroschrott. Schluss damit! Dann hellt sich die Lichtstimmung in der Verbraucher-Smart-Welt auch wieder auf.

Falk Steiner ist Journalist in Berlin. Er ist als Autor für heise online, Tageszeitungen, Fachnewsletter sowie Magazine tätig und berichtet unter anderem über die Digitalpolitik im Bund und der EU.
(nen)
Künstliche Intelligenz
iX-Workshop: E-Rechnungspflicht – Anpassung von Faktura- und ERP-Software
Seit 2025 gilt in Deutschland die gesetzliche Verpflichtung zur strukturierten E-Rechnung im B2B-Bereich. Das betrifft insbesondere Softwareentwickler und Hersteller von Faktura- oder ERP-Software, die nun ihre Produkte entsprechend anpassen müssen.
Interaktiv und praxisnah
Unser Workshop E-Rechnungspflicht: Software richtig implementieren bietet Ihnen eine praxisnahe Anleitung, wie Sie die neuen XML-Formate des europäischen Rechnungsstandards EN16931, wie Cross Industry Invoice (CII), Universal Business Language (UBL), Factur-X und ZUGFeRD, sowie XRechnung im B2G-Bereich, unterstützen, prüfen und umwandeln können. Sie beschäftigen sich mit den Rollen, den Darstellungsdetails, der Umwandlung, der Prüfung und Umsetzung der X(ML)-Rechnung. Dazu gehören praktische Übungen, in denen Sie die verschiedenen XML-Formate kennen und anwenden lernen.
|
Oktober 06.10. – 10.10.2025 |
Online-Workshop, 09:00 – 12:30 Uhr 10 % Frühbucher-Rabatt bis zum 07. Sep. 2025 |
Der nächste Workshop findet vom 06. bis 10. Oktober 2025 statt und richtet sich an Softwareentwickler und Projektleiter, die Software herstellen, Rechnungen erstellen oder einlesen, sowie an ERP-Softwarehersteller und Data Scientists, die Auswertungen erstellen. An drei Vormittagen (06., 08. und 10. Oktober) treffen Sie sich online in der Gruppe mit dem Trainer. Für den zweiten und vierten Tag nehmen Sie Aufgaben mit, die Sie selbstständig lösen und am Folgetag in der Gruppe besprechen können.
Durch den Workshop führen Andreas Pelekies, technischer Erfinder des ZUGFeRD-Standards und (Co-)Autor verschiedener internationaler Standards, sowie Jochen Stärk, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Backend-Entwickler. Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung und haben sich auf Themen rund um die E-Rechnung spezialisiert.
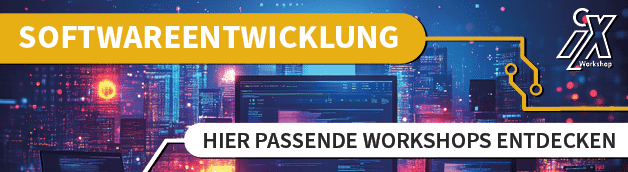
(ilk)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Woche
UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 3 Wochen
Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 4 Tagen
Entwicklung & Codevor 4 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events














