Künstliche Intelligenz
Donnerstag: Warnstreik bei TikTok in Berlin, Google mit mehr Milliarden für KI
Deutsche TikTok-Zensoren haben eine KI trainiert, die ihnen jetzt den Arbeitsplatz wegnimmt. Die Gewerkschaft Verdi will reden, TikTok aber nicht. Am Mittwoch war Warnstreik, denn Verdi versteht das auch als Pionierarbeit für faire Arbeitsbedingungen in der Branche an sich. Von KI-Training profitiert Alphabet mit seiner Google-Cloud, sodass der Google-Konzern seine Einnahmen und Gewinne weiter steigert. Aufgrund hoher Nachfrage und Wachstumschancen investiert Alphabet nun stärker in KI als vorgesehen. Das entsprechende Budget für 2025 wird von 75 auf 85 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Derweil hat das Spiel „Elsewhere Electric“ ein interessantes Konzept, das VR- und Smartphone-Nutzer gemeinsam spielen lässt. Der Einsatzleiter steuert am Smartphone das Innenleben einer Anlage, während sich der Techniker vor Ort mithilfe von VR an den Geräten selbst zu schaffen macht. Doch bei näherem Hinsehen zeigen sich Schwächen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.
Zum ersten Mal streiken in Deutschland Mitarbeiter eines Sozialen Netzes. Anlass ist, dass bei TikTok Germany in Berlin massiver Stellenabbau droht. Laut Vereinter Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) soll die gesamte deutsche Trust-and-Safety-Abteilung Tiktoks sowie ein Teil der sogenannten Live-Operations-Abteilung aufgelöst werden. Die Aufgaben werden demnach eine in der Volksrepublik China entwickelte Künstliche Intelligenz sowie externe Dienstleister übernehmen. In Berlin fallen dabei rund 150 Arbeitsplätze weg. Weil das chinesische Unternehmen TikTok jede Verhandlung mit Arbeitnehmervertretern ablehne, haben die Betroffenen am Mittwoch gestreikt. Verdi versteht das auch als Pionierarbeit für faire Arbeitsbedingungen in der Branche an sich: In Berlin streikt TikTok-Belegschaft gegen KI.
KI gehört zu den Umsatzbringern verschiedener Unternehmensbereiche des Google-Konzerns Alphabet. Diese sind in den vergangenen drei Monaten deutlich stärker gewachsen, als Beobachter erwartet hatten. Die wichtigsten Google-Abteilungen konnten die Einnahmen sogar im zweistelligen Prozentbereich steigern. Gleichzeitig sieht sich der Datenkonzern gezwungen, mehr Geld in KI zu stecken, viel mehr. Denn Alphabet erhöht seine KI-Investitionen für dieses Jahr um zusätzlich 10 Milliarden Dollar. Anfang Februar hatte Alphabet-Chef Sundar Pichai im laufenden Jahr 75 Milliarden Dollar für Kapitalanlagegüter budgetiert, denn der KI-Boom lechzt nach leistungsstarken Servern. Knapp ein halbes Jahr später war dies aber offenbar nicht genug: Alphabet übertrifft Erwartungen deutlich und steckt mehr Milliarden in KI.
Das Spiel Elsewhere Electric ist für zwei Personen ausgelegt: Eine spielt mit VR-Brille, die andere am Smartphone. Gemeinsam sollen sie eine stillgelegte Anlage tief unter der Erde wieder in Betrieb nehmen. Die Person am Smartphone übernimmt die Rolle des Einsatzleiters und gibt von der Oberfläche aus Anweisungen, während die Person mit VR-Brille in die unterirdische Anlage vordringt, um vor Ort als Techniker manuelle Arbeiten auszuführen. Dort warten dunkle Räume, kryptische Terminals und unheimliche Lebewesen. Dabei zeigt sich, dass Elsewhere Electric primär ein Spiel ist über Kommunikation, und wie schwer es sein kann, Gesehenes sprachlich zu vermitteln. Das Spiel ist praktisch Fernwartung als Couch-Koop-Spiel: „Elsewhere Electric“ ausprobiert.
China kommt bei der Wiederbelebung eines futuristischen Transportkonzepts aus der Sowjetunion offenbar voran, während unklar ist, wie es bei parallelen Bemühungen in den USA weitergeht. In beiden Fällen geht es um sogenannte Bodeneffektfahrzeuge, die in geringer Höhe über ebenen Flächen – vor allem stillen Gewässern – entlang rasen und sich dafür den gleichnamigen Effekt zunutze machen können. Bodeneffektfahrzeuge vereinen Eigenschaften von Schiffen und Flugzeugen, gegenüber beiden haben sie Vorteile. Für Aufsehen gesorgt haben dabei zuletzt Aufnahmen eines Gefährts in der chinesischen Bohai-Bucht: Das „Bohai-Seeungeheuer“ ist offenbar das seit Jahrzehnten größte gebaute Bodeneffektfahrzeug. Ist es geeignet fürs Militär? Größtes Bodeneffektfahrzeug seit Sowjetzeiten in China entdeckt.
Der Titel unseres Artikels „Lern bloß nicht programmieren!“ ist provokant und Sie werden bei den ersten Sätzen vielleicht denken: „Nicht schon wieder ein Artikel zum Thema KI!“ Aber darum geht es gar nicht. Künstliche Intelligenz wird dabei nur am Rande behandelt, sie dient lediglich als Aufhänger. Denn tatsächlich geht es hier um etwas sehr viel Grundsätzlicheres, nämlich den Unterschied zwischen Programmierung und Softwareentwicklung. Denn in letzter Zeit hört man immer wieder den Satz: „In Zukunft wird niemand mehr programmieren müssen. Das übernimmt dann alles die KI.“ Doch was ist mit „Programmieren“ in diesem Zusammenhang überhaupt gemeint? Denn Code erzeugen kann KI bereits jetzt, aber auch das Verstehen und die Lösung eines Problems gehören zur Softwareentwicklung: Lern bloß nicht programmieren!
Auch noch wichtig:
(fds)
Künstliche Intelligenz
Kommentar: KI frisst Junior-Stellen – und unsere Zukunft?
Wer dieser Tage durch Stellenausschreibungen in der IT-Branche stöbert, stößt auf ein klares Muster: Senior Developer gesucht – bitte mit zehn Jahren Berufserfahrung, vertieften Kenntnissen in zahlreichen Frameworks und am besten noch Praxiserfahrung in Machine Learning. Junior Developer? Fehlanzeige!

Madeleine Domogalla arbeitet als Redakteurin in der iX-Redaktion bei heise und ist für Softwareentwicklungsthemen zuständig. Darüber hinaus betreut sie IT-Konferenzen, online und vor Ort.
Die neuesten Zahlen bestätigen den Eindruck, denn während Senior-Positionen nur leicht zurückgehen, schrumpfen Junior-Stellen im IT-Bereich dramatisch. Die Einstiegspositionen sind in Deutschland seit 2020 um mehr als die Hälfte zurückgegangen, wie das Jobportal Indeed meldet. Und das in einer Branche, die uns seit Jahren predigt, es fehle an Nachwuchs. Ironie des digitalen Zeitalters. Wir schaffen die Stellen ab, aus denen dieser Nachwuchs überhaupt erst hervorgehen kann.
Zu kurzfristig gedacht
Natürlich, künstliche Intelligenz liefert beeindruckende Produktivitätsschübe. Sie generiert Boilerplate-Code in Sekunden, schreibt automatisierte Tests, schlägt Bugfixes vor oder dokumentiert Schnittstellen nahezu selbstständig. Routineaufgaben, die meist Juniors erledigten, lassen sich so mit einem Prompt effizienter umsetzen. Aber genau an einer Stelle bleibt KI blind: Menschen ausbilden, ihnen Erfahrung vermitteln und sie zu erfahrenen Fachkräften heranwachsen lassen.
Unternehmen, die heute glauben, mit KI kurzfristig teure Einstiegspositionen kompensieren zu können, sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen. Denn ohne Junior-Entwicklerinnen und -Entwickler von heute gibt es keine Senior Engineers von morgen – keine Softwarearchitektinnen, keine Tech-Leads, keine CTOs.
Chancen erkennen und nutzen
Was bedeutet das für junge Menschen? Der Einstieg wird härter, aber nicht unmöglich. Wer sich früh mit KI-gestützter Entwicklung auseinandersetzt, kann sich von anderen abheben. Unternehmen müssen lernen, mit KI nicht nur Effizienz, sondern auch Lernräume zu schaffen. Denn wer heute keine Nachwuchskräfte einbindet, hat morgen keine Fachkräfte mehr.
Die Zukunft der Entwicklung liegt nicht nur im effizienteren Programmieren, sondern in der Fähigkeit, Strategien zu entwerfen, Systeme zu gestalten und eben diese KIs zu steuern – Aufgaben, die man weder im Alleingang noch ohne Erfahrung bewältigen kann.
Wenn der IT-Arbeitsmarkt hierzulande also nicht zur Sackgasse werden soll, brauchen wir dringend ein Umdenken: weniger Angst davor, dass KI Arbeit schneller erledigt, mehr Mut zu Investitionen in junge Talente. Denn die größte Umwälzung, die uns drohen kann, ist nicht die KI. Es ist das Fehlen der Menschen, die lernen müssen, mit ihr zu arbeiten.
(mdo)
Künstliche Intelligenz
Drei Tage Anwesenheit: Microsoft beordert Angestellte zurück ins Büro
Angestellte von Microsoft müssen wieder mindestens drei Tage pro Woche ins Büro, los geht’s ab Februar für alle, die in und um Redmond bei Seattle nicht mehr als 50 Meilen (80 Kilometer) von einem Standort entfernt wohnen. Das hat Amy Coleman, die Personalleiterin des US-Konzerns, jetzt in einem Memo an die Belegschaft angekündigt. Die Anwesenheitspflicht an der Mehrzahl der Wochentage soll dann in zwei weiteren Schritten erst auf die restlichen Standorte in den USA und später auf jene im Rest der Welt ausgeweitet werden, schreibt Coleman. Das US-Magazin The Verge zitiert anonyme Microsoft-Beschäftigte mit der Einschätzung, dass der Schritt auch zum Ziel haben dürfte, die Belegschaft zu reduzieren. „Es geht nicht um Personalabbau“, versichert die Managerin dagegen.
Rückkehrpflicht gegen den Trend
Die Personalchefin begründet den Schritt mit den „eindeutigen Daten“, wenn Menschen vor Ort zusammenarbeiten, dann seien sie erfolgreicher. Sie wären motivierter, leistungsfähiger und erzielten bessere Ergebnisse. Bei der Entwicklung der KI-Produkte, „die diese Ära definieren“, bräuchte Microsoft die Energie und Dynamik, die entstehe, „wenn kluge Menschen Seite an Seite arbeiten und zusammen Probleme lösen“. Gleichzeitig solle die Flexibilität, die man bei Microsoft wertschätze, nicht aufgegeben werden. Die Betroffenen erhalten demnach jetzt eine personalisierte E-Mail, Ausnahmeregelungen können danach beantragt werden.
Mit dem Schritt verabschiedet sich auch Microsoft jetzt weitgehend von Regelungen, die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt worden waren. Andere US-Konzerne sind bei der Pflicht zur Rückkehr ins Büro schon deutlich weiter, Amazon etwa hat schon für Anfang des Jahres alle Angestellten ins Büro zurückbeordert. Als Hindernis hat sich dabei erwiesen, dass es überhaupt nicht genug Arbeitsplätze für die Beschäftigten gegeben hat. In Deutschland bleibt die Zahl der Angestellten im Homeoffice dagegen stabil, besonders in der IT-Branche arbeiten viele zumindest teilweise von zu Hause. „Prominente Beispiele einzelner Unternehmen, die ihre Beschäftigten zurück ins Büro holen, bleiben Einzelfälle“, hieß es zuletzt vom Wirtschaftsinstitut ifo.
(mho)
Künstliche Intelligenz
Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Nvidias Super-Netzwerktechnik
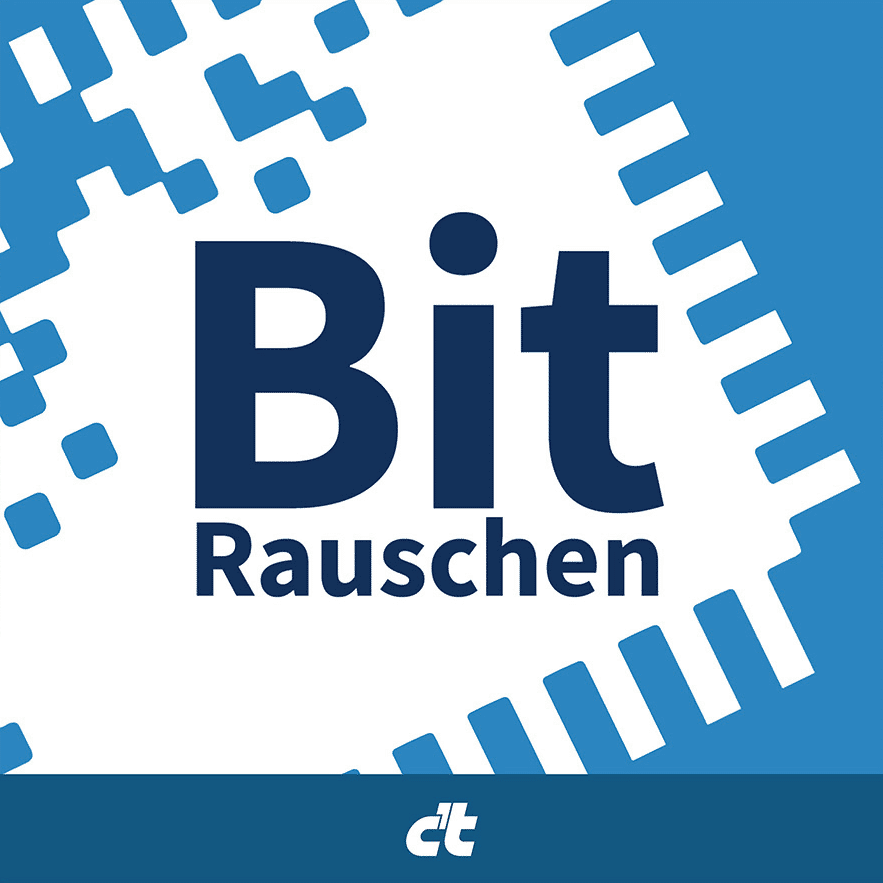
Den Prozessor-Podcast von c’t gibt es jeden zweiten Mittwoch …
Nvidia jagt von einem Umsatzrekord zum nächsten und ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Das liegt vor allem an den starken KI-Beschleunigern, die den aktuellen KI-Hype befeuern.
Doch KI-Chips alleine machen noch kein optimales KI-Rechenzentrum – sonst würden Konkurrenten wie AMD oder Cerebras viel mehr davon verkaufen. Es braucht noch mehr Zutaten, etwa die etablierte Programmierschnittstelle CUDA.
Weniger im Rampenlicht steht eine weitere wichtige Komponente: die Vernetzungstechnik NVLink. Nvidia hat sie geschickt fortentwickelt und tief in die KI-Beschleuniger integriert. Mit InfinityFabric und offenen Ansätzen wie Ultra Ethernet und Ultra Accelerator Link (UAL) wollen die Konkurrenten aufholen.
Was NVLink so besonders macht, erklärt c’t-Redakteur Carsten Spille in Folge 2025/19 von „Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t“.
Podcast Bit-Rauschen, Folge 2025/19 :
Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik zum Bit-Rauschen. Rückmeldungen gerne per E-Mail an bit-rauschen@ct.de.
Alle Folgen unseres Podcasts sowie die c’t-Kolumne Bit-Rauschen finden Sie unter www.ct.de/Bit-Rauschen
(ciw)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 3 Wochen
Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 7 Tagen
Entwicklung & Codevor 7 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events














