Apps & Mobile Entwicklung
Fifa mit Mario für die Switch 2: Mario Smash Football vom GameCube kommt im Juli

Nintendo hat angekündigt, bereits am 3. Juli Mario Smash Football auf die Switch 2 zu bringen. Der Titel stammt ursprünglich vom GameCube und lässt den Spieler diverse Charaktere aus dem Mario-Universum auf dem Rasen gegeneinander positionieren. Voraussetzung ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo.
Mario vs. Yoshi auf dem Rasen
Das Spiel, welches außerhalb Europas auch unter dem Namen Super Mario Strikers bekannt wurde, stammt ursprünglich aus dem Jahr 2005 und damit aus dem Ende des Lebenszyklus des GameCubes. In Smash Football steuert der Spieler ein Fußball-Team gegen ein gegnerisches: In typischer Fußball-Manier muss das Runde also ins Eckige. Dabei stehen wie für ein Mario-Spiel üblich auch Powerups wie rote Panzer zur Verfügung und es gibt damit legale Möglichkeiten, den Gegner zu foulen. Im Spiel treten diverse Figuren aus dem Mario-Universum auf: Yoshi, Luigi, Mario, Peach, Daisy oder auch diverse Toads – Schiedsrichter ist Kritter.
Optik: Wohl deutlich mehr Auflösung
Der Titel erscheint exklusiv auf der Nintendo Switch 2, denn er ist Teil der neuen GameCube-Emulationsumgebung, die Nintendo mittlerweile nur noch „Nintendo Classics“ nennt. Aufgrund dessen handelt es sich auch nicht um einen Remaster, sondern größtenteils um das originale Spiel aus dem Jahr 2005, das im offiziellen Trailer jedoch sichtbar höher auflöst und somit deutlich klarer wirkt. Das Bildmaterial scheint in UHD aufgenommen worden zu sein, eine Auflösung, die von der Switch 2 ebenfalls unterstützt wird. Der GameCube konnte noch maximal 720x480p ausgeben. Welche Änderungen Nintendo im Detail vorgenommen hat, ist unklar.
Voraussetzungen & Kauf
Ein Kauf von Super Mario Strikers für die Switch 2 ist nicht möglich. Spieler können auf das Spiel nur mit einer aktiven Nintendo-Online-Mitgliedschaft + Erweiterungspass zugreifen. Dabei handelt es sich um ein Abo, das in der Basisversion die Online-Funktionen in Spielen freischaltet und der Erweiterungspass liefert zusätzlich verschiedene Nintendo-Klassiker vom GBA, N64, SNES, NES sowie auch dem GameCube auf die Switch (2).
Spieleauswahl noch begrenzt
- The Legend of Zelda: The Wind Waker
- F-ZERO GX
- SOULCALIBUR II
Hier sollte erwähnt werden, dass Nintendo die Spiele zwar lokal auf der Konsole emuliert, jedoch nur Spiele gestartet werden können, die der Konzern zuvor freigegeben hat. ROMs oder gar Speichermedien der Konsolen werden nicht unterstützt, weshalb auf dem GCN-Emulator zurzeit nur drei Titel zu finden sind. Super Mario Strikers bzw. Mario Smash Football wird ab dem 3. Juli die Auswahl ergänzen. Weitere Titel folgen später, hier plant Nintendo unter anderem mit Super Mario Sunshine.
- Super Mario Sunshine
- Fire Emblem: Path of Radiance
- Pokémon XD: Der dunkle Sturm
- Pokémon Colosseum
- Luigi’s Mansion
- Chibi-Robo!
- Mario Smash Football
Apps & Mobile Entwicklung
Nvidia dementiert: AI-Beschleuniger Rubin nicht verspätet, Start weiterhin 2026

Überraschend schnell hat Nvidia auf Gerüchte reagiert, nach denen die nächste AI-Beschleuniger-Generation Rubin verspätet sei. Ein Sprecher von Nvidia dementierte dies umgehend, der Chip und die daraus folgenden Lösungen liegen demnach im Plan. Doch der Plan ist wie üblich auch stets Auslegungssache.
Analysten aus Taiwan hatten gestern berichtet, dass sich Nvidia Rubin um rund ein halbes Jahr verspäten könnte. Demnach sei das Tape-out des Chips zwar schon erfolgt, Nvidia nehme nun aber angeblich Änderungen daran vor, die einem Redesign gleichkommen. Dies könnte den Zeitplan verzögern, spekulierten die Analysten von Fubon Research.
Ein Nvidia-Sprecher dementierte in der Nacht gegenüber US-Medien eine Verschiebung. Rubin liege im Plan, hieß es dabei. Dieser Plan bietet allerdings bekanntlich gewissen zeitlichen Spielraum, denn offiziell hat Nvidia bisher nur verkündet, ab dem zweiten Halbjahr 2026 die ersten Lösungen basierend auf Rubin zu liefern. Unter gewissen Umständen würde dies auch eine Verzögerung von mehreren Monaten mit abdecken können. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Gerüchte über Probleme und Verspätungen bei Nvidias AI-Lösungen einen wahren Kern enthielten.
Das ist Nvidia Rubin (Ultra)
Rubin ist analog zu Blackwell eine 2-Retikel-GPU mit einem schnellen Die-to-Die-Interconnect (10 TB/s bei Blackwell). Rubin bietet 288 GB HBM4 und eine FP4-Leistung von 50 PetaFLOPS, was einer Steigerung um den Faktor 3,3x gegenüber Blackwell Ultra entspricht. In den Racks wird Rubin von der neuen Vera-CPU unterstützt. Die Vera-CPU bietet 88 Custom-Arm-Kerne erstmals mit SMT für 176 Threads und wird mittels NVLink-C2C-Interconnect mit 1,8 TB/s an die GPU angebunden. Zusammen ergibt sich daraus das fertige Rack Vera Rubin NVL144. Das erreicht 3,6 ExaFLOPS für FP4-Inferencing, 1,2 ExaFLOPS für FP8-Training und bietet 20,7 TB HBM4 mit einer Gesamtbandbreite von 13 TB/s. NVLink 6 führt rückseitig alles mit einer Bandbreite von 260 TB/s zusammen.
Ein Jahr später soll im zweiten Halbjahr 2027 die abermals größere Lösung Rubin Ultra mit 4-Retikel-GPU, also mit vier GPUs für jeweils ein Chip-Package folgen. 16 Stapel HBM4e mit insgesamt 1 TB pro Package sind für Rubin Ultra vorgesehen, die Vera-CPU soll hingegen dieselbe wie bei Rubin bleiben.
Apps & Mobile Entwicklung
Powerbanks im Test: 300 Watt Leistung von Anker, Ecoflow, Ugreen und Baseus
Powerbanks von Anker, EcoFlow, Ugreen und Baseus stellen sich dem Test. Mit bis zu 300 Watt Ausgangsleistung, 320 Watt Laden und App-Steuerung sind aktuelle Powerbanks mehr als mobile Energielieferanten. Doch welche Powerbank eignet sich für wen und was erhält man als Käufer für sein Geld? ComputerBase macht den Vergleich.
Powerbanks werden immer leistungsfähiger und bieten inzwischen eine kombinierte Ausgangsleistung von bis zu 300 Watt und nützliche Funktionen wie integrierte, ausziehbare Kabel. Einzelne Geräte lassen sich von den Powerbanks mit bis zu 140 Watt über USB-C versorgen, sodass selbst ausgewachsene Notebooks spielend geladen werden können. Gleichzeitig lassen sie sich auch immer schneller laden und kratzen an der für Flugreisen zulässigen Kapazität von maximal 99,9 Wh. ComputerBase testet vier aktuelle Powerbanks zwischen 20.000 und 27.650 mAh Kapazität mit bis zu 300 Watt Ausgangsleistung. Als Kontrahenten stehen sich Anker, EcoFlow, Ugreen und Baseus gegenüber, wobei die Powerbanks sich in Funktion, Preis und Leistung mitunter erheblich unterscheiden.
Preise der Powerbanks im Vergleich
Als etablierter Platzhirsch tritt die Anker Prime 27650mAh Powerbank 250W den Test an. Sie ist schon länger als die Konkurrenten auf dem Markt erhältlich und muss deshalb noch auf ein ausziehbares USB-C-Kabel verzichten. Im Handel ist sie derzeit ab 147,90 Euro erhältlich.
Zwar bereits mit kabellosen Powerbanks auf den Markt gestartet, steigt EcoFlow als Neuling in den Test der Tower-Powerbanks mit diesen Leistungs- und Kapazitätswerten. Die EcoFlow Rapid Pro Powerbank 27k 300W mit ausziehbarem Kabel ist im Handel ab 139,99 Euro* (eBay) erhältlich.
Mit weniger Kapazität, weniger Leistung und ohne App-Steuerung wird es mit der Ugreen Nexode Powerbank 20k 165W deutlich günstiger. Diese Powerbank ist im Handel derzeit schon ab 62,98 Euro* verfügbar.
Gleiches gilt für die Baseus EnerCore CR11 mit 20.000 mAh, ausziehbarem Kabel und maximal 67 Watt Leistung, die im Handel derzeit ab 59,99 Euro* erhältlich ist. Bei Baseus direkt ist sie aktuell im Angebot inklusive Versand für 52,98 Euro erhältlich.

Rein auf die Energie und den Preis heruntergebrochen, ohne Funktionen und Geschwindigkeit zu berücksichtigen, bietet die Baseus EnerCore CR11 mit 0,83 Euro je Wattstunde knapp vor der Ugreen Nexode Powerbank 20k 165W mit 0,88 Euro je Wattstunde das beste Preis-Energie-Verhältnis. Setzt man 52,98 Euro an, sind es bei der Baseus-Powerbank aktuell sogar nur 0,74 Euro je Wattstunde. Die Anker Prime 27650mAh Powerbank 250W ist nicht nur absolut am teuersten, sondern mit 1,49 Euro auch je Wh.
Technische Daten der Powerbanks im Vergleich
Bevor genauer auf die Funktionen jeder Powerbank einzeln eingegangen wird, werden diese in einer Tabelle kurz gegenübergestellt. Während die Modelle von Anker und EcoFlow beide 99,54 Wh mit 27.650 mAh bieten und ein einzelnes Gerät mit bis zu 140 Watt über USB-C versorgen können, verfügen die Powerbanks von Ugreen und Baseus beide über 72 Wh beziehungsweise 20.000 mAh. Während Ugreen über USB-C Geräte mit bis zu 100 Watt laden kann, ist bei der Powerbank von Baseus hingegen bei 67 Watt die maximale Ausgangsleistung erreicht.
Auch bei den Features gibt es Unterschiede. Zwar zeigen alle vier Powerbanks den Akkustand über ein Display an, nur die Modelle von Anker und EcoFlow bieten aber darüber hinaus auch integrierte Funktechnik für die Verbindung zur Smartphone-App.
Über eine spezielle Tischladestation lässt sich die Powerbank von EcoFlow zudem mit bis zu 320 Watt über Pogo-Pins an der Unterseite der Powerbank aufladen. Anker bietet das bei seiner Powerbank auch, allerdings lädt die Tischladestation die Powerbank nur mit bis zu 100 Watt. Auf den Desktop Charger von EcoFlow, der auch USB-C- und USB-A-Anschlüsse bietet und für den Test bereitstand, wird im weiteren Verlauf noch genauer eingegangen.
Die Anker Prime 27650mAh Powerbank 250W im Detail
250 Watt fürs Flugzeug
Die Anker Prime 27650mAh Powerbank 250W ist bereits 2023 vorgestellt worden, aber derzeit noch das Flaggschiff unter Ankers Powerbanks. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 250 Watt insgesamt und 140 Watt über einen einzelnen USB-C-Anschluss, ist sie in Verbindung mit 99,54 Wh (27.650 mAh) auch für Notebooks bestens geeignet, wenn unterwegs längere Zeit keine Steckdose zur Verfügung stehen sollte. Mit Maßen von 162 × 57 × 49,8 mm und rund 670 Gramm ist sie aber auch kein kleines Leichtgewicht, von hosentaschentauglichen Powerbanks ist auch sie weit entfernt. Ein ausziehbares Kabel besitzt sie noch nicht, Anker liefert ein USB-C-Kabel mit.

Die Anschlüsse sind bei Anker an der Oberseite platziert. Neben zwei USB-C-Ports ist auch ein USB-A-Anschluss verbaut. Beide USB-C-Ports sind bidirektional, können also sowohl zum Entladen als auch Laden der Powerbank genutzt werden. Während ein USB-C-Anschluss einzeln das Aufladen mit bis zu 140 Watt unterstützt, können beide USB-C-Ports zusammen für das Laden mit bis zu 170 Watt genutzt werden, vorausgesetzt die Powerbank ist bereits zu mehr als 55 Prozent geladen.
Beim Entladen liefert jeder der beiden USB-C-Anschlüsse einzeln ebenfalls 140 Watt. Der USB-A-Anschluss kann alleine bis zu 65 Watt bereitstellen. Als Ladeprotokolle werden PD3.1, PPS, QC3.0 und AFC unterstützt. Werden mehrere Anschlüsse gleichzeitig genutzt, reduziert sich die Leistung und ergibt in Summe die maximal genannten 250 Watt. Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Kombinationsmöglichkeiten für das Laden über die Anker-Powerbank.
Maximale Ladeleistung stellt bei der Anker Prime 27650mAh Powerbank 250W somit immer der USB-C1 sicher.
Kontakte für Desktop-Ladegerät
Anker bietet optional ein Tischladegerät für die Powerbank an, die an der Unterseite über Ladekontakte verfügt, an die die Pogo-Pins des Desktop Chargers ansetzen. Dieses Ladegerät lädt die Powerbank mit bis zu 100 Watt auf, ist also langsamer als das Laden über ein leistungsfähiges Netzteil und UBS-C. Zudem muss beachtet werden, dass sich eine vollständig entladene Powerbank nicht über den Desktop Charger laden lässt, sondern zunächst wenigstens etwas über USB-C aufgeladen werden muss.

Design, Display und App-Anbindung
Silbernes Gehäuse, schwarze Front und ein dahinter eingelassenes Display sowie eine Taste an der rechten Seite kennzeichnen die Anker-Powerbank. Über die Taste lässt sich das Display aktivieren. durch mehrfaches Drücken kann man durch die Anzeigen schalten. Neben dem Ladestand kann man sich so die Batteriegesundheit und die Temperatur anzeigen lassen. Auch die Zeit bis zum Ausschalten des Displays und die Bildschirmhelligkeit lassen sich direkt an der Powerbank einstellen.
Schnelles zweifaches Drücken aktiviert Bluetooth, um die Powerbank mit der Anker-App auf dem Smartphone zu verbinden. In der App sieht man die Ladeinfos in Echtzeit, auch in Form eines kleines Diagramms, kann Funktionen zum schonenderen Laden des Akkus mit reduzierter Leistung aktivieren, das zeitlich automatische Aktivieren von Bluetooth einstellen oder eine Suchfunktion mit Warnton in Bluetooth-Reichweite aktivieren.
Auch Firmware-Updates lassen sich über die App einspielen. WLAN unterstützt die Powerbank von Anker nicht, dieses Feature ist im Testfeld einzig der EcoFlow-Powerbank vorbehalten. Zudem kann die Darstellung der Ladeleistung auf dem Display über die App so angepasst werden, dass für jeden Anschluss auch die aktuelle Spannung und Stromstärke angezeigt werden.
Die App ist keine Pflicht, sie ist ein optionales Extra. Die Powerbank funktioniert auch ohne jemals mit der App gekoppelt zu werden.
Die EcoFlow Rapid Pro Powerbank 27k 300W im Detail
99,54 Wh und 300 Watt Gesamtleistung
Die EcoFlow Rapid Pro Powerbank bietet 27.650 mAh, 99,54 Wh, eine Gesamtausgangsleistung von 300 Watt und ein integriertes USB-C-Kabel mit einer Länge von 60 cm. Über dieses und USB-C können maximal 140 Watt einzeln abgerufen werden. Auf USB-A-Ports verzichtet EcoFlow, was es von der Konkurrenz unterschiedet. Mit Abmessungen von 166 × 55 × 58 mm und einem Gewicht von rund 700 Gramm ist die EcoFlow Rapid Pro auch das größte und schwerste Modell im Test. Mit 99,54 Wh darf die Powerbank auch im Handgepäck im Flugzeug mitgeführt werden.

Insgesamt stehen drei USB-C-Ports und ein USB-C-Kabel bereit. Kabel und USB-C2 liefern je 140 Watt, USB-C3 und USB-C4 jeweils bis zu 65 Watt. Letztere sind nur als Ausgänge konfiguriert, die ersten beiden auch als Eingänge. Werden USB-C1 und -C2 zusammen genutzt, stehen maximal 280 Watt zur Verfügung, nutzt man drei oder alle vier Anschlüsse, liefert die Powerbank bis zu 300 Watt Gesamtleistung. Als Ladeprotokolle werden PD3.0, PPS, QC3.0, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, SCP, FCP und UFCS unterstützt.
Liefern USB-C1 und -C2 bei gleichzeitiger Nutzung je 140 Watt, stehen über USB-C3 und -C4 bei gleichzeitiger Nutzung zusammen nur 20 Watt zur Verfügung. Nutzt man hingegen C1 und C3 oder C2 und C4, werden 140 Watt und 65 Watt bereitgestellt. Die genauen Ladeoptionen bei allen Konfigurationen zeigt nachfolgende Tabelle.
Laden mit bis zu 320 Watt
Ebenfalls hervorzuheben ist die Ladeleistung der EcoFlow-Powerbank. Über zwei USB-C-Ports kann zusammen mit 280 Watt geladen werden. Über das Rapid Pro Desktop-Ladegerät* mit Pogo-Pins kann aber sogar mit bis zu 320 Watt geladen werden.
Im Test ließen sich tatsächlich 318 Watt erreichen. Die 320 Watt entsprechen auch der maximalen Gesamtausgangsleistung des Desktop-Ladegeräts, das insgesamt sechs Anschlüsse bietet. Zu den Pogo-Pins für die eigenen Powerbanks gesellen sich nämlich noch vier USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Anschluss.

Aufbau und Anschlüsse
Bei der EcoFlow-Powerbank sind drei USB-C-Anschlüsse an der Oberseite platziert. Ihre Beschriftung klärt über maximale Leistung und ob sie bidirektional genutzt werden können auf. Das ausziehbare USB-C-Kabel ist an der Rückseite unten platziert. Es rastet beim Herausziehen an mehreren Stellen ein, muss also nicht immer ganz ausgefahren werden. An der Unterseite der Powerbank sind die Ladekontakte für die Pogo-Pins des Desktop Chargers.
In der schwarzen Vorderseite ist ein Display integriert, das sich über die untere Taste an der rechten Seite der Powerbank aktivieren lässt. Die beiden Pfeiltasten darüber dienen zum Durchschalten der Menüs, mit der Power-Taste werden Einträge ausgewählt. Neben dem Ladestand der Powerbank werden auf dem Display auch die Temperatur, Anzahl der Zyklen und die aktuelle Ein-/Ausgangsleistung je Port angezeigt. In den Einstellungen lässt sich über das Display WLAN und Bluetooth aktivieren, die Ladeleistung begrenzen, die Helligkeit des Bildschirms und dessen Timeout konfigurieren.
Die Verarbeitung der EcoFlow-Powerbank ist hervorragend.
Display und App-Anbindung
Mit integriertem WLAN und Bluetooth kann die EcoFlow Rapid Pro Powerbank 27k 300W mit der EcoFlow-App verbunden werden. Die App unterstützt Funktionen wie eine Leistungsüberwachung je Port inklusive Port-Spannung, Stromstärke und Leistung, Firmware-Aktualisierungen, Lade- und Entladegrenzen und Display-Einstellungen inklusive individueller Bildschirmschoner, die sich durch Zeichnen oder das Hochladen von Bildern gestalten lassen. Hier bietet EcoFlow erneut viele Möglichkeiten und Einsichten.
Verbindet man die Powerbank nicht mit der App und deaktiviert Bluetooth und WLAN, hat dies auf die Funktion der Powerbank keinerlei Einfluss.
Auch das Rapid Pro Desktop-Ladegerät kann mit der App verbunden werden und zeigt ebenso zahlreiche Statistiken für jeden Port und bietet Optionen zur Anpassung der Anzeige.
Die Ugreen Nexode Powerbank 20k 165W im Detail
72 Wh mit 100 Watt über ausziehbares Kabel
Die Ugreen Nexode Powerbank 20.000mAh 165W besitzt ein ausziehbares USB-C-Kabel mit einer Länge von 65 cm und kann über dieses und den zusätzlichen USB-C-Anschluss einzelne Geräte mit bis zu 100 Watt laden. Das Kabel mit USB-C-Stecker kann auf fünf unterschiedliche Längen arretiert werden. Die Kapazität beträgt, wie der Name schon sagt, 20.000 mAh beziehungsweise 72 Wh.

Das USB-C-Kabel ist in die Oberseite eingelassen und lässt sich dort etwas schlechter entnehmen als das USB-C-Kabel bei der Powerbank von EcoFlow. Der Stecker hält magnetisch in der Mulde, sodass er nicht herausragt und Gefahr läuft beschädigt zu werden. Neben dem USB-C-Kabel und dem USB-C-Anschluss ist an der Oberseite ein USB-A-Port platziert. Kabel und USB-C-Port können zum Laden und Entladen der Powerbank genutzt werden – in beide Richtungen und je Port mit bis zu 100 Watt. Die Powerbank kann jedoch nicht über beide USB-C-Anschlüsse gleichzeitig geladen werden. Über USB-A stehen maximal 22,5 Watt zur Verfügung, die 33 Watt aus der Ankündigung der Powerbank erweisen sich im Test als falsch.
Zwei Geräte wie Notebook und Smartphone können über das Kabel und den zusätzlichen USB-C-Anschluss gleichzeitig mit bis zu 100 + 65 Watt geladen werden.
Als Ladeprotokolle werden PD3.0, PPS, QC4.0, SCP, FCP, Apple 2.4A, BC1.2 und AFC unterstützt. Durch circa 3 Sekunden langes Drücken der Taste der Powerbank lässt sich ein sogenannter Erhaltungslademodus – gemeint ist ein Low Current Modus, bei dem nur eine geringe Stromstärke abgerufen wird – aktivieren, der die Ausgangsleistung für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch anpasst und hier für eine optimale Kompatibilität sorgt.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Ladeleistung der Powerbank je nach Anzahl der genutzten Anschlüsse.
Sobald man den USB-C- und USB-A-Anschluss zusammen nutzt, reduziert sich ihre Leistung auf jeweils 10 Watt. Dies sollte somit, möchte man schneller laden, vermieden werden.
Design und Display
Die 146 × 54 × 50 mm große Powerbank wiegt mit 530 Gramm deutlich weniger als die beiden stärkeren Powerbanks von Anker und EcoFlow. Auch ihre Verarbeitung ist hervorragend und gibt keinen Anlass für Kritik. Beim Design setzt auch sie auf das Tower-Design mit schwarzer Abdeckung, unter der sich ein Display verbirgt. Allerdings nimmt die schwarze Abdeckung nur einen Teil der Front ein. Das Display wird über eine einzelne Taste an der rechten Seite aktiviert, durch häufigeres Drücken wird auch bei Ugreen durch die Ansichten geschaltet. Neben dem Ladestand der Powerbank und der Ein-/Ausgangsleistung der Anschlüsse lässt sich auf eine zweite Ansicht wechseln, in der die Spannung und Stromstärke der Anschlüsse zusammen mit einem kleinen Verlaufsdiagramm ausgegeben wird.
Optionen die Anzeige anzupassen, die Helligkeit des Displays zu ändern oder die Powerbank mit einer App zu verbinden, gibt es bei der Ugreen Nexode Powerbank 20k 165W nicht.
Die Baseus EnerCore CR11 20k Powerbank im Detail
Die kompakteste Powerbank im Testfeld
Die Baseus EnerCore CR11 mit 20.000 mAh, 72 Wh, ausziehbarem Kabel mit 70 cm Länge und maximal 67 Watt Ausgangsleistung verfolgt hingegen eher den Ansatz einer klassischen Powerbank ohne viele Extras und Spielereien. Mit 145 × 69 × 27,5 mm und 393 Gramm Gewicht ist sie die kleinste und leichteste Powerbank im Testfeld, die zudem eher dem klassischen Powerbank-Brick entspricht. Eine Taste an der rechten Seite dient zum Ein- und Ausschalten der Powerbank und zum aktivieren des Displays.
Das längste USB-C-Kabel
Sie verfügt wie erwähnt über ein integriertes USB-C-Ladekabel, das 70 cm lang ist und wie bei Ugreen in die Oberseite eingelassen ist. Es arretiert beim Herausziehen in mehreren Zwischenschritten. Maximale Ausgangsleistung des USB-C-Kabels beträgt 67 Watt, die Eingangsleistung über das Kabel beträgt maximal 45 Watt. Gleiches gilt auch für den zusätzlichen USB-C-Anschluss, der daneben an der Oberseite platziert ist. Auch er ist bidirektional mit identischen Leistungswerten ausgelegt. Auf einen USB-A-Anschluss verzichtet Baseus gänzlich.
Nur 15 Watt bei gleichzeitiger Nutzung
Bietet jeder Port alleine bis zu 67 Watt, reduziert sich die Leistung bei Nutzung beider Anschlüsse erheblich. Dann werden nur noch 15 Watt unterstützt. Aber nicht je Port, sondern insgesamt. Wie sich die Leistung aufteilt, entscheiden die Geräte. Auffällig bei der Nutzung beider Ports is zudem, dass das Laden am jeweils anderen Port immer kurz unterbrochen wird, wenn man ein zweites Gerät anschließt, selbst wenn die Ladeleistung bei weniger als 15 Watt liegt. Wer ein dazu fähiges Gerät schnell laden möchte, sollte deshalb darauf achten, dass währenddessen nur ein Port genutzt wird.
Auch die Baseus EnerCore CR11 20k Powerbank bietet einen Niedrigstrommodus, der die Kompatibilität mit Smartwatches und Kopfhörern erhöht. Um diesen zu aktivieren, muss die Taste der Powerbank zweimal hintereinander gedrückt werden. Dass der Modus aktiv ist, zeigt sich an einer animierten Darstellung der letzten Ziffer des Ladestands auf dem Display.
Display mit wenigen Funktionen
Apropos Display: Das integrierte Display der Baseus-Powerbank zeigt den Batterieladestand in Prozent an, mehr aber nicht. Informationen zur gerade abgerufenen Ausgangsleistung werden dem Nutzer nicht angezeigt, auch Informationen zur Restlaufzeit oder Restladezeit fehlen. Das Display ist eine reine Akkustandsanzeige – abgesehen vom eben genannten Niedrigstrommodus.
Extras wie eine Begrenzung der Ladeleistung, Ladegrenzen, App-Anbindung, Gesundheits- und Temperaturanzeigen sucht man bei der EnerCore CR11 20k somit vergebens. Sie konzentriert sich auf ihre primäre Aufgabe: Das Laden von Geräten.
Kapazität und Effizienz im Praxistest
Für alle vier Powerbanks testet ComputerBase, wie viel der gespeicherten Energie sie bei unterschiedlichen Laststufen aus ihnen entnehmen lässt – und wie viel für das Aufladen der leeren Powerbank wieder notwendig ist. Das Laden und Entladen ist immer mit Verlusten behaftet, die Elektronik kann jedoch unterschiedlich effizient arbeiten.

Für die Messungen wird noch eine weitere Powerbank in den Test aufgenommen, das bereits länger erhältliche 200-Watt-Modell von Ugreen, das auf ein integriertes, ausziehbares Kabel noch verzichten muss. Die Ugreen Nexode Powerbank 25000mAh 200W mit 25.000 mAh beziehungsweise 90 Wh ist im Handel derzeit ab 70 Euro erhältlich und reiht sich bei Leistung und Kapazität in der Mitte der vier Testkandidaten ein.
Bei höheren Ausgangsleistungen weisen alle Powerbanks einen höheren Wirkungsgrad auf. Mit bis zu 88,5 und 85,8 Prozent gehen Baseus und Ugreen mit ihren Powerbanks als Sieger hervor. Anker stellt aus seiner Powerbank sowohl bei 15 als auch 90 Watt etwas mehr Energie bereit als EcoFlow. Ob hierfür auch mehr Energie reingesteckt wird, klärt die nächste Betrachtung.
Denn wichtig ist immer auch, wie viel Energie in die Powerbank beim Laden gesteckt werden muss, denn der kumulierte Verlust aus Laden und Entladen ist am Ende entscheidend.
In der nachfolgenden Tabelle wird nun noch einmal die tatsächlich geladene und entladene Energie gegenübergestellt. Hierfür werden die gemessenen Energiemengen bei 90 Watt Last (Baseus 67 Watt) herangezogen.
Stellt man die hineingesteckte und entnommene Energie gegenüber, landen alle Powerbanks ungefähr bei einem Wirkungsgrad von 80 Prozent. Je nach Leistung, die man den einzelnen Modellen abverlangt, schwanken die Werte etwas, sodass am Ende gesagt werden muss, dass die Lade- und Entladeeffizienz allein bei keinem dieser Modelle den Ausschlag für den Kauf geben sollte.
Fazit
Vor dem Hintergrund, dass alle Powerbanks ihre Spezifikationen erfüllen, das liefern, was sie versprechen, und die Effizienz insgesamt betrachtet keinen gravierenden Unterschied bedeutet, sei die Eingangs aufgestellte Tabelle noch einmal ins Gedächtnis gerufen, die Preise und Preis je Wattstunde gegenüberstellt.
Am Ende des Tests zeigt sich nämlich, dass der Preis pro Wattstunde ziemlich genau mit der Leistung, dem Funktionsumfang und den Extras korreliert. Wer in erster Linie eine Powerbank sucht, die ein einzelnes Gerät unterwegs zuverlässig lädt, macht mit der Baseus EnerCore CR11 nichts falsch, erhält aber auch nicht mehr als er bezahlt. Wer mehr Leistung, mehr Funktionen und mehr Extras bei gleicher Kapazität möchte, muss bei der Ugreen Nexode Powerbank 20k 165W dafür eben auch einen Aufpreis zahlen.
Sieht man sich die beiden Flaggschiffe an, die Anker Prime 27650mAh Powerbank 250W und die EcoFlow Rapid Pro Powerbank 27k 300W, so ist der Aufpreis je Wattstunde deutlich. Dafür bieten die Powerbanks aber nicht nur eine deutlich höhere Ladeleistung für diese Wattstunden, sondern auch weit mehr Extras und Funktionen. Mehr Informationen auf dem Display, mehr Einstellungsmöglichkeiten, eine höhere kombinierte Ladeleistung und auch eine App-Anbindung über Bluetooth (Anker und EcoFlow) und sogar über WLAN (nur EcoFlow).
Auf dem umkämpften Markt der Powerbanks gilt somit: Man bekommt nichts geschenkt und ein Aufpreis hat mehr Leistung und Funktionen zur Folge, während ein Preisabschlag weniger Leistung und Funktionen bedeutet. So bietet der Markt aber auch für jeden Käufer das passende Modell – auch abseits der Testkandidaten.
Im direkten Duell zwischen Anker und EcoFlow um die Powerbank-Krone muss ihr unterschiedlicher Veröffentlichungszeitpunkt berücksichtigt werden. Denn es ist davon auszugehen, dass Anker auch bald mit einem neuen, leistungsfähigeren Modell nachziehen wird.

Dennoch ist das, was EcoFlow mit der ersten eigenen Powerbank dieser Art auf die Beine stellt, sehr beachtenswert. Die Leistung ist enorm, das Schnellladen mit 320 Watt über den Desktop Charger nicht nur sehr beeindruckend, sondern die Powerbank ist tatsächlich in ungeahnter Geschwindigkeit wieder voll aufgeladen. Aber selbst ohne diesen kann man über zwei leistungsfähige Netzteile 280 Watt in die Powerbank schicken. Mit ihrem günstigeren Preis ist die EcoFlow Rapid Pro Powerbank 27k 300W deshalb derzeit die High-End-Powerbank der Wahl. Und mit der EcoFlow Rapid Pro X Powerbank (27.650 mAh, 300 Watt) mit Erweiterungsmodulen und noch mehr Extras steht das eigentliche Flaggschiff von EcoFlow erst noch an.
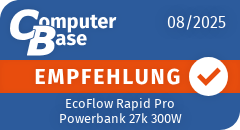
ComputerBase hat die Anker Prime 27650mAh Powerbank 250W, EcoFlow Rapid Pro Powerbank 27k 300W, Ugreen Nexode Powerbank 20k 165W und Baseus EnerCore CR11 20k von Anker, EcoFlow, Ugreen und Baseus zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
Apps & Mobile Entwicklung
Telekom T Phone 3 und T Tablet 2: Smartphone und Tablet mit KI-Assistent und Perplexity Pro

Das neue Smartphone der Telekom steht unter dem Zeichen AI und die Telekom bezeichnet es als „KI-Phone“ – in den Handel kommt es aber als T Phone 3. Der integrierte KI-Assistent von Perplexity soll Nutzer bei bei Alltagsfragen unterstützen. Der Verkauf startet ab sofort ab 149 Euro. Auch ein KI-Tablet alias T Tablet 2 startet.
18 Monaten Perplexity Pro integriert
Der Einstiegspreis von 150 Euro beinhaltet 18 Monaten Perplexity Pro, so dass hierfür in dieser Zeit keine zusätzlichen Kosten anfallen. Der Perplexity-Assistent bleibt dauerhaft auf den Geräten. Der Kauf des Smartphones beinhaltet zudem eine 3-monatige Picsart-Pro-Lizenz mit 500 zusätzlichen Credits pro Monat für Avatare.
Der Perplexity-Assistent soll nicht nur auf alltägliche Fragen Antworten liefern, sondern auch bei Aufgaben wie dem Verfassen von E-Mails. Kalendereinträgen, Übersetzungen von Dokumenten oder Gesprächen, dem Planen von Reiserouten und dem Erstellen von Ernährungs- und Trainingsplänen helfen. Auch Objekte vor der Kamera können an den KI-Assistenten geschickt werden, um hierzu Fragen zu stellen. Für diese Funktionalität kann der Assistent nicht nur auf das Internet zurückgreifen, sondern auf dem Smartphone sind auch Schnittstellen zu vorinstallierten Apps konfiguriert.

Bedient wird Perplexity, indem der Power Button des T Phone 3 zweimal gedrückt oder das Magenta-AI-Symbol auf dem Sperrbildschirm kurz gedrückt gehalten wird. Die Anfragen können sowohl mündlich als auch schriftlich gestellt werden.
Details zum T Phone 3
Das T Phone 3 bietet ein 6,6 Zoll großes Full-HD+-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate. Es setzt auf den Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 3 Prozessor und verfügt über einen internen Speicher von 128 GB und 6 GB RAM. Eine Speichererweiterung mit einer microSD-Karte ist möglich. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und kann mit bis zu 25 Watt geladen werden. Neben 5G, GPS und NFC wird auch eine 3,5-mm-Audiobuchse geboten. An der Rückseite sind zwei Kamerasensoren mit einem LED-Blitz zu sehen, die Telekom spricht pauschal von einer 50-Megapixel-Kamera. Das Smartphone ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Neben einer Nano-SIM wird auch eine eSIM unterstützt. Als Betriebssystem kommt Android in einer nicht näher spezifizierten Version zum Einsatz.
Eine Pro-Version des T Phone 3 soll im Laufe des Jahres folgen. Im letzten Jahr hatte die Deutsche Telekom unter dem Namen T Phone 2 (Test) ein Einsteiger-Smartphone auf den Markt gebracht.
Details zum T Tablet 2
Mit dem T Tablet 2 legt die Deutsche Telekom auch das eigene Tablet für 199 Euro neu auf. Auch beim Tablet sind 18 Monaten Perplexity Pro inklusive. Das 5G-Tablet mit 10,1-Zoll-Display bietet ebenfalls 128 GB Speicher und 6 GB RAM. Der Speicher kann auch beim Tablet mit einer microSD-Karte erweitert werden. Als SoC dient ein MediaTek Dimensity MT8755 mit 8 Kernen. Auch das Tablet bietet A-GPS, GPS-Empfänger, Galileo und Glonass. Auf NFC muss jedoch verzichtet werden. Neben einer Nano-SIM kann auch im Tablet eine eSIM genutzt werden. Der Akku bietet eine Kapazität von 6.000 mAh.
Beim Display kommt die Bildschirmtechnologie NXTPAPER von TCL zum Einsatz, die eine blendfreie Darstellung mit adaptive Farbtemperatur und Helligkeit bietet. Drei integrierte Bildschirmmodi (Tintenpapier, Farbpapier und Standardmodus) sollen je nach Einsatzzweck die Darstellung optimieren. Ein T-Pen zum Schreiben und Zeichnen ist separat für 29,95 Euro erhältlich.
Das KI-Phone und das KI-Tablet sind nicht nur in Deutschland erhältlich, sondern auch in Griechenland, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn.
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Online Marketing & SEOvor 2 Monaten
Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 2 Monaten
Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen



































































