Künstliche Intelligenz
Oakley Meta HSTN: Erste KI-Sportbrille vorgestellt
Meta erweitert sein „Smart Glasses“-Portfolio: Auf die erfolgreiche Brille von Ray-Ban folgt eine Kooperation mit Oakley. Das erste Produkt hört auf den Namen „Oakley Meta HSTN“ und basiert auf den HSTN-Modellen des Brillenherstellers.
Die erste Oakley Meta HSTN erscheint als Limited Edition, mit der Oakley sein 50-jähriges Bestehen feiert. Die Limited Edition soll ab dem 11. Juli für 549 Euro vorbestellbar sein.
Die Brille kommt mit goldenen Akzenten und polarisierten Prizm-Gläsern. Prizm ist eine von Oakley entwickelte Glastechnologie, die je nach sportlichem Einsatzgebiet Farben, Kontrast und Details der Umgebung verbessern soll.

Die Limited Edition der Oakley Meta HSTN.
(Bild: Oakley / Meta)
Die restliche Kollektion soll im Laufe des Sommers zu einem Startpreis von 439 Euro auf den Markt kommen. Sie umfasst sechs Rahmen- und Gläserkombinationen, die allesamt mit Korrekturgläsern ausgestattet werden können. Brillenträger werden allerdings wie schon bei den Ray-Ban Meta-Brillen einige Dinge beachten müssen.
Die Oakley Meta HSTN erscheint in allen Ländern, in denen auch die Ray-Ban Meta-Brille erhältlich ist, mit Ausnahme von Mexiko, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die Markteinführung im Laufe des Jahres folgen soll.
Bessere Videoqualität und Akkuleistung
Technisch bringt die Oakley Meta HSTN alle Funktionen der Ray-Ban Meta-Brille mit. Beide Smart Glasses verfügen über einen integrierten Kamerasensor, mit dem sich Fotos und Videos aufnehmen sowie Livestreams übertragen lassen. Mikrofone ermöglichen Telefongespräche und die Nutzung von Sprachbefehlen, während Open-Ear-Lautsprecher Musik und Podcasts in guter Qualität wiedergeben. Zudem sind verschiedene KI-Funktionen integriert, darunter eine Echtzeit-Übersetzung sowie die Möglichkeit, Meta AI Fragen zur sichtbaren Umgebung zu stellen. Für viele dieser Features ist ein gekoppeltes Smartphone sowie die Begleit-App Meta AI erforderlich.
Die Smart Glasses von Oakley sind etwas teurer als die Varianten von Ray-Ban, die ab 329 Euro erhältlich sind. Der höhere Preis dürfte unter anderem auf technische Verbesserungen zurückzuführen sein. Die Oakley Meta HSTN bietet einen höherwertigen Sensor, der Videos in 3K-Auflösung aufnimmt. Die Ray-Ban Meta-Brille zeichnet Videos mit 1.440 × 1.920 Pixeln auf.
Zudem wurde die Akkuleistung verbessert. Die Ray-Ban-Brillen hält bei moderater Nutzung vier Stunden durch, bevor sie im Lade-Etui wieder aufgeladen werden muss. Die Oakley-Modelle hingegen erreichen laut Meta im Normalbetrieb bis zu acht Stunden. Sie wird mit einem Ladecase geliefert, das eine Akkulaufzeit von bis zu 48 Stunden ermöglicht. Das Lade-Etui der Ray-Ban Meta-Brille kommt auf 32 Stunden.
In puncto Wasserresistenz ändert sich trotz Sportfokus nichts: Die Oakley Meta HSTN bietet wie die Ray-Ban Meta-Brille Spritzwasserschutz nach IPX4-Standard.
Google und Apple wollen mitmischen
Die Meta-Brille von Ray-Ban kam im Herbst 2023 auf den Markt und entwickelte sich zu einem Verkaufshit. Anfang des Jahres meldete Metas Partner EssilorLuxottica, dass über zwei Millionen Geräte verkauft wurden. EssilorLuxottica ist ein führender Brillenhersteller und Eigentümer der Marken Ray-Ban und Oakley.
Der Erfolg der Smart Glasses rief andere Techgrößen auf den Plan, die inzwischen an vergleichbaren Produkten arbeiten. Google zeigte vor einigen Wochen einen Prototyp mit Heads-up-Display und will gemeinsam mit den Brillenpartnern Gentle Monster und Warby Parker erste Produkte entwickeln, die Metas Smart Glasses ähneln. Wann diese auf den Markt kommen sollen, ist nicht bekannt. Auch Apple soll an Smart Glasses arbeiten und peilt laut Bloomberg eine Markteinführung im nächsten Jahr an.

Wie bei den Ray-Ban Meta-Brillen stehen auch bei diesem Modell verschiedene Kombinationen aus Rahmen und Gläsern zur Auswahl.
(Bild: Oakley / Meta)
Das neu entfachte Interesse der großen Techunternehmen an Smart Glasses lässt sich nicht allein durch den Verkaufserfolg der Ray-Ban Meta-Brille erklären und muss im breiteren Kontext der KI-Entwicklung gesehen werden. Smart Glasses werden als potenziell ideale Hardware-Plattform für KI-Assistenz gehandelt. Da sie theoretisch permanent erfassen können, was die Nutzer sehen, eignen sie sich besonders gut, um im Alltag kontextbezogene Unterstützung zu bieten. Durch die Integration von Heads-up-Displays und – irgendwann – vollwertiger Augmented Reality könnten sie sich langfristig als unverzichtbare Ergänzung zum Smartphone etablieren.
Metas Smart Glasses verfügen bislang über kein integriertes Display, doch laut Bloomberg könnte das Unternehmen bereits im Herbst eine Brille mit Anzeige auf den Markt bringen.
(tobe)
Künstliche Intelligenz
Universum to go: KI-Software emuliert kosmische Physik auf Notebooks
Ein internationales Team von Physikern hat eine Software namens Effort.jl veröffentlicht, die das Spielfeld der computergestützten Kosmologie verändern könnte. Die Kernfunktion des Programms: Simulationen der Entwicklung des Universums, die bislang monatelange Rechenzeit auf Cluster-Systemen wie dem SuperMUC-NG am Leibniz-Rechenzentrum in Garching beanspruchten, laufen damit in wenigen Minuten auf einem gewöhnlichen Notebook ab.
Ihre Ergebnisse hat die Gruppe um den Physiker Marco Bonici von der University of Waterloo im kanadischen Ontario im Fachmagazin Journal of Cosmology and Astroparticle Physics publiziert. Die Arbeit entstand in einer Kooperation, an der auch das Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in Italien beteiligt war.
Ein Emulator ahmt die Physik nach
Bei Effort.jl handelt es sich um einen sogenannten Emulator. Stellen sie sich vor, sie wollen nicht die komplette, komplexe Physik des Kosmos mit all ihren unzähligen Interaktionen von Grund auf berechnen. Stattdessen trainieren sie ein Modell darauf, das Ergebnis dieser Berechnungen bei gegebenen Anfangsbedingungen möglichst exakt vorherzusagen.
Genau das macht die Software. Sie imitiert das Verhalten eines der etabliertesten Modelle der modernen Kosmologie, der „Effektiven Feldtheorie der großräumigen Strukturen“ (EFTofLSS). Dieses beschreibt, wie sich Galaxien und Dunkle Materie zu einem riesigen, fadenartigen Netz anordnen, das wir als das kosmische Netz kennen.
Das Herzstück des Emulators ist ein neuronales Netz. Der entscheidende Kunstgriff des Teams war es jedoch, diesem Netz vorab grundlegendes physikalisches Wissen mitzugeben. Die Software lernt also nicht bei null, sondern weiß bereits, wie sich die Ergebnisse verändern, wenn kosmologische Parameter wie die Menge an Dunkler Energie justiert werden. Dieser hybride Ansatz reduziert den Trainingsaufwand und die benötigte Rechenleistung drastisch.
Open Source in Julia geschrieben
Entwickler dürften aufhorchen, wenn sie hören, dass das Werkzeug in der relativ jungen Programmiersprache Julia geschrieben wurde. Julia ist speziell für hochperformante wissenschaftliche und numerische Berechnungen konzipiert. Der gesamte Quellcode von Effort.jl ist zudem auf Github frei zugänglich.
Der praktische Nutzen ist immens. Die Astrophysik steht vor einer Datenflut durch neue Instrumente wie das Weltraumteleskop Euclid der Europäischen Raumfahrtagentur ESA oder das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) in den USA. Die Analyse dieser Petabyte an Informationen mit traditionellen Methoden wäre extrem zeit- und kostenintensiv. Effort.jl positioniert sich hier als ein entscheidendes Werkzeug, um diese Analysen effizienter und für eine breitere wissenschaftliche Gemeinschaft zugänglich zu machen.
Die Grenzen der Abkürzung
So vielversprechend der Ansatz ist, hat er doch klare Grenzen. Ein Emulator ist immer eine Annäherung an die Realität, keine exakte Abbildung. Er kann nur innerhalb der Parameter verlässliche Ergebnisse liefern, für die er trainiert wurde.
Das System wird also keine völlig neuen physikalischen Phänomene entdecken, die nicht bereits im zugrundeliegenden EFTofLSS-Modell enthalten sind. Seine Stärke liegt in der extrem schnellen Überprüfung von Hypothesen innerhalb eines bekannten Rahmens. Für die Grundlagenforschung, die über die Grenzen der etablierten Modelle hinausblickt, bleiben Supercomputer unverzichtbar.
Dieser Beitrag ist zuerst auf t3n.de erschienen.
(jle)
Künstliche Intelligenz
Spione können sich jetzt übers Darknet beim Britischen Geheimdienst bewerben
Der britische Geheimdienst MI6 will Spione, vorzugsweise aus Russland, über eine neu gestartete Nachrichtenplattform namens Silent Courier im Darknet anwerben. Laut dem britischen Außenministerium sollen potenzielle Informanten über die Plattform sicherer und leichter mit Großbritannien Kontakt aufnehmen können als bisher.
Personen sollen mittels Silent Courier vertrauliche Nachrichten und Informationen über feindliche Geheimdienste oder zu Terrorismus anonym weitergeben können. Wie man sicher auf die Plattform gelangt, soll der offizielle YouTube-Kanal des MI6 verraten.
Auf dem Kanal findet man nicht nur zwei an einen James-Bond-Film erinnernde Promovideos zu Silent Courier, sondern auch Anleitungsvideos in acht verschiedenen Sprachen – darunter Russisch. Sie erklären, wie man auf das Portal zugreifen kann, etwa per VPN oder Tor-Browser. Die lange Onion-Adresse befindet sich auch jeweils in der Beschreibung eines jeden Videos.
Der Text warnt eindringlich davor, private Computer, Smartphones oder generell solche Geräte zu verwenden, die mit der eigenen Identität assoziiert werden können. Stattdessen empfiehlt das MI6 neue und nicht personalisierte Geräte und eine eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse.
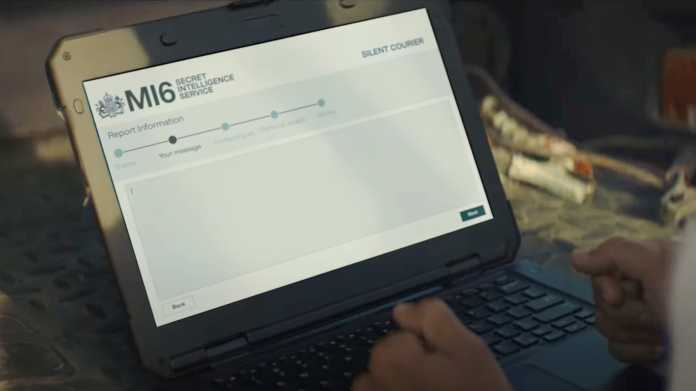
So soll das Portal Silent Courier laut YouTube-Video des MI6 aussehen.
(Bild: YouTube / MI6 – Secret Intelligence Service)
JavaScript erforderlich
Dabei fiel uns auf, dass Silent Courier zum Betrieb zwingend JavaScript benötigt. Der sichere heise-Briefkasten etwa, der die Webanwendung SecureDrop für anonyme Tipps verwendet, lässt sich aus Sicherheitsgründen nicht mit aktiviertem JavaScript aufrufen. Wie sicher Silent Courier ist, lässt sich freilich nicht einschätzen.
Bereits 2023 versuchte der US-amerikanische Geheimdienst auf ähnliche Weise, neue Spione zu rekrutieren. Die britische Außenministerin Yvette Cooper erklärt nun, Großbritannien unterstütze die Bemühungen des MI6, mithilfe modernster Technologie neue Spione für das Land zu rekrutieren – in Russland und auf der ganzen Welt.
(aki)
Künstliche Intelligenz
KI entwickelt erstmals Viren – und sie können bereits Bakterien töten
Künstliche Intelligenz (KI) kann Katzenbilder zeichnen, Krankheiten voraussagen und Phishing-Mails schreiben. Jetzt kann dieselbe Technologie ein funktionierendes Genom zusammenstellen. Kalifornische Forscher von der Stanford University und dem gemeinnützigen Arc Institute haben eine KI neue genetische Codes für bakterienfressende Viren vorschlagen lassen. Mehrere dieser sogenannten Bakteriophagen waren tatsächlich vermehrungsfähig und töteten auch Bakterien. Die Wissenschaftler sagen, dass die Keime mit KI-geschriebener DNA „das erste generative Design vollständiger Genome“ darstellten.
„Beeindruckender erster Schritt“ hin zu KI-gestalteten Lebensformen
Die in einem Preprint-Artikel beschriebenen Ergebnisse, die den wissenschaftlichen Gutachterprozess noch nicht durchlaufen haben, könnten neue Behandlungsmethoden schaffen und die Forschung an künstlich hergestellten Zellen beschleunigen. Es ist auch ein „beeindruckender erster Schritt“ in Richtung KI-gestalteter Lebensformen, sagt Jef Boeke von der NYU Langone Health, der nicht an der Veröffentlichung beteiligt war.
Dem Biologen zufolge ist die Leistung der KI überraschend gut; ihre Ideen seien unerwartet. Es gab „Viren mit neuen Genen, mit verkürzten Genen und sogar mit unterschiedlichen Genreihenfolgen und -anordnungen“, so Boeke weiter. Allerdings handelt es sich hierbei noch nicht um KI-gestaltetes Leben. Das liegt daran, dass Viren nicht lebendig sind. Sie sind eher wie abtrünnige Teile des genetischen Codes mit relativ schwachen, einfachen Genomen.
In der neuen Arbeit versuchten Forscher des Arc Institute, Varianten eines Bakteriophagen – eines Virus, das Bakterien infiziert – namens phiX174 zu entwickeln, der nur 11 Gene und etwa 5000 DNA-Buchstaben hat. Dafür nutzten sie zwei Versionen einer KI namens Evo, die nach den gleichen Prinzipien funktioniert wie große Sprachmodelle, etwa ChatGPT. Anstatt die Modelle mit Lehrbüchern und Blogbeiträgen zu füttern, trainierten die Wissenschaftler sie mit den Genomen von etwa zwei Millionen anderen bakterienfressenden Viren.
KI erstellte 302 Genome für Viren
Aber würden die von der KI vorgeschlagenen Genome überhaupt Sinn ergeben? Um dies herauszufinden, druckten die kalifornischen Forscher 302 der Genomdesigns der Software chemisch als DNA-Stränge aus und mischten diese dann mit E.-coli-Bakterien. Das führte zu einem tiefgreifenden „KI-ist-da“-Moment, als die Wissenschaftler eines Nachts Bereiche mit toten Bakterien in ihren Petrischalen entdeckten. Später machten sie Mikroskopaufnahmen der winzigen Viruspartikel, die wie unscharfe Punkte aussehen.
„Das war ziemlich beeindruckend, diese von der KI generierte Kugel tatsächlich zu sehen“, sagt Brian Hie, der das Projekt am Arc Institute leitet. Insgesamt funktionierten 16 der 302 Entwürfe – das heißt, die vom Computer entworfenen Phagen begannen sich zu vermehren, drangen schließlich in die Bakterien ein und töteten sie.
Laut Craig Venter, der vor fast zwei Jahrzehnten einige der ersten Organismen mit im Labor hergestellter DNA schuf, sind die KI-Methoden für ihn „nur eine schnellere Version von Trial-and-Error-Experimenten“. Als es beispielsweise einem von ihm geleiteten Team 2008 gelang, ein Bakterium mit einem im Labor gedruckten Genom zu schaffen, war dies das Ergebnis eines langen Prozesses des Ausprobierens verschiedener Gene. „Wir haben die manuelle KI-Version verwendet, die Literatur durchforstet und das bekannte Wissen genutzt“, sagt er.
Aber genau wegen dieser Geschwindigkeit setzen die Menschen darauf, dass KI die Biologie verändern wird. Die neuen Methoden wurden bereits 2024 mit dem Chemie-Nobelpreis für die Vorhersage von Proteinstrukturen ausgezeichnet. Und Investoren setzen Milliarden darauf, dass KI neue Medikamente finden kann. Mitte September sammelte das Bostoner Unternehmen Lila 235 Millionen US-Dollar ein, um automatisierte Labore zu bauen, die mit künstlicher Intelligenz laufen.
Entwicklungen zum Schutz vor Bakterien
Vom Computer entworfene Viren könnten auch kommerziell genutzt werden. So probieren Ärzte manchmal Phagentherapien aus, um Patienten mit schweren bakteriellen Infektionen zu behandeln. Ähnliche Tests werden derzeit durchgeführt, um Kohl mithilfe von spezialisierten Phagen vor Schwarzfäule zu schützen, die ebenfalls Bakterien verursachen.
„Diese Technologie hat definitiv viel Potenzial“, sagt Samuel King, der Student, der das Projekt in Heis Labor geleitet hat. Er merkt an, dass die meisten Gentherapien mit Viren arbeiten, um Gene in den Körper von Patienten zu transportieren, und KI möglicherweise effektivere Viren entwickeln könnte.
Das Stanford-Team betont, dass es seiner KI bewusst keine Informationen über Viren vermittelt hat, die Menschen infizieren können. Diese Art von Technologie birgt jedoch das Risiko, dass andere Wissenschaftler – aus Neugier, mit hehren Absichten oder böswillig – die Methoden auf menschliche Krankheitserreger anwenden und neue Dimensionen von todbringenden Fähigkeiten erforschen könnten.
„Ein Bereich, in dem ich zu äußerster Vorsicht rate, ist jede Forschung zur Virusverstärkung, insbesondere wenn sie zufällig erfolgt, sodass man nicht weiß, was man bekommt“, mahnt Venter. „Wenn jemand dies mit Pocken oder Anthrax machen würde, hätte ich große Bedenken.“
Von einfache auf komplexe Genome
Ob eine KI ein echtes Genom für einen größeren Organismus erzeugen kann, bleibt eine offene Frage. Beispielsweise hat E. coli etwa tausendmal mehr DNA-Code als phiX174. „Die Komplexität würde von atemberaubend auf weit mehr als die Anzahl der subatomaren Teilchen im Universum ansteigen“, sagt Boeke.
Außerdem gibt es noch keine einfache Möglichkeit, KI-Entwürfe für größere Genome zu testen. Während einige Viren allein aus einem DNA-Strang „hochfahren“ können, ist dies bei Bakterien, Mammuts oder Menschen nicht der Fall. Wissenschaftler müssten stattdessen eine bestehende Zelle schrittweise durch Gentechnik verändern – ein nach wie vor mühsamer Prozess.
Trotzdem hält Jason Kelly, CEO des Cell-Engineering-Unternehmens Ginkgo Bioworks in Boston, genau solche Anstrengungen für notwendig. Er glaubt, dass dies in „automatisierten“ Laboren durchgeführt werden könnte, in denen Genome vorgeschlagen und getestet und die Ergebnisse zur weiteren Verbesserung an die KI zurückgemeldet werden. „Dies wäre ein wissenschaftlicher Meilenstein von nationaler Bedeutung, da Zellen die Bausteine allen Lebens sind“, sagt Kelly. „Die USA sollten sicherstellen, dass wir als Erste dieses Ziel erreichen.“
Dieser Beitrag ist zuerst auf t3n.de erschienen.
(jle)
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 1 Monat
Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 1 Monat
Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 2 Wochen
Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen
UX/UI & Webdesignvor 4 TagenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 3 Monaten
Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 Digital Business & Startupsvor 3 Monaten
Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier















