Datenschutz & Sicherheit
„Passwort“ Folge 36: Vollständig zertifizierte News
In der vorhergehenden Folge wurde es bereits angedroht versprochen, nun ist es tatsächlich so weit: Eine ganze Folge mit Neuigkeiten über Public-Key-Zertifikate. Los geht es aber nicht mit der Web-PKI, sondern einem Anbieter von VoIP-Telefonen, der die Konfiguration dieser Telefone – verständlicherweise – mit Zertifikaten absichert. Leider enthält jedes Telefon auch gleich eine passende Zertifizierungsstelle samt privatem Schlüssel – was weit weniger verständlich und vor allem sehr unsicher ist. Die Podcast-Hosts Christopher und Sylvester diskutieren, was es damit auf sich hat.
Weiter geht es mit zwei sehr viel erfreulicheren Nachrichten, die beide von der Web-CA Let’s Encrypt ausgehen. Die hat zum einen ihr erstes produktives Zertifikat für eine IP-Adresse ausgestellt. Die Hosts sehen darin zwar eine ziemliche Nischenanwendung und können nur manche der vorgeschlagenen Anwendungsfälle nachvollziehen, aber in diesen Fällen sind IP-Zertifikate eine schöne Option.
Zum anderen macht „Static-CT“ große Fortschritte. Diese neue Spezifikation für Certificate Transparency (CT) ging aus dem Projekt Sunlight hervor, dessen Entwicklung Let’s Encrypt finanziert hat und das die CA nun auch selbst einsetzt. Christopher und Sylvester besprechen, welche Vorteile Sunlight und Static-CT mit sich bringen und warum diese Verbesserungen sehr willkommen sind.
Im weiteren Verlauf der Folge geht es um eine Bibliothek, die sich fatal an der Einführung von Static-CT verschluckt hatte, und um andere Mechanismen in der Web-PKI, die nicht rund laufen: Wieder mal sind große Zertifizierungsstellen bei teilweise groben Fehlern erwischt worden und mussten sich dem Zorn der Browserentwickler stellen. Außerdem schneiden die Hosts „X9 Financial PKI“ an, eine neue Public-Key-Infrastruktur, mit der DigiCert dem Finanzsektor maßgeschneiderte Services bieten will. Kundeninteresse weckt das natürlich besonders dann, wenn die X9-PKI Dinge ermöglicht, die in der Web-PKI nicht erlaubt sind.
Die neueste Folge von „Passwort – der heise security Podcast“ steht seit Mittwochmorgen auf allen Podcast-Plattformen zum Anhören bereit.
(syt)
Datenschutz & Sicherheit
Zero-Click-Angriff auf Apple-Geräte via WhatsApp
Meta verteilt derzeit Updates für diverse WhatsApp-Clients, weil es Angreifern möglich war, ohne Zutun der Nutzer Code einzuschleusen. Die Sicherheitslücke im Messenger nutzt einen Fehler bei der Autorisierung bestimmter iPhones, iPads und macOS-Computer aus, wenn Nachrichten automatisch mit den Geräten synchronisiert werden sollen. Sie ist unter CVE-2025-55177 registriert und kann in Verbindung mit Lücken in den Betriebssystemen der Geräte ausgenutzt werden, um über eine URL eine Spyware zu installieren. Per Klick oder Tipp bestätigen müssen die Nutzer der Apple-Geräte dies nicht (Zero-Click-Angriff).
Die betroffenen Versionen WhatsApp for iOS Version 2.25.21.73 oder älter, WhatsApp Business for iOS Version 2.25.21.78 und WhatsApp for Mac version 2.25.21.78 oder älter sollten umgehend aktualisiert werden. In Verbindung mit der schon bekannten Sicherheitslücke CVE-2025-55177 (EUVD-2025-26214, CVSS 8.0, Risiko „hoch“)kann der Exploit ausgenutzt werden. Die Lücke in den Betriebssystemen betrifft die Bibliothek „Image I/O“ und ermöglicht Einschleusen von ausführbarem Code über manipulierte Bilder. Auch iOS, iPadOS und macOS sollte man daher umgehend auf den neuesten Stand bringen. Wie Meta mitteilt, könnte die Lücke bereits ausgenutzt worden sein.
Laut Donncha Ó Cearbhaill, Chef des Security Lab von Amnesty International, wurde die Lücke auch schon aktiv ausgenutzt. Einige Anwender hätten von WhatsApp Warnmeldungen erhalten, es gäbe Hinweise, dass ihnen eine bösartige Nachricht zugeschickt worden wäre. Dies schreibt der Aktivist auf der Plattform X. Man sei sich nicht sicher, ob das betreffende Gerät erfolgreich kompromittiert worden sei, man empfehle einen vollen Werksreset und künftig stets Betriebssysteme und die WhatsApp-Anwendung aktuell zu halten.
(rop)
Datenschutz & Sicherheit
„Es liegt an uns, ob wir KI Macht über uns geben“
Big-Tech-Hersteller bekannter KI-Produkte vermarkten Werkzeuge wie Gemini, DeepSeek, ChatGPT und Co. als Alltagstechnologie. Private Nutzer*innen sollen sie überall und für alle möglichen Zwecke einsetzen können, als Web-Suchmaschine, als Korrekturleserin, als Autorin oder Lern-Assistenz. Ein solches Marketing definiert Menschen als defizitäre Lebewesen, die sich stets optimieren müssen.
Wir haben uns mit Maren Behrensen darüber unterhalten, wie die Werbestrategie der KI-Giganten versucht, unser Menschenbild zu prägen. Behrensen sagt: Wir müssen dem nicht auf den Leim gehen, sondern können als kritisch denkende Personen einen selbstbestimmten, kreativen Umgang mit der Technologie finden. Behrensen lehrt Philosophie an der niederländischen Universität Twente in Enschede und forscht zur technologischen Vermittlung sozialer Realitäten sowie zu Identitätskategorien, Antigenderismus und Populismus.

KI für alle Zwecke
netzpolitik.org: KI ist überall. Was für einen Nutzen verspricht uns die KI-Industrie?
Maren Behrensen: Sie verspricht, dass KI uns im Alltag hilft, uns produktiver macht und wir effizienter arbeiten – oder sie uns sogar heilen kann.
Ein Beispiel sind Therapie-Bots. Die werden auf teils skrupellose Weise vermarktet und geben vor, eine Therapie ersetzen zu können. Realistisch betrachtet sind die meisten dieser Bots nicht nur nutzlos, sondern teils brandgefährlich.
KI soll auch unsere Arbeitswelt revolutionieren, wissenschaftliches Arbeiten unterstützen, menschliche Kommunikation optimieren. Dabei machen sich die Hersteller kaum die Mühe zu zeigen, wie genau sie diese Versprechen einlösen wollen.
Unausweichliche KI
netzpolitik.org: Was hat dieses Marketing für Folgen?
Maren Behrensen: Diese Versprechen rufen eine gesellschaftliche Erwartungshaltung hervor. Das wiederum baut sozialen Druck auf, KI-Produkte zu nutzen und zu kaufen. Denn man will ja nichts versäumen. Dabei geht der Blick dafür verloren, welchen Zweck die Technologie eigentlich erfüllen soll.
Diese Unausweichlichkeitslogik, nach der es alle irgendwie nutzen und sich damit auseinandersetzen müssen, erweitert die Nutzerbasis.
Ein gutes Beispiel sind Universitäten: Dort heißt es, wir könnten gar nicht darum herumkommen, KI in die Lehre oder Forschung zu integrieren. Also werden Taskforces eingerichtet, Fortbildungen angekündigt, Lehrpläne angepasst – obwohl noch gar nicht klar ist, wo und wie genau KI einen echten Nutzen bringt. Das ist weniger eine sachliche Entscheidung als eine durch Marketing erzeugte Dynamik.
netzpolitik.org: Es ist interessant, dass Unternehmer wie OpenAI-Chef Sam Altman es geschafft haben, dass alle über ihr Produkt sprechen, und davon ausgehen, dass Menschen es wie selbstverständlich nutzen. Wissen KI-Unternehmer, wofür Universitäten oder Privatpersonen ihr Produkt einsetzen sollten?
KI für ganz spezifische Zwecke
Maren Behrensen: Ich glaube, das wissen sie häufig nicht. Es gibt natürlich Bereiche, in denen KI einen klaren Nutzen hat – aber das sind meist sehr eng umrissene Felder. Ein Beispiel ist die Astrophysik: Dort gibt es gewaltige Datenmengen – zum Beispiel Millionen Aufnahmen von anderen Galaxien –, die von Menschen unmöglich alle gesichtet werden können. KI kann Muster darin erkennen und Vergleichsarbeit leisten, die Forschung in diesem Umfang überhaupt erst möglich macht.
Ein anderes Beispiel ist die Proteinforschung in der Biologie. KI kann dort Simulationen durchführen, Vorschläge machen und so Prozesse beschleunigen, die sonst Jahre dauern würden. Das ersetzt nicht die Arbeit im Labor, aber es eröffnet neue Kapazitäten.
Muster in großen Datenmengen zu erkennen, das ist ein Anwendungsbereich, in dem KIs dem Menschen klar überlegen sind und für den sie projektspezifisch trainiert werden. Diese Nutzung unterscheidet sich allerdings sehr deutlich davon, wie KI für Privatnutzer vermarktet wird, nämlich als Alltagstechnologie oder Allzwecklösung.
Menschen mit Optimierungsbedarf
netzpolitik.org: Welche Rolle spielt das Nützlichkeitsprinzip in der Vermarktung von KI?
Maren Behrensen: Das Nützlichkeitsprinzip steht im Zentrum der meisten Vermarktungsstrategien. Ein Beispiel ist die Grammarly-Werbung. Sie verspricht: „Wir schreiben dir deine Hausarbeit“ oder „Wir machen deine E-Mails verständlich“. Die Unterstellung ist hier: Der Mensch an sich kann wenig und dann kommt die KI, die aus dem unfähigen Menschen ein optimiertes Wesen macht.
In dieser Logik wird der Mensch wie eine kleine Maschine gesehen, die sich ständig selbst verbessern soll. Sein Wert bemisst sich daran, wie nützlich, effizient oder produktiv er ist.
Das zeigt sich auch besonders bei Tools wie Kalender- oder Gesundheits-Apps, wo es heißt: „Mit KI bringst du endlich Ordnung in dein Leben.“
netzpolitik.org: Was genau ist daran problematisch?
Die Mensch-Maschine
Maren Behrensen: Das ist ein sehr reduziertes Menschenbild. Es blendet vieles aus, was menschliches Leben eigentlich ausmacht – Beziehungen, Kreativität, auch einfach das Recht, einmal nicht effizient zu sein.
Das KI-Marketing versteht Menschen als Maschinen unter anderen Maschinen.
netzpolitik.org: Menschen als Maschinen zu verstehen – gibt es dafür Vorläufer in der Philosophiegeschichte?
Maren Behrensen: Es erinnert an René Descartes, ein französischer Philosoph der frühen Neuzeit, wobei er nicht den Menschen, sondern lediglich Tiere als Maschinen betrachtet hat. Daneben gibt es materialistische Philosophien. Sie brechen den Menschen auf seine Existenz als Körper herunter, der bestimmte Dinge braucht: Nahrungsmittel, Schlaf und so weiter. In der Regel versuchen sie, auch das Gefühlsleben des Menschen – oder das, was man vielleicht theologisch verbrämt Seelenleben nennen würde – auf rein materielle Fragen zu reduzieren.
Dem etwas überspitzten Ausdruck Mensch-Maschine-Denken kommt aber wohl der Behaviorismus in der Psychologie am nächsten. Da gibt es auch unterschiedliche Denkschulen, aber der Grundgedanke ist: Menschliches Verhalten ist auf Input und Output ausgerichtet. Menschliches Verhalten wird durch äußere Reize bestimmt. Die Idee dahinter ist, dass man Menschen quasi programmieren kann, wenn man die richtigen Inputs kennt. Dieses Denken wurde unter anderem auf Kindererziehung angewendet.
Nützlichkeitsprinzip auf die Spitze getrieben
netzpolitik.org: Eine Facette des Nützlichkeitsprinzips im KI-Marketing sind Philosophien, denen bekannte KI-Player anhängen, ein Beispiel ist der Longtermismus. Er steht in der Tradition des Utilitarismus, einer Art Nützlichkeitsethik. Was besagt er?
Maren Behrensen: Der Longtermismus argumentiert in etwa so: Menschliches Leben oder auch positive Erfahrungen, die Menschen im Laufe eines Lebens machen können, haben einen bestimmten intrinsischen Wert. Daher steigert sich dieser Wert umso mehr, je mehr Menschen es gibt.
Hinzu kommt die Vorstellung, dass wir es durch eine technologisch vermittelte Zukunft schaffen, uns über die Galaxie auszubreiten. Damit würden irgendwann die natürlichen Grenzen dafür wegfallen, wie viele menschliche Leben zeitgleich existieren können. Im Moment müssen wir davon ausgehen, dass es eine solche Grenze auf der Erde gibt, dass also nicht beliebig viele Menschen auf der Erde leben können.
Daneben müssen wir dafür sorgen, dass nicht irgendein katastrophales Ereignis uns alle gleichzeitig auslöscht.
netzpolitik.org: Menschliches Leben in der Zukunft schützen zu wollen, klingt doch eigentlich ganz gut.
Maren Behrensen: Mein größtes Problem mit der Argumentation des Longtermismus ist, dass es menschliche Bedürfnisse hier und jetzt vollkommen vernachlässigt, auf eine meines Erachtens völlig fahrlässige Weise. Longtermisten formulieren Zukunftsversprechen, von denen völlig unklar ist, ob sie jemals so eintreten.
Moralische Katastrophen kann der Longtermismus nicht einordnen. Ein Genozid oder eine schwere Epidemie, die viele Menschen tötet, wäre im Longtermismus nicht weiter erwähnenswert, solange die Menschheit als solche weiter besteht. Er abstrahiert völlig von den Bedürfnissen und der Not der jetzt lebenden Menschen.
netzpolitik.org: Wie kommen Menschen als Maschinenwesen ins Spiel?
Maren Behrensen: Manche Longtermisten träumen davon, dass wir irgendwann gar nicht mehr als körperliche Wesen existieren, sondern einfach als virtuelle Wesen in einer Cloud. Wenn es so käme, dann würden damit viele Bedürfnisse wegfallen, die Menschen als körperliche Wesen haben. Schlaf oder Essen wären wahrscheinlich obsolet.
netzpolitik.org: Ist das für uns als Nutzer*innen der Technologie ein Problem, dass viele KI-Hersteller uns als potenzielle Maschinenwesen verstehen?
Wir sind ein spendenfinanziertes Medium
Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.
Maren Behrensen: Zum einen zeigt sich in der longtermistischen Ideologie ein entwürdigender, oft rassistischer, sexistischer und ableistischer Blick auf Menschen. Wenn Menschen, die einer solchen Ideologie anhängen, uns nicht nur ihre Produkte verkaufen, sondern ihren Reichtum auch dazu nutzen, direkten politischen Einfluss auszuüben, wie das etwa Peter Thiel und Elon Musk in der USA tun – dann droht gleichzeitig ein faschistoider Umbau der politischen Verhältnisse.
Die Angst des Philosophen
netzpolitik.org: Wie wirkt sich das aus, wenn Nutzer*innen dem Marketing von der KI als Alleskönner auf den Leim gehen?
Maren Behrensen: Es schürt falsche Erwartungen. Menschen missverstehen ChatGPT zum Beispiel als ein Programm, das direkt Informationen liefern kann. Das ist eine falsche Annahme.
Wenn man das Missverständnis von KI als Suchmaschine ins Gesellschaftliche weiterdenkt, dann landet man bei dem, was man als die Angst des Philosophen beschreiben könnte: Menschen lassen ChatGPT für sich denken. Aber ChatGPT macht kritisches Denken nicht automatisch obsolet.
Das Ganze erinnert an das Taschenrechner-Problem: Als der Taschenrechner in die Klassenzimmer kam, gab es auch diese Sorge, dass man den jungen Menschen Mathematik nicht mehr vermitteln kann. Doch einen Taschenrechner kann ich erst dann sinnvoll und effizient nutzen, wenn ich schon Ahnung von Mathe habe, und wenn ich weiß, welche Probleme ich mit ihm lösen soll. ChatGPT und andere KI-Tools kann ich auch dann gewinnbringender nutzen, wenn ich eine klare Vorstellung davon habe, was ich erfragen oder erreichen will.
netzpolitik.org: Das heißt, die Sorge ist unbegründet?
Maren Behrensen: Ich halte die Sorge für übertrieben. Sie sagt mehr über die Menschen aus, die KI als alternativlose Allzwecklösung anpreisen und gleichzeitig von einem radikalen Umbau der Gesellschaft fantasieren. Faschisten käme es sehr gelegen, wenn KI das kritische Denken ersetzen würde – aber das heißt nicht, dass jegliche Nutzung von KI einer Aufgabe des Denkens gleichkommt.
Nutzer*innen widersetzen sich Marketing
Umso interessanter ist es, dass viele Menschen KI-Systeme auf eine Weise nutzen, die sich dem Nützlichkeitsprinzip widersetzt. Ich denke hier insbesondere an eine Form der Nutzung, die KI als eine Art Dialogpartnerin begreift – als interaktives Tagebuch oder Hilfe beim Sortieren von Gedanken oder Routinen.
Natürlich kann auch das gefährlich sein: wenn jemand sich durch den Umgang mit KI weiter in Wahnvorstellungen hineinsteigert. Aber wenn Menschen KIs als Dialogpartnerin behandeln, wählen sie eine andere Herangehensweise als die der reinen Selbstoptimierung durch den Umgang mit einem Werkzeug.
Und das finde ich spannend: Was kann eigentlich menschliche Kreativität aus und mit diesem Ding machen? Das meine ich wertneutral, aber es zeigt meines Erachtens, dass Menschen einen kreativen Zugang zu KI haben, der über die Marketingnarrative „kann alles“, „weiß alles“, „ist eh unausweichlich“ oder „kann alles besser als du“ hinausgeht.
Wenn nur noch der Chatbot zuhört
netzpolitik.org: Was sind die Risiken, wenn Menschen KI-Tools unreflektiert nutzen?
Maren Behrensen: Wenn sie beispielsweise ChatGPT als Gesprächspartner*innen und als echte Person wahrnehmen oder den Output des Programms unhinterfragt glauben, birgt das die Gefahr, Illusionen zu verstärken. Es zeigt aber auch: Es gibt viele Menschen, die sich sonst nicht gehört fühlen – und die dieses Zuhören nun in der Maschine finden.
Das kann wie gesagt gefährlich sein: In den USA beginnt gerade ein Rechtsstreit gegen OpenAI, in dem es darum gehen wird, ob ChatGPT einen jungen Menschen in den Suizid getrieben hat.
Chatbots imitieren Sprachhandeln
netzpolitik.org: Wie kommt es zu dieser Dynamik?
Maren Behrensen: Chatbots sind nicht auf Wahrheitssuche ausgelegt, sondern darauf, menschliches Sprachhandeln zu imitieren. Das hat oft wenig damit zu tun, Argumente oder Evidenz auszutauschen und kritisch zu hinterfragen. Vielmehr geht es darum, einen Konsens herzustellen, einen gemeinsamen Entschluss zu fassen oder gemeinsame Glaubenssätze zu formulieren.
Je besser Chatbots darin werden, menschliches Sprachhandeln zu imitieren, desto größer wird auch die Gefahr, dass sie als Autorität wahrgenommen werden. Und Autoritäten können toxisch sein, sie können ihre Macht ausnutzen. Dabei unterstelle ich natürlich nicht, dass KI eine Intelligenz wäre, die dies bewusst tut. Aber wie bei toxischen menschlichen Autoritäten gilt: Es liegt an uns, ob wir ihnen diese Macht über uns geben oder nicht.
KI-Programme haben ja keinen Personenstatus, geschweige denn Bewusstsein. Sie fungieren häufig wie Echokammern, ähnlich Social Media, aber eben nicht nur.
Datenschutz & Sicherheit
KW 34: Die Woche, in der wir Wischiwaschi-Belege entzaubert haben
Die 35. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 17 neue Texte mit insgesamt 248.128 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.
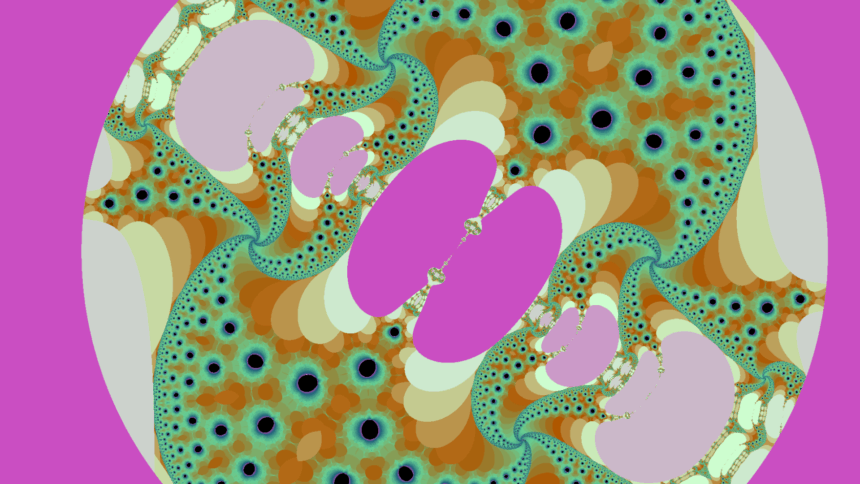
Liebe Leser:innen,
ich liebe es, wenn jemand sagt, dass etwas wissenschaftlich nachgewiesen sei. Oder dass Studien eine Behauptung belegen würden. Denn das ist immer eine Einladung nachzubohren. Denn die gern als Seriositätsverstärker erwähnten Studien, Untersuchungen und Nachweise fristen regelmäßig ein Dasein im Nebel.
Wenn man fragt, um welche Quellen es genau geht, wird es manchmal schnell weniger seriös und standfest, als man zuvor zu suggerieren versucht hat. Manchmal bekommt man dann trotz mehrmaliger Nachfragen keine konkreten Papiere, sondern Pressemitteilungen genannt. Manchmal existieren die Studien zwar, passen aber nur mittelgut zur aufgestellten These oder erweisen sich als deutlich differenzierter als die Schaufenster-Behauptung, die sie schmücken sollen.
Und manchmal führt der Verweis auf Wissenschaft und Forschung in die Irre, wie in dieser Woche bei einem Statement des Drogenbeauftragten Hendrik Streeck (CDU). Da mussten Untersuchungen zu den Auswirkungen medialer Darstellung von Drogenkonsum als Argumentationshilfe für Alterskontrollen im Allgemeinen herhalten. Mein Kollege Sebastian hat das herausgearbeitet und fragt: „Heißt das, Erotik macht Durst auf Bier?“
Ich finde es wichtig, immer wieder genau hinzusehen, wenn jemand nicht näher definierte Belege wie eine Monstranz vor sich herträgt. Denn im besten Fall lässt sich aus den Verweisen Genaueres lernen. Denn wer die Quelle kennt, kann sich selbst informieren. Und das mögen wir sehr.
Bleibt kritisch!
anna
Breakpoint: Gefangen in der Vereinzelung
Ein neoliberaler Zeitgeist rät uns zu Einsamkeit und Ignoranz, damit wir uns besser fühlen. Doch was wir brauchen, ist das genaue Gegenteil: mehr Sorge füreinander und mehr Gemeinschaft. Von Carla Siepmann –
Artikel lesen
Ransomware und IT-Störungen: Wir brauchen ein kommunales Lagebild zur Informationssicherheit
Welche digitalen Angriffe und IT-Störungen verzeichnen die Kommunen? Der IT-Situation in Städten, Gemeinden und Landkreisen widmet sich das Projekt „Kommunaler Notbetrieb“. Im Interview erklärt Initiator Jens Lange, was ihn antreibt und wie man mitmachen kann. Von Constanze –
Artikel lesen
Bundesdatenschutzbeauftragte: Streit um Facebook-Seiten der Bundesregierung geht weiter
Seit fast 15 Jahren ringen Datenschützer:innen und Behörden um Facebook-Seiten. Nachdem ein Verwaltungsgericht kürzlich der Bundesregierung grünes Licht gegeben hatte, geht die Bundesdatenschutzbeauftragte in Berufung. Von Ingo Dachwitz –
Artikel lesen
„Digitale Souveränität“: BSI-Chefin Plattner erntet Widerspruch
Die BSI-Präsidentin bekommt Gegenwind in Fragen der digitalen Unabhängigkeit. Sie schaffe mit ihren Aussagen „Verunsicherung in Politik und Wirtschaft“, so der Wirtschaftsverband OSBA. Viele Abhängigkeiten könnten sehr wohl kurzfristig abgebaut werden, wenn Lösungen aus Europa gezielter berücksichtigt würden, heißt es in einem offenen Brief. Die Angesprochene rudert zurück. Von Constanze –
Artikel lesen
Recht auf Teilhabe: Kinderhilfswerk stellt sich gegen Handyverbot an Schulen
In einem offenen Brief warnen unter anderem das Kinderhilfswerk, der Bundeselternrat und der Verein D64 vor pauschalen Smartphone-Verboten in der Schule. Stattdessen sollten Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern gemeinsame Regeln entwickeln. Von Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Gesetzentwurf: Elektronische Fußfesseln sollen Täter*innen auf Abstand halten
Durch elektronische Fußfesseln sollen Täter*innen ihren potenziellen Opfern nicht zu nahe kommen. Die Pläne aus dem Justizministerium richten sich vor allem gegen häusliche Gewalt. Fachleute weisen auf den eher begrenzten Nutzen hin. Von Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Daten beim Hotel-Check-in: Wer hat in meinem Bettchen gelegen?
Einer der mutmaßlichen North-Stream-Saboteure flog auf, weil er sich in einem italienischen Hotel anmeldete und seine Daten bei der Polizei landeten. Wie sind die Ermittler:innen an die Informationen gelangt und wie ist die Situation für Reisende bei Übernachtungen in Deutschland? Von Anna Biselli –
Artikel lesen
Datenweitergabe an die Polizei: Eure Chats mit ChatGPT sind nicht privat
Menschen vertrauen ChatGPT intimste Informationen an. Der Hersteller scannt die Chats, lässt sie von Moderator*innen lesen und gibt sie in bestimmten Fällen sogar an die Polizei weiter. Das hat das KI-Unternehmen Open AI als Sicherheitsmaßnahme nach einem Suizid eines Nutzers verkündet. Von Martin Schwarzbeck –
Artikel lesen
Bildungs-ID: Bundesregierung will Schüler zentral erfassen
Die Bundesregierung will die zentrale Schüler-ID. Doch Datenschützer*innen, Wissenschaftler*innen und Gewerkschafter*innen sind sich einig: Die Privatsphäre Minderjähriger steht auf dem Spiel. Von Esther Menhard –
Artikel lesen
Alterskontrollen im Netz: Drogenbeauftragter Streeck argumentiert unsauber
Ein Zitat des Drogenbeauftragten ging diese Woche durch große Nachrichtenmedien. Mit angeblich wissenschaftlicher Begründung sprach sich Hendrik Streeck (CDU) für Alterskontrollen im Netz aus. Doch an dem Zitat ist etwas faul. Ein Kommentar. Von Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Schüler-ID: Magischer Glaube an die zentrale Datenbank
Politiker:innen verbinden mit der zentralen Schüler-ID große Hoffnungen. Doch primär entsteht ein großes Datenschutzproblem und noch mehr Überwachung. Investitionen in Bildung könnten ganz woanders gebraucht werden. Ein Kommentar. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Umstrittene Massenüberwachung: Von diesen Ländern hängt ab, wie es mit der Chatkontrolle weitergeht
Bei der Chatkontrolle gibt es weiterhin keine Einigung der EU-Länder. Anstehende Wahlen und jüngste Regierungswechsel machen Bürgerrechtler:innen nervös. Wenn einige Länder ihre Position ändern, könnte das Überwachungsprojekt doch noch durchkommen. Ein Überblick. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Eckpunkte für mehr „Cybersicherheit“: Gefährlich unkonkret
Innenminister Dobrindt will mehr Sicherheit für IT-Systeme, das Bundeskabinett hat dafür Eckpunkte beschlossen. Während dem Ziel wohl kaum einer widersprechen würde, bleiben die Mittel beunruhigend vage. Das wird dem Thema und möglichen Folgen nicht gerecht. Von Anna Biselli –
Artikel lesen
Als erstes Bundesland: Hessen setzt Live-Gesichtserkennung ein
50 Kameras filmen das Geschehen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Die Gesichter aller Passant*innen werden mit Hilfe von KI analysiert und mit Fotos gesuchter Personen abgeglichen. Das zugrundeliegende Gesetz erlaubt noch viel mehr. Von Martin Schwarzbeck –
Artikel lesen
Referentenentwurf: Diese Behörden sollen die KI-Verordnung umsetzen
Die Bundesnetzagentur soll künftig einen Großteil der KI-Aufsicht übernehmen. Ringsum ist jedoch ein Mosaik aus weiteren Zuständigkeiten geplant. Das geht aus dem Gesetzentwurf aus dem Digitalministerium hervor, den wir veröffentlichen. Von Daniel Leisegang –
Artikel lesen
„Grenzpartnerschaft“ mit den USA: EU-Kommission will Biometriedaten aus Mitgliedstaaten freigeben
Die EU-Kommission will ein Abkommen verhandeln, das US-Behörden direkten Zugriff auf polizeilich gespeicherte Fingerabdrücke und Gesichtsbilder in Europa erlaubt. Von einer Abfrage wären potenziell alle Reisenden betroffen. Von Matthias Monroy –
Artikel lesen
Interview: „Es liegt an uns, ob wir KI Macht über uns geben“
Die KI-Branche will, dass wir ihre Tools für alles nutzen. Dafür vermarktet sie ihre Produkte als Alleskönner, der Mensch wird zum optimierungsbedürften Wesen. Im Gespräch mit netzpolitik.org erklärt die Philosoph*in Maren Behrensen, wie wir einen kritischen und kreativen Umgang mit KI finden können. Von Esther Menhard –
Artikel lesen
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Social Mediavor 2 Wochen
Social Mediavor 2 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 2 Wochen
Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Digital Business & Startupsvor 2 Monaten
Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Tag
UX/UI & Webdesignvor 1 TagAdobe Firefly Boards › PAGE online














