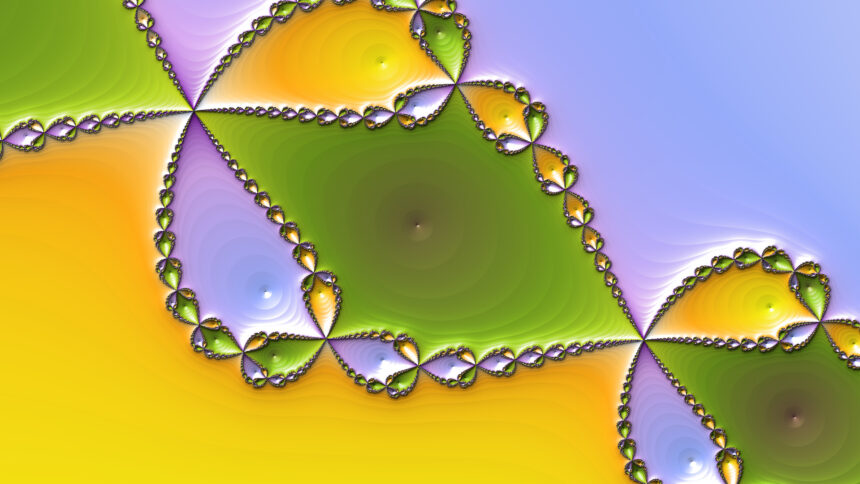Der konservative Vorsitzende des Innenpolitik-Ausschusses (LIBE) des Europäischen Parlaments und Chatkontrolle-Berichterstatter, Javier Zarzalejos, hat überraschend für Mittwoch ein so genanntes „Schattentreffen“ zum Thema Chatkontrolle angesetzt. Der Zeitpunkt dafür ist ungewöhnlich, da keine Verhandlungen mit EU-Rat und EU-Kommission anstehen – und das EU-Parlament seine Chtakontrolle-Kompromiss schon vor mehr als einem Jahr gefunden hat. Der gilt als grundrechtsfreundlich, da er verschlüsselte Kommunikation von der Überwachung ausnimmt.
Am Montag konnte netzpolitik.org eine Agenda des kurzfristig angesetzten Treffens einsehen. Die Liste der bis dahin Eingeladenen ließ auf eine sehr einseitige Ausrichtung der Veranstaltung schließen. Bis Montagnachmittag war kein einziger Vertreter der digitalen und bürgerrechtsorientierten Zivilgesellschaft zu dem Treffen geladen, während überwachungsfreundliche Lobbyisten aus dem Bereich des Kinderschutzes von ECPAT, Brave und Eurochild neben Vertretern der dänischen Polizei und von Europol das Feld bestimmen.
Auf der Liste steht auch eine Vertreterin des Justizministeriums von Dänemark, welches derzeit die Ratspräsidentschaft inne hat und jüngst einen verschärften Vorschlag zur Chatkontrolle vorgelegt hat. Neben einem Vertreter der Kommission gibt es außerdem noch Industrievertreter von Meta und Microsoft sowie mit Hany Farid einen Professor, der mit der NGO „Counter Extremism Project“ zusammengearbeitet hat, die dem Sicherheits- und Geheimdienstapparat aus den USA und Deutschland nahesteht.
EDRi auf letzten Drücker eingeladen
Am Montagabend – und nach einer Presseanfrage von netzpolitik.org bezüglich der einseitigen Besetzung der Veranstaltung – wurde dann eine aktualisierte Fassung der Agenda verschickt, die wir im Volltext veröffentlichen. In dieser Agenda ist nun auch der europäische Dachverband digitaler Bürgerrechtsorganisationen EDRi als Teilnehmer gelistet. Der Berichterstatter Javier Zarzalejos hat auf eine Presseanfrage von netzpolitik.org zu Zweck und Zusammensetzung des Treffens nicht geantwortet.
Beobachter:innen aus der digitalen Bürgerrechtsszene fürchten, dass das Schattentreffen der Versuch des konservativen Zarzalejos ist, die Parlamentsposition schon vor möglichen Trilog-Verhandlungen zu schwächen. „Es ist unfassbar, dass der Berichterstatter Javier Zarzalejos versucht, diese Position des EU-Parlaments zu unterminieren – anders kann man dieses Vorgehen nicht nennen“, sagt Elina Eickstädt, Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Das Vorgehen zeige, dass es um das Durchpressen von anlassloser Massenüberwachung gehe und nicht um einen ausbalancierten nachhaltigen und grundrechtskonformen Plan zum Schutz von Kindern, so Eickstädt weiter.
Einwände von Ausschuss-Stellvertretenden
Das Schattentreffen stößt bei den „Schattenberichterstattern“ – so werden die stellvertretenden Ausschussvorsitzenden genannt – nicht nur auf Gegenliebe. So sagt Markéta Gregorová von den tschechischen Piraten und Mitglied der Grünen Fraktion, dass sie selbst und eine Reihe anderer Schattenberichterstatter Einwände gegen die Abhaltung dieser Sitzung erhoben hätten: „Wir sind der Ansicht, dass die Position des EP klar ist: Eine allgemeine Überwachung privater Kommunikation ist unabhängig von ihrer Form illegal und daher nicht zulässig.“
Außerdem habe man mehrere Vorschläge an den Berichterstatter Zarzalejos bezüglich Einladungen weitergeleitet. Man hoffe nun, dass diese Vorschläge in der Diskussion berücksichtigt werden, damit der EU-Rat die Position des Parlaments verstehe, so die Abgeordnete weiter.
Dokument
Stand: Montag, 20 Uhr
DRAFT AGENDA
Shadows Meeting
Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
laying down rules to prevent and combat child sexual abuse
2022/0155 (COD)
Wednesday, 16 July 2025
13.00-15.00
Brussels (SPINELLI 5E2 and interactio)
1) Welcoming introduction by the Rapporteur
2) PANEL I: Protecting Children And Privacy: Which Balanced Solution?
(approximately 60 minutes)
- Patricia Cardona, Brave Movement (5 minutes max presentation)
- John Carr, Online Safety Expert and Adviser at ECPAT International (5 minutes max presentation)
- Fabiola Bas Palomares, Policy & Advocacy Officer on Online Safety, Eurochild (5 minutes max presentation)
- Ella Jakubowska, Head of Policy at European Digital Rights (EDRI) (5 minutes max presentation)
Closing Remarks to Panel I:
- Ms Ida Høiberg Bendsen, Danish Ministry of Justice
Ms Rikke Freil Laulund, Danish Police, Chairperson of the Council’s Law Enforcement Working Party-Police (head of delegation), Danish Presidency (2 minutes)
- Mr ONIDI, Deputy Director-General DG HOME, European Commission (2 minutes)
- Mr LECOUFFE, Deputy Executive Director, Europol (2 minutes)
Q&A session (approximately 35 minutes)
3) PANEL II: Detecting CSAM in an Encrypted Environment. Which Risks For Cybersecurity?
(approximately 60 minutes)
- Hans Graux, lawyer at TimeLex, attending on behalf of Microsoft
(5 minutes max presentation)
- Ahmed Razek, Public Policy Manager, Messaging at Meta (5 minutes max presentation)
- Prof Hany Farid, Digital Forensics, Berkley, University of California
(5 minutes max presentation) – REMOTELY
Closing Remarks to Panel II:
- Ms Ida Høiberg Bendsen, Danish Ministry of Justice
Ms Rikke Freil Laulund, Danish Police, Chairperson of the Council’s Law Enforcement Working Party-Police (head of delegation), Danish Presidency (3 minutes)
- Mr ONIDI, Deputy Director-General DG HOME, European Commission (3 minutes)
- Mr LECOUFFE, Deputy Executive Director, Europol (3 minutes)
Q&A session (approximately 35 minutes)
4) Closing Remarks by the Rapporteur
5) AOB