Entwicklung & Code
SoftwareArchitekTOUR – Episode 105: Schulden in der Softwarearchitektur
In dieser Episode des Software-Architektur-Podcasts sprechen Patrick Roos, Gernot Starke und Michael Stal über den wahren Umfang von „Schulden“ in Softwareprojekten – und warum diese oft weit über den Code hinausgehen.
Was haben schlecht geschnittene Teams, veraltete Frameworks und fehlende Qualitätsanforderungen gemeinsam? Sie alle hinterlassen Spuren – und Kosten. Gemeinsam tauchen die Podcaster ein in bewusst und unbewusst aufgenommene Schulden, werfen einen Blick auf praxiserprobte Werkzeuge wie Technical Debt Records und diskutieren, warum Kapitel 11 im arc42-Template vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdient.
Eine Folge voller Praxisbeispiele, Denkimpulse und konkreter Ideen – für alle, die technische Schulden nicht nur bekämpfen, sondern endlich systematisch verstehen wollen.
Shownotes
(Bild: iX)
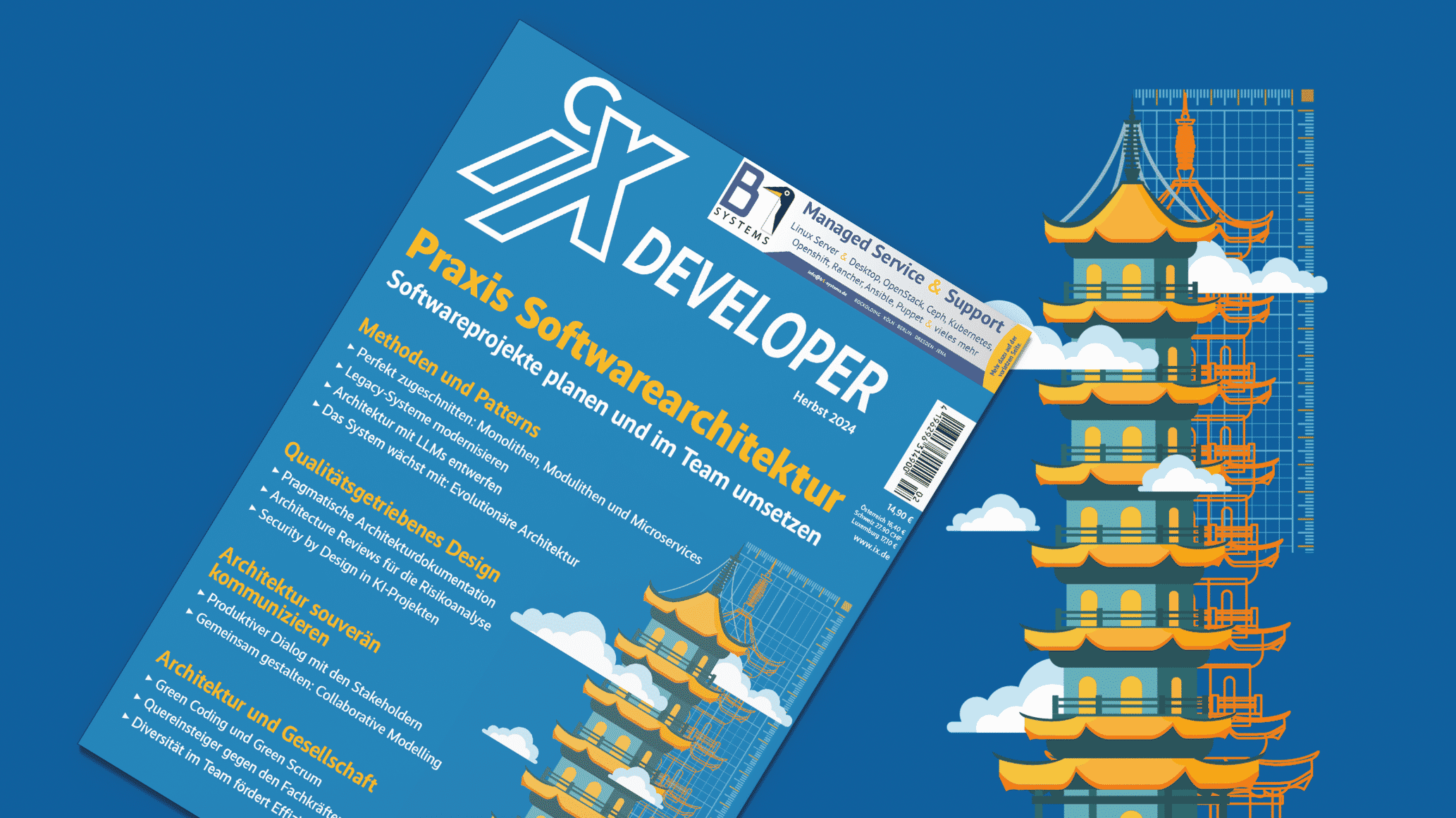
Im iX/Developer-Sonderheft gibt es neben den klassischen Architekturinhalten zu Methoden und Pattern Artikel über Soziotechnische Systeme, Qualitätssicherung oder Architektur und Gesellschaft. Domain Driven Design ist ebenso ein Thema wie Team Topologies, KI und Sicherheit.
Als Autoren konnten wir bekannte Experten gewinnen – darunter auch viele Betreiber dieses Podcasts – die ihr Wissen in vielen spannenden Artikeln sowohl für Architektureinsteiger als auch Spezialisten weitergeben.
(who)
Entwicklung & Code
Entwicklungsumgebung: IntelliJ IDEA 2025.2 bringt Support für Java 25
JetBrains hat seine insbesondere auf Java und Kotlin ausgelegte Entwicklungsumgebung IntelliJ IDEA mit der neuen Hauptversion 2025.2 ausgestattet. Sie bringt Updates für die KI-Werkzeuge sowie frühzeitigen Support für die noch nicht veröffentlichten Versionen Java 25 und Maven 4. Auch die IDEs RubyMine und WebStorm haben Version 2025.2 erreicht.
KI-Codevervollständigung für zusätzliche Sprachen und im Offline-Modus
Der JetBrains AI Assistant und der JetBrains AI Coding Agent Junie sind kostenfrei innerhalb von JetBrains-Entwicklungsumgebungen verfügbar. Wenn Entwicklerinnen und Entwickler beispielsweise IntelliJ IDEA aktualisieren, erhalten sie automatisch auch die neueste Versionen des AI Assistant. Junie ist dagegen manuell zu aktualisieren und lässt sich über Einstellungen | Plugins installieren.
Der KI-Assistent liefert nun neue Features wie die KI-gestützte Autovervollständigung für SQL, YAML, JSON und Markdown ebenso wie Codeblock-Vorschläge für Java im Offline-Modus. Bei der Offline-Java-Vervollständigung ist die Auswahl eines bevorzugten lokalen Codevervollständigungsmodells möglich. Junie soll derweil bis zu 30 Prozent schneller sein und sich auch in Remote-Umgebungen nutzen lassen.
Details dazu bietet die zugehörige „What’s New“-Seite. Diese Seite präsentiert sich wiederum im neuen Design, das sich auf die Highlights spezialisiert – denn laut JetBrains haben Besucherinnen und Besucher der „What’s New“-Seiten meist nicht sehr weit gescrollt. Zudem soll eine „What’s Fixed“-Seite folgen, die über Qualitäts- und Stabilitätsverbesserungen informiert.
Support für Java 25 und Maven 4
Nächsten Monat soll die Programmiersprache Java in der LTS-Version (Long-Term Support) 25 erscheinen, und JetBrains bereitet sich schon darauf vor: Aus IntelliJ IDEA heraus lassen sich Early Access Builds des nächsten Java-Release herunterladen und es besteht Support sowohl für finale als auch für Preview-Features von Java 25.
(Bild: Playful Creatives/Adobe Stock))

Am 14. Oktober dreht sich bei der betterCode() Java 2025 statt alles um das für September geplante Java 25. Die von iX und dpunkt verlag ausgerichtete Online-Konferenz behandelt in sechs Vorträgen die wesentlichen Neuerungen. Eine Keynote von Adam Bien zu 30 Jahren Java rundet den Tag ab.
Das Dependency-Management-Tool Maven befindet sich schon seit Längerem auf dem Weg zur Version 4, und auch diese anstehende Version lässt sich bereits vor ihrem finalen Release in IntelliJ IDEA nutzen – in Form des neuesten Release Candidate.
Alle weiteren Updates in IntelliJ IDEA, RubyMine und WebStorm 2025.2 lassen sich im JetBrains-Blog einsehen.
Preiserhöhung ab 1. Oktober 2025
Erst kürzlich sorgte JetBrains nicht durch neue Features, sondern durch eine Preissteigerung für Aufsehen: Die Abonnements für alle Entwicklungsumgebungen und weitere Tools werden ab dem 1. Oktober 2025 teurer, teils um 20 Prozent. Bis zum Stichtag lassen sich – bei Vorauszahlung – die derzeitigen Preise noch für einen begrenzten Zeitraum beibehalten: für individuelle Abos bis zu drei Jahre, für kommerzielle Abos bis zu zwei Jahre.
(mai)
Entwicklung & Code
KI-Agenten, Teil 3: Adaptive Designs optimieren Entwicklung und Nutzererlebnis

Thomas Immich ist Unternehmer, Trainer und Berater und unterstützt Unternehmen bei der menschzentrierten Automatisierung ihrer Prozesse mittels KI-Agenten.
KI-Agenten übernehmen zunehmend Aufgaben entlang der gesamten digitalen Produktionsstraße – von der Codegenerierung über die Prozessautomatisierung bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung. Während Teil 1 dieser Artikelserie die grundlegende Verschiebung durch agentische Rollen skizzierte und Teil 2 den Wandel vom Produkt zur Produktion nachzeichnete, geht in diesem letzten Teil nun um die Frage, wie sich Effizienz, Individualisierung und Qualität in Einklang bringen lassen. Adaptive Interfaces, simulationsgestützte Variantenbildung und automatisiertes Testing treffen auf menschliche Rahmengebung – und eröffnen neue Spielräume für eine wirklich menschzentrierte Produktentwicklung.
Individuelle Anpassung
Wer an individuelle Anpassungen denkt, hat nicht zwangsläufig das Stichwort Minimalismus im Sinn. Doch aus menschzentrierter Sicht ist jedes Produkt-Feature, für das kein Nutzungsbedürfnis besteht, eine kognitive Last und digitale Schwelle. Das Anpassen einer Software an die Nutzenden hat daher viel mit „Weglassen“ zu tun. Die Reduktion von Features wird zum eigentlichen Ziel.
Die moderne Softwareentwicklung hatte vor der KI-Ära bereits einige Strategien, um ein digitales Produkt für bestimmte Zielgruppen mit mehr oder weniger Features auszustatten.
Doch es gibt bei der Anwendung dieser Strategien langfristig ungelöste und daher klassische Probleme: Geschieht die Reduktion von Features während der Programmlaufzeit über sogenannte Feature Flags, muss der Quellcode viele konditionelle Programmteile enthalten, die es zu überblicken gilt. Das wirkt sich negativ auf den Speicherbedarf und die Performance des Programms aus.
Der Einsatz von Feature Flags widerspricht im Kern dem Pull-Prinzip des Lean Manufacturing. Dieses Prinzip fordert eine bedarfsorientierte, ressourceneffiziente Produktion entlang konkreter Nachfrage. Überträgt man den Feature-Flag-Ansatz auf die industrielle Fertigung, entspräche das etwa dem Bau eines Fahrzeugs mit einem 360-PS-Motor, obwohl lediglich ein kleiner Teil der Kundschaft diese Leistung benötigt. Für die Mehrheit müsste die Leistung anschließend künstlich gedrosselt werden – ein Vorgehen, das sowohl Material als auch Energie verschwendet und den Prinzipien schlanker Produktion zuwiderläuft.
So absurd das Beispiel klingt, wird dieser Ansatz in manchen Teilen der industriellen Produktion sogar tatsächlich gewählt, weil die Mehrkosten, einer flexibleren Produktionsstraße die Mehrkosten für kastriert eingebaute Komponenten übersteigen würden. Ich persönlich halte den Ansatz aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten für äußerst fragwürdig, denn es müssen dennoch die entsprechen Rohstoffe aufgebraucht und nach dem „End of Life“ des Produktes entsorgt werden. Und auch aus menschzentrierter Sicht bin ich kritisch, denn Nutzende könnten zurecht das Gefühl bekommen, für etwas zu zahlen, das sie bereits besitzen, was in der Folge äußerst negativ auf die User Experience des Produktes einzahlen dürfte.
Reduktion durch Bauvarianten
Eine alternative Strategie sieht vor, nicht benötigte Funktionen erst gar nicht in das finale Produkt aufzunehmen, sondern sie bereits während der Bauzeit wegzulassen. Diesen Bau-Varianten-Ansatz bildet die Softwareentwicklung bereits heute über komplexe Delivery-Pipelines ab. Dass der Begriff „Pipeline“ aus der industriellen Produktion stammt, ist hierbei natürlich kein Zufall.
Der Aufbau und die Verwaltung effektiver und gleichzeitig flexibler Delivery-Pipelines ist komplex und wird mit der Anzahl der Produktvarianten zunehmend anspruchsvoller. Geht man vom UX-Idealfall aus, also einer 1:1-Personalisierung der Software für jeden einzelnen Nutzenden, müsste für jeden dieser Nutzenden eine eigene Produktvariante erstellt werden, die nur diejenigen Features enthält, die individuell relevant sind – ein Set an Funktionen, das sich im Laufe der Nutzung leider sogar verändern wird, denn mit zunehmender Erfahrung im Umgang mit dem Produkt entwickeln sich neue Bedürfnisse. Power-User stellen daher ganz andere Anforderungen als Newbies.
(Bild: ipopba/stock.adobe.com)

Der Product Owner AI Day von iX und dpunkt.verlag zeigt dir am 6. November 2025, wie du als Product Owner, Product Managerin oder mit deinem Team KI konkret in deine Arbeit integrieren kannst – von der Discovery bis zum Rollout. Tickets sind zum Frühbucherpreis erhältlich.
Im Extremfall hat also jeder einzelne Nutzende sein über die Zeit angepasstes individuelles Set von Bedürfnissen und benötigt daher auch sein entsprechendes Set an Features.
In fernerer Zukunft wird sich sicherlich zeigen, wie KI-Agenten hyper-individualisierte Produkte für einzelne Nutzende autark maßschneidern oder User Interfaces sogar während der Bedienung adaptiv „fortschreiben“. Doch welche Möglichkeiten ergeben sich, wenn eine solche Hyper-Individualisierung aktuell noch keine Option ist?
Zielgruppen-Simulation als agentische Schlüsselkompetenz
Ein Product Owner muss entscheiden, wo die Bedürfnisse verschiedener Nutzender so deckungsgleich sind, dass man sie in einer Produktvariante zusammenfassen kann und wo sie sich so stark unterscheiden, dass man besser unterschiedliche Varianten ansetzt. Diese Analyse ist sehr zeitaufwendig, weil die Beteiligten immer wieder verschiedenste Kombinationen durchspielen müssen.
Betrachtet man den Softwareentwicklungsprozess als Produktionsstraße, so lohnt es sich also in der KI-augmentierten Zukunft, eine Station vorzusehen, an der KI-Agenten herausfinden, welche Produktvarianten es minimal geben muss, um die maximale Zahl Nutzender glücklich zu machen.
Hier kommen KI-Agenten in Form von Personas, also virtuellen Nutzenden, zu Hilfe. Wie am Beispiel des Podcasts UX Therapy AI im ersten Teil der Artikelserie gezeigt, können KI-Persona-Agenten direkt miteinander sprechen, um herauszufinden, wo gemeinsame und wo sich widersprechende Bedürfnisse liegen.
Diese Art von Simulation plausibler Gesprächsausgänge ist ein komplexer Prozess, der emergente Ergebnisse liefert und sich daher nur schwerlich von einem Menschen durchspielen lässt. Per statischer Formel berechnen kann man die möglichen Gesprächsausgänge nicht, da sie eine Folge komplexer LLM-Operationen sind.

TinyTroupe simuliert die Interaktionen zwischen verschiedenen Rollen als autonome KI-Agenten (Abb. 1)
(Bild: Microsoft)
KI-Agenten als Akteure innerhalb einer LLM-Simulation zu verwenden (sogenannte Sims), ist inzwischen ein so vielversprechender Ansatz, dass Microsoft daraus ein eigenes Open-Source-Projekt mit dem Namen TinyTroupe aus der Taufe gehoben hat.
In einem weiteren Schritt könnten KI-Agenten die verschiedenen Bauvarianten nicht nur vorschlagen, sondern auf Basis einer Referenzvariante direkt implementieren. Als flexible Code-Generatoren sind sie somit Teil der automatisierten Software-Produktionsstraße, ähnlich wie humanoide Roboter voraussichtlich bald in der Güterproduktion. Es lohnt sich demnach doppelt, die Optimierung von Produktvarianten in Zeiten von KI-Agenten neu zu denken.
Entwicklung & Code
Freies Web-Publishing: Ghost 6.0 ist da
Ghost 6.0 erweitert die Open-Source-Publishing-Software unter anderem um native Web-Analysen und integriert ActivityPub, einen Standard zum Verbinden von sozialen Netzwerken. So lassen sich Ghost-Seiten direkt mit anderen Plattformen wie Mastodon, Bluesky, Threads, Flipboard, WordPress und mehr vernetzen. Anwender können Beiträge aus Ghost heraus finden und kommentieren sowie anderen Nutzern folgen, unabhängig von der eingesetzten Plattform. Die Ghost-Entwickler nutzen die per ActivityPub verbundenen Netzwerke in erster Linie als Verbreitungskanal für ihre Inhalte, so wie sie in vorigen Versionen bereits RSS-Feeds, APIs, Webhooks und klassische E-Mail-Newsletter angebunden hatten.
Das neue Analytics-Modul erfasst übliche Nutzungsdaten wie Seitenaufrufe, die Herkunft der Nutzer und deren Interaktion. Bislang mussten Ghost-Anwender hierfür auf Software von Drittanbietern zurückgreifen; die neuen nativen Web-Analysen basieren auf einer Zusammenarbeit mit Tinybird. Letztere bieten eine Plattform zur Echtzeit-Datenverarbeitung für Entwickler an. Unter der Haube kommt eine ClickHouse-Datenbank zum Einsatz, wobei es sich um ein spaltenorientiertes Open-Source-Datenbankmanagementsystem (DBMS) handelt, das speziell fürs Online Analytical Processing (OLAP) ausgelegt ist. Ghost betont, dass das Analytics-Modul datenschutzfreundlich sei und ohne Cookies auskommt.
Neu im Vergleich zu Version 5.0
Außerdem haben die Entwickler im Vergleich zur Vorgängerversion die Sprachunterstützung erweitert, die jetzt über 60 unterschiedliche Sprachen umfasst. Bislang waren alle Web-Interfaces – zum Beispiel das Login-Portal, die Suche oder Teile der Newsletter-Funktion – auf Englisch, unabhängig von der Sprache der veröffentlichten Inhalte. Jetzt können Anwender all diese Komponenten automatisch in die von ihnen eingestellte Sprache übersetzen lassen. Hierfür kommt keine KI zum Einsatz, vielmehr hat die Ghost-Community alle Textbausteine übertragen. Entsprechend bittet das Ghost-Projekt weiter um Mithilfe bei den Übersetzungen.
Die Newsletter-Funktion hat Ghost ebenfalls deutlich erweitert: Neu sind individuelle Design-Einstellungen, damit Farben und Stil der E-Mails besser zur eigenen Marke passen. Werbung lässt sich jetzt mit den Conditional Cards so steuern, dass Anzeigen ausschließlich zur korrekten Zeit beziehungsweise für die gewünschten Nutzer ausgespielt werden. Die neuen Premium-Previews zeigen regulären Abonnenten eine Vorschau auf kostenpflichtige Inhalte an. Das Feature unterscheidet automatisch zwischen den Empfängergruppen.
Newsletter können auf Wunsch jetzt die neuesten Blog-Beiträge anzeigen. Zur Interaktion mit den Empfängern ist nun eine Feedback-Funktion und ein Link zum Kommentieren der Inhalte mit an Bord. Zudem ist jetzt ein Spam-Schutz integriert, damit sich Ghost-Webseiten besser vor Sign-up-Fakes absichern lassen. Bei Zustellungsproblemen soll ein neues automatisches Troubleshooting weiterhelfen. Hat das automatische List Cleaning für einen Nutzer den Newsletter deaktiviert, kann dieser ihn künftig mit einem Klick wieder abonnieren.
Seit Version 5.0 wurde auch der Editor grunderneuert, er bietet nun eine native Bildbearbeitung und einen Verlauf der Posts, die sich so einfacher wiederherstellen lassen. Startseiten können Ghost-Nutzer stärker bearbeiten, indem sie standardmäßig Titel und Bild deaktivieren und sie anschließend über dynamische Karten nach Belieben neu aufbauen. Zudem kann man jetzt verschachtelte Listen anlegen. Über einen Ankündigungsbalken lassen sich mit wenigen Klicks beliebige Inhalte – zum Beispiel Blog-Beiträge oder Angebote für Abonnenten – am oberen Rand der Seite platzieren.
Optional können Verantwortliche eine Kommentarfunktion für Anwender aktivieren, Benachrichtigungen und Moderationswerkzeuge sind enthalten. Über eine native Suche können Nutzer außerdem das Post-Archiv durchsuchen. Viele dieser Features hatte das Ghost-Projekt bereits in den vergangenen Jahren zwischen den Major Releases freigeschaltet, da die Vorgängerversion 5.0 schon Mitte 2022 erschien.
Open Source – zum Großteil
Ghost betont, dass das Projekt Open Source bleibt und Nutzer die Publishing-Plattform weiterhin selbst betreiben können. Allerdings bietet die kommerzielle Pro-Version neben dem SaaS-Hosting und dem Support auch exklusive Funktionen. Die Preise von Ghost Pro haben sich mit Version 6.0 ebenfalls geändert: Sie steigen für die günstigeren Lizenzen; wer viele Abonnenten hat, kann sich auf niedrigere Preise einstellen.
Interessant für den Selbstbetrieb: Ghost 6.0 bringt ebenfalls eine Preview der kommenden Umstellung auf Docker Compose für Installation und Betrieb. Der Wechsel soll mit Version 7.0 geschehen. Das offizielle Set-up setzt nun auf Ubuntu 24, Node.js 22 und MySQL8; die Software lässt sich auch mit anderen Systemen betreiben, getestet wurde das jedoch nicht. Für Entwickler gibt es jetzt eine VS-Code-Erweiterung, die für die Theme-Erstellung gedacht ist. Zudem verabschiedet sich Ghost von einigen Altlasten, denn die Unterstützung für Node.js 18 und 20 wurde entfernt, dasselbe gilt für Google AMP.
Alle Änderungen in der Version 6.0 und seit dem Vorgänger 5.0 finden sich im Changelog. Auf GitHub gibt es außerdem eine Anleitung für den Selbstbetrieb.
(fo)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 Online Marketing & SEOvor 2 Monaten
Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat
Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten
















