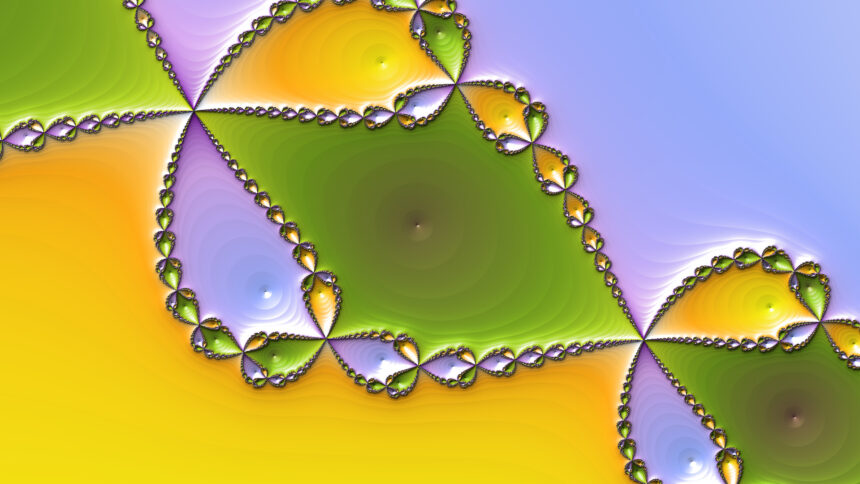Wikipedia ist die zentrale Sammlung unseres Weltwissens und längst viel mehr als nur eine Enzyklopädie. Gerade bei komplexen und sich dynamisch entwickelnden Themen von großer gesellschaftlicher Relevanz liefert Wikipedia einen Überblick über den Stand der Dinge – und sie erfüllt damit auch eine quasi journalistische Aufgabe, die kein anderes Medium so leisten kann. Hinzu kommt die Bedeutung der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte für die Reihung von Suchergebnissen und als Lieferant von Trainingsdaten für KI-Anwendungen.
Umso erfreulicher ist es, dass Wikipedia diese für demokratische Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter essenziellen Aufgaben werbefrei und auf Basis freier Software und Lizenzen erbringt, finanziert über Spenden und unter Mitwirkung von Tausenden von Freiwilligen.
Mit der großen Bedeutung der Wikipedia geht auch eine Verantwortung einher. Und wie nicht nur die jüngste Recherche der FAZ über veraltete Artikel in der Wikipedia gezeigt hat, gibt es auch hartnäckige Probleme, die nach einer Lösung verlangen. Besonders augenscheinlich ist das bei Artikeln über lebende Personen, deren öffentliche Persona maßgeblich und dauerhaft von der Darstellung in der Wikipedia geprägt wird. Gleichzeitig wird explizit davon abgeraten, den eigenen Artikel selbst zu editieren.
Gerade für politische exponierte Personen, für Frauen und People of Color, die ohnehin bei öffentlichen Auftritten regelmäßig mit Hass und Hetze auf Social Media konfrontiert sind, ist es eine Zumutung, sich außerdem noch mit Umgestaltungen und Verfälschungen ‚ihres‘ Wikipedia-Beitrags auseinandersetzen zu müssen. Hier fehlen professionelle Ansprecherpartner:innen, die auch Artikel editieren dürfen, ganz besonders.
Hinzu kommt, dass sogenanntes „bezahltes Schreiben“ in der Wikipedia längst an der Tagesordnung ist. Erforderlich ist hierfür nur die Offenlegung, dass ein Beitrag im Rahmen von bezahltem Schreiben gemäß Nutzungsbedingungen im Auftrag geleistet wurde. Mit anderen Worten, wer sich professionelle Wikipedia-Begleitung durch eine Agentur leisten kann, hat weniger Probleme als jene (Privat-)Personen, die das nicht tun können.
Ebenso hartnäckig wie die Probleme – veraltete Artikel, mangelnde Diversität unter den Freiwilligen und fehlende Ansprechpartner:innen – ist aber die Weigerung von Teilen der Wikipedia-Community, über die Etablierung von hauptamtlichen Redaktionen direkt bei Wikimedia auch nur ernsthaft zu diskutieren. Jüngstes Beispiel ist ein Blogeintrag bei Wikimedia Deutschland, der argumentiert „Warum das Ehrenamt zählt und bezahltes Schreiben keine Lösung ist“.
Im Folgenden möchte ich deshalb die fünf wichtigsten Fragen beantworten, die mir in der Debatte zu von Wikimedia bezahlten Redaktionen immer wieder unterkommen.
Könnte bezahltes Schreiben die Motivation der Ehrenamtlichen schwächen?
Die größte und am häufigsten vorgebrachte Sorge ist Motivationsverlust unter den freiwilligen Autor:innen. So schreibt Hanna Klein im oben verlinkten Blogeintrag:
Wenn andere für dieselbe Arbeit bezahlt würden, könnte das demotivierend wirken – und dazu führen, dass sich weniger Menschen ehrenamtlich beteiligen.
Es ist sicher kein Zufall, dass die gesamte Passage im Konjunktiv formuliert ist. Denn natürlich mag so ein Effekt auf einzelne freiwillige Autor:innen zutreffen. Allerdings spricht eine Vielzahl an Gründen dagegen, dass es sich dabei um eine weitverbreitete Sichtweise handelt. Denn die Gründe, warum Menschen bei der Wikipedia mitarbeiten, sind vielfältig: aus Freude am Schreiben, aus politischer Überzeugung, um Wissen zu teilen oder einfach, um Teil einer Community zu sein. Diese Motive verschwinden nicht, nur weil es auch ein paar bezahlte Redakteur:innen gibt.
Im Gegenteil: Ein Nebeneinander von bezahlten und freiwillig Mitarbeitenden ist in vielen Bereichen völlig selbstverständlich. Und zwar nicht nur in Organisationen wie dem Roten Kreuz, der Tafel oder dem Technischen Hilfswerk, sondern auch in jener Szene, aus deren Mitte heraus die Wikipedia entstanden ist: freie und offene Software. Viele Projekte florieren gerade deshalb, weil bezahlte Entwickler:innen die oft undankbaren, aber notwendigen Aufgaben übernehmen – etwa Bugfixes, Tests, Sicherheitsupdates. So ist es auch bei der (Weiter-)Entwicklung der Mediawiki-Software, auf der Wikipedia selbst läuft. Diese wird ganz maßgeblich durch Entwickler:innen vorangetrieben, die von der Wikimedia Foundation dafür bezahlt werden.
Aber gibt es nicht Forschung, die negative Effekte von Bezahlung auf intrinsische Motivation belegt?
In der Tat gibt es Studien zum sogenannten Crowding-out-Phänomen im Bereich der Motivationsforschung. Wenn Menschen für etwas bezahlt werden, das sie zuvor freiwillig getan haben, kann das ihre intrinsische Motivation untergraben. Das – wenn auch empirisch umstrittene – Lehrbuchbeispiel ist die finanzielle Vergütung für Blutspenden. So sinkt in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen die Bereitschaft zur Blutspende, wenn sie als ökonomische Transaktion und nicht als moralische Tugend verstanden wird.
Vor allem als unzureichend empfundene monetäre Anreize wirken sich negativ auf intrinsische Motivation und geleistete Beiträge aus. Es wäre also in der Tat keine gute Idee, sämtlichen rund 6.000 Freiwilligen ein bisschen Geld für ihre Arbeit zu bezahlen. Aber das schlägt meines Wissens nach auch niemand vor. Stattdessen geht es um die Finanzierung von Vollzeitstellen für gezielt ausgewählte Aufgaben, die allein von Freiwilligen derzeit nicht in ausreichendem Maße erfüllt werden.
Hat die Wikipedia überhaupt genug Geld dafür, um Leute für das Schreiben zu bezahlen?
Ja. Die Wikimedia Foundation als Organisation hinter der Wikipedia erhält genug Spenden, um zumindest in den größeren Sprachversionen Redaktionen zu finanzieren. Alleine Wikimedia Deutschland hat 2024 rund 11,7 Millionen Euro an Spenden und 6,2 Millionen Euro an Mitgliedsbeiträgen eingenommen, Tendenz steigend. Inzwischen verfügt der Verein über Rücklagen in Höhe eines Jahresspendenaufkommens von 11,6 Millionen Euro („Noch nicht verbrauchte Spendenmittel“).
Auch wenn ein großer Teil des Spendenaufkommens an die Wikimedia Foundation weitergeleitet wird – deren Nettovermögen inzwischen rund 230 Millionen US-Dollar beträgt -, machen diese Beträge deutlich, dass Geld für die Bezahlung von Redaktionen vorhanden wäre. Und gut möglich, dass die Spendenbereitschaft unter den Leser:innen sogar noch wüchse, wenn das Geld unmittelbarer als derzeit in die Verbesserung der Wikipedia zurückfließt.
Aber ist eine zwanzig- bis dreißigköpfige Redaktion nicht viel zu klein, um Millionen von Artikel zu pflegen?
Natürlich kann und sollen bezahlte Redakteur:innen nicht sämtliche Inhalte der Wikipedia beisteuern. Das würde in der Tat nicht funktionieren, ist aber auch gar nicht notwendig. Wie oben ausgeführt, ist es unwahrscheinlich, dass ein größerer Teil der Freiwilligen sofort die Arbeit einstellt, nur weil es auch ein paar bezahlte Redakteur:innen gibt.
2025-07-14
215.12
19
– für digitale Freiheitsrechte!
Euro für digitale Freiheitsrechte!
Umgekehrt hätten die Redakteur:innen vor allem die Aufgabe, die Freiwilligen zu entlasten, indem sie ihnen als Ansprechpartner:innen dienen und sich um Dinge kümmern, für die sich keine Freiwilligen finden oder wo verlässliche Verfügbarkeit erforderlich ist, die mit Freiwilligen schwer herzustellen ist. Letzteres betrifft vor allem die oben erwähnten Artikel über lebende Personen.
Welche Aufgabenfelder von hauptamtlichen Redaktionen prioritär bearbeitet werden, sollte natürlich im Austausch mit der Freiwilligen-Community festgelegt werden. Denkbar wäre es, viel besuchte, aber länger nicht bearbeitete Artikel systematisch zu aktualisieren und zu überarbeiten.
Könnte verschärfte Haftung für Inhalte zu Problemen führen?
Schon heute ist es so, dass die Wikimedia Foundation für rechtswidrige Inhalte haftet, sofern sie Kenntnis davon besitzt. An dieser sogenannten „Forenhaftung“ für Beiträge von Freiwilligen würde sich durch bezahlte Redaktionen erst mal nichts verändern. In diesem Zusammenhang ist aber die radikale Transparenz der Wikipedia wieder hilfreich: Weil jede Änderung und Sichtung dauerhaft und transparent nachvollziehbar in der Versionsgeschichte von Wikipedia-Artikeln dokumentiert ist, wäre auch mit bezahlten Kräften keine umfassende Haftung für alle Inhalte in der Wikipedia verbunden.
Klarerweise würde die Wikimedia Foundation aber für Beiträge hauptamtlicher Redakteur:innen sowie für die von ihnen gesichteten Beiträge von Dritten haften. Das gilt aber auch für jedes andere Online-Medium und ist angesichts der Relevanz und Bedeutung der Wikipedia durchaus sinnvoll.
Fazit
Niemand will das Ehrenamt in der Wikipedia abschaffen. Im Gegenteil: Es ist das Fundament, auf dem Wikipedia ruht. Aber genau deshalb braucht es eine Debatte darüber, wie dieses Fundament auch in Zukunft tragfähig bleibt. Das bedeutet auch, darüber zu sprechen, wo gezielte Bezahlung sinnvoll sein kann – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung.
Natürlich wird auch eine Wikipedia mit bezahlten Redaktionen nie fehlerfrei, vollständig oder fertig sein. Das kann und soll auch nicht das Ziel sein. Aber mit bezahlten Kräften ließen sich die größten und seit Jahren ungelösten Probleme der Wikipedia zumindest ein wenig lindern.
Statt also jegliche Form von spendenfinanziertem Schreiben pauschal abzulehnen, wäre es sinnvoller, darüber zu diskutieren, auf welche Weise Spendengelder am effektivsten zur Verbesserung der Wikipedia investiert werden könnten – und wo auch weiterhin besser primär auf ehrenamtliche Mitarbeit gesetzt werden sollte. Pilot- und Testprojekte in einzelnen ausgewählten Sprachversionen würden sich dafür anbieten.
Eine ergebnisoffenere Diskussion der Frage von spendenfinanzierten Autor:innen würde der auf ihre Offenheit so stolzen Wikipedia-Community gut zu Gesicht stehen.