Künstliche Intelligenz
Was sich bei den VMware-Alternativen gerade tut
Nach der Übernahme von VMware hatte Broadcom das bisherige Lizenzmodell völlig umgekrempelt und die Lizenzpreise vor allem für kleinere Editionen seiner Produkte stark erhöht. Daher halten aktuell viele Kunden Ausschau nach Alternativen zu VMware.
Sie lassen sich grob in drei Klassen einteilen: Als erstes hyperkonvergente Infrastrukturplattformen (HCI), die neben der Virtualisierung auch die Speicherdienste durch die gleichen Serversysteme mit bereitstellen. Die HCI-Einführung erfordert dafür freigegebene und zertifizierte Serverhardware. Das Flaggschiff VMware Cloud Foundation (VCF) fällt ebenfalls in diese Kategorie.
Des Weiteren stehen klassische Hypervisoren bereit – in diese Kategorie fallen Microsofts Hyper-V, KVM-basierte Produkte wie Proxmox oder HPEs Morpheus VM Essentials sowie das französische Unternehmen Vates, das mit XCP-ng einen Open-Source-Spin-off des XenServers anbietet.
Die dritte Kategorie sind Produkte auf Basis des von Red Hat initiierten Open-Source-Projekts KubeVirt. Es erweitert Kubernetes um eine Virtualisierungs-API und ermöglicht die Ausführung und Verwaltung herkömmlicher VMs direkt auf Kubernetes.
Die Konkurrenten: HCI
Nutanix ist seit 2009 auf dem Markt aktiv und kann für sich reklamieren, die HCI-Technik für den x86-Virtualisierungsmarkt erfunden zu haben. Bis vor Kurzem hat eine Nutanix-Einführung auch die Anschaffung von HCI-fähiger Hardware vorausgesetzt, die Anbindung externer Storage-Systeme hatte Nutanix erst Mitte 2024 zugelassen – und derzeit sind hier nur zwei Speichersysteme von Dell und PureStorage nutzbar.
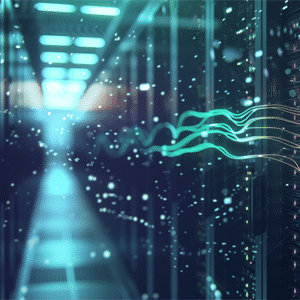
IX-WORKSHOP: Hands-on: Migration von VMware zu Proxmox —- In diesem Workshop erhalten Sie effiziente Strategien für eine möglichst schmerz- und ausfallfreie Migration und führen diese während der Schulung selbst in einem Labor durch. Neben diesem praktischen Teil lernen Sie, wie Sie eine Migration planen und erhalten wertvolle Ansatzpunkte für einen erfolgreichen und möglichst geräuschlosen Umzug.
Der Workshop findet online statt, weitere Informationen und Tickets gibt es unter heise.de/s/Ndll0
Im Wesentlichen kann Nutanix die Features der VMware Cloud Foundation mit seiner HCI-Speicherplattform, dem eigenen Hypervisor AHV und Netzwerkdiensten (mit Nutanix Flow) abbilden. Auch das Hosting von containerbasierten Kubernetes-Applikationen und KI-Diensten bietet der Hersteller an und hat somit das umfassendste Angebot. Trotz der Aufholjagd ist VMware im Detail allerdings nach wie vor in fast allen Bereichen etwas voraus. Von der Preisgestaltung her spricht Nutanix den gehobenen Mittelstand und große Unternehmen an, für KMUs ist der Einstieg mit circa 60.000 Euro für Soft- und Hardware zu teuer.
Aktuell versuchen weitere Hersteller im HCI-Markt mit günstigeren Angeboten Fuß zu fassen, zu nennen sind hier der US-Hersteller Verge.io, der britische Anbieter StorMagic mit SvHCI und der chinesische Anbieter Sangfor Technologies, der gerade an einem Markteintritt in Deutschland arbeitet. Auch der US-Speicherspezialist DataCore kann nach der kürzlich erfolgten Akquisition von StarWind nun ebenfalls mit einem KVM-basierten HCI-Dienst für kleine Umgebungen aufwarten. Nicht zu vergessen Microsoft: Azure Local, die Weiterentwicklung von Azure Stack HCI, zielt allerdings auf Kunden, die mit einer Verwaltung über die Cloud leben können.
Klassische Hypervisoren
Hier dominiert inzwischen KVM. Insbesondere bei kleinen Kunden ist das österreichische Proxmox beliebt. Allerdings ist man entweder auf Inhouse-Kompetenz oder einen guten Partner angewiesen, der Anbieter selbst hat keine Supportstrukturen, die die Bedürfnisse von Enterprise-Kunden erfüllen können. Proxmox selbst ist stabil und hat sich einen guten Ruf erarbeitet.
Vielversprechend wirkt das vergleichsweise neue Angebot HPE Morpheus VM Essentials Software (MVME), es stammt aus der Akquisition von Morpheus Data. Das Produkt orientiert sich mit seinen Managementwerkzeugen (VM Essentials Manager, das Pendant zum vCenter) und dem Clusterdienst (HVM Cluster) an der klassischen Architektur von vSphere. Aktuell bietet HPE das Produkt zu einem Kampfpreis an, laut Preisliste für 600 US-Dollar pro CPU-Sockel (unlimitierte Kerne) und Jahr. Die Verwaltung von VMware und MVME ist über ein intuitives GUI integriert möglich.
Das französische Unternehmen Vates bietet etwas Ähnliches auf Basis des Virtualisierungsveteranen XenServer an. Attraktiv ist vor allem die Preisstruktur (Pro-Version mit mindestens drei Hosts für 1.000 Dollar pro Host und Jahr, Enterprise-Version mit mindestens vier Hosts für 1.800 Dollar pro Host und Jahr, jeweils inklusive Support).
Natürlich ist auch Microsoft noch innerhalb der klassischen Hypervisor-Welt aktiv. Im Zuge der Fokussierung des Herstellers auf die Azure Cloud und auf Dienste, die über Azure Arc verwaltet werden, spielt das klassische Hyper-V und die zugehörige Managementumgebung System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) keine große Rolle mehr – auch wenn beide Produkte mit Windows Server 2025 und SCVMM 2025 vor Kurzem eine Auffrischung erhalten haben. Die modernere, Cloud-angebundene Variante Azure Local gehört in die HCI-Kategorie.
Weg in die Cloud
Wer sich auf eine cloudnative Architektur einlassen will, wird bei Kube-Virt und Red Hats kommerzieller OpenShift Virtualization fündig. Eine Umgewöhnung an die Kubernetes-Herangehensweise ist nötig, vSphere kann man nicht direkt ersetzen. Preislich hat Red Hat mit der auf die Verwaltung von VM-basierten Workloads abgestimmten OpenShift Virtualization Engine (OVE) einen attraktiven Preispunkt getroffen, die umfassenderen OpenShift-Varianten (Kubernetes Engine, Container Platform und Platform Plus) sind deutlich teurer.
Das Ökosystem kompatibler Server, Speichersysteme und Backup-Produkte wächst schnell. Allerdings stellt insbesondere die Speicherbereitstellung einen Knackpunkt dar, denn man muss ein Container Storage Interface (CSI) bereitstellen – Kubernetes-Container sind hier von Haus aus deutlich dynamischer als virtuelle Maschinen. Allerdings ziehen die großen Speicheranbieter alle nach und bieten zunehmend Systeme mit den nötigen Schnittstellen an. Wer im Netzwerkbereich weiter gehende Schutzmechanismen sucht, wird beim Partnerunternehmen Isovalent fündig (inzwischen Teil von Cisco) oder kann zusätzlich auf Ciscos SDN-Plattform ACI setzen. Für Kunden, die eine grundlegende Erneuerung ihrer Plattform suchen, kann ein KubeVirt-basiertes Produkt eine Ergänzung und langfristige Alternative darstellen.
(fo)
Künstliche Intelligenz
Fast jede zweite Kommune ohne Elektroauto-Ladepunkte
Knapp 45 Prozent der Kommunen in Deutschland verfügen über keine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch hervor. 4923 der insgesamt 10.978 Kommunen in Deutschland verfügen demnach über keine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur.
„Dass es in beinahe jeder zweiten Kommune im Land keine Lademöglichkeit für ein E-Auto gibt, ist ein peinliches Versagen der Verkehrswende“, sagte Bartsch der „Rheinischen Post“ (Freitag). Damit Menschen auf E-Mobilität umsteigen, müsse neben Preis und Reichweite des Fahrzeugs auch die landesweite Infrastruktur „top“ sein. „Wenn in den Bundesländern bis zu Dreiviertel der Kommunen ohne Ladepunkt sind, wird der ländliche Raum erneut inakzeptabel benachteiligt“, betonte der Linken-Politiker.
Rheinland-Pfalz hat schlechteste Ladeinfrastruktur
Bei größeren Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern ist die Versorgung deutlich besser als bei kleineren: Dort sei nahezu jede Kommune (98 Prozent) „mit mindestens einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt ausgestattet“, so das Verkehrsministerium.
In Berlin, Hamburg und Bremen sowie im Saarland und in Nordrhein-Westfalen gibt es eine flächendeckende Ausstattung (je 100 Prozent). Am schlechtesten aufgestellt zeigt sich Rheinland-Pfalz: Nur gut jede vierte Kommune (26,5 Prozent) verfügt dort über eine öffentliche Ladeinfrastruktur.
Aus der Antwort des Ministeriums geht zudem hervor, dass der Bund seit Beginn der staatlichen Förderung bis Ende Juli rund 9,5 Milliarden Euro für die Förderung von Elektroautos ausgegeben hat. Trotzdem gehe es „der deutschen Autoindustrie so schlecht wie nie“, sagte Bartsch. „Eine Ursache ist die vernachlässigte Infrastruktur für E-Mobilität.“
(afl)
Künstliche Intelligenz
Gehälter 2025: Das verdienen IT-Berater in Deutschland
Der IT-Berater zählt zu den bestbezahlten IT-Berufen. Sie müssen nicht nur tiefes technisches Verständnis mitbringen, sondern auch die betriebswirtschaftliche Logik von Projekten verstehen. Hinzu kommt Fachwissen über die jeweilige Branche, in der sie tätig sind – vom Finanzsektor bis zur Industrie.
- IT-Berater gehören zu den bestbezahlten Berufen in der IT-Branche und müssen technisches, betriebswirtschaftliches sowie branchenspezifisches Fachwissen kombinieren.
- Die Tätigkeit umfasst die Begleitung von Unternehmen bei der Einführung neuer Systeme oder der Optimierung bestehender Strukturen.
- Stellenausschreibungen für IT-Berater verlangen oft Spezialisierung und bieten Quereinsteigern mit relevanten Fähigkeiten und Erfahrungen ebenfalls Chancen.
IT-Berater oder -Consultants begleiten Unternehmen bei der Einführung neuer Systeme oder optimieren bestehende Strukturen. Sie analysieren Prozesse, identifizieren Schwachstellen und entwickeln Lösungen. Meist betreuen sie Projekte vollständig, von der Planung bis zur Umsetzung.
Berater stehen zudem im ständigen Austausch mit Kunden, Mitarbeitern oder der Führungsebene. Sie müssen technische Maßnahmen verständlich erklären, aber auch wirtschaftliche Entscheidungen vermitteln. In diesem Artikel erklären wir, wie viel Geld sie mit diesen Fähigkeiten verdienen können und welche Faktoren das Gehalt beeinflussen.
Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Gehälter 2025: Das verdienen IT-Berater in Deutschland“.
Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.
Künstliche Intelligenz
Nie mehr öde Meetings: Zucks Display-Brille hat Potenzial
Natürlich funktioniert erstmal etwas nicht. Klar. Weniger klar ist, ob es eine geschickt-charmante Art ist, das Publikum zum Lachen zu bringen, oder ob wirklich Probleme auftreten. Der früher als roboterhaft verrufene Mark Zuckerberg hat das Spiel mit dem Publikum inzwischen sehr gut drauf – auch bei der Connect 24 lief zum Vergnügen der Zuschauer nicht alles rund.
In diesem Jahr trifft es zuerst einen Kollegen, der mit dem neuen KI-Assistenten Live AI eine Soße für sein Sandwich zusammenstellen soll. Live AI sieht und hört per Brille alles, nimmt dazu Informationen des Trägers entgegen und kann zugleich das Internet durchforsten. Doch die KI streikt – oder das WLAN.

Das Display zeigt einen Tomatensalat.
(Bild: Meta)
Und auch Zuck kann einen Anruf mit der neuen Display-Brille nicht über das dazugehörige Armband annehmen. Absicht oder nicht, die Scherze darüber funktionieren. Zucks Lässigkeit ist glaubhaft. Seine Brillen und die Verkaufszahlen geben ihm womöglich recht, dieses Mal nicht auf das falsche Pferd gesetzt zu haben, wie in den Augen vieler mit dem Metaverse. Und sie geben ihm offenbar Sicherheit.
Das neue POV der Meta Ray-Ban Display
Zu Beginn seiner Keynote in der Nacht zum Donnerstag wird Zuck, wie er sich nennt, in einem Video gezeigt. Eine Live-Aufnahme. Er solle nun auf die Bühne kommen, ruft jemand. Zuck setzt seine neue „Meta Ray-Ban Display“ auf, die Perspektive wechselt zu seiner Brillenkamera. POV – das steht für Point of View und wird mittlerweile für eigentlich alles genutzt, was man aus seiner eigenen Sicht zu sagen hat.

Eva-Maria Weiß ist Journalistin für Social Media, Browser, Messenger und allerlei Anwendungen im Internet. Seit ChatGPT ist KI in den Vordergrund gerückt.
POV wählt Zuck bei Spotify die passende Musik und geht los. Auf dem Weg zur Bühne schaut er noch den Gruppenchat mit den Kollegen an – samt Fotos, auch Videos sind möglich. Alles ist auf dem Display der neuen Brille zu sehen. Dieses Display ähnelt dabei einem HUD – etwa der Anzeige der Geschwindigkeit im Auto. Nur, dass es einfach viel mehr kann und viel besser ausschaut. „Realistische Hologramme“, sagt Zuck dazu. Ein High-Resolution-Display steckt dahinter, 600 × 600 Pixel. Nutzbar bei Tag und Nacht, mit Transitions-Brillengläsern, absolut unsichtbar für Mitmenschen.
Natürlich funktioniert die Brille grundsätzlich nur mittels einer Verbindung zum Smartphone und dort konkret der Meta AI App. Doch Zuck drückt noch kurz vor der Bühne demonstrativ einer Kollegin sein Smartphone in die Hand. Smarte Brillen sollen in seiner Zukunftsvision das Smartphone ablösen, er spricht schon seit Langem von einer neuen Gerätekategorie. Zu der Hoffnung gehört auch, dass Meta damit unabhängiger von anderen Hardware-Herstellern wird. Bisher müssen sie schließlich Apps für Apples und Googles Geräte anbieten – was im Fall von Apple auch schon zu Streit um Abgaben und Datenabfluss führte.
KI macht smarte Brillen erst wirklich möglich
Nun ist die Brille mit Display also da. Die hatten alle vorab erwartet. Möglich ist Zuckerbergs Vision von smarten Brillen dank Künstlicher Intelligenz (K). Erst Large Language Models haben möglich gemacht, dass man ein Gerät über die Sprache steuern kann. Hinzu kommt bei Meta nun ein Armband, das „Neural Band“. Kleine Muskelbewegungen wie ein Tippen (Pinch) von Zeigefinger und Daumen reichen aus, und das Armband sendet Signale, um etwa einen Dienst auszuwählen, Musik zu starten oder eine Nachricht zu lesen. Alles absolut unauffällig.

Zuckerberg dreht einen imaginären Lautstärkeregler.
(Bild: Screenshot/Facebook)
Tatsächlich gehört es zu den eher unangenehmen Momenten, wenn man mit einer „Ray-Ban Meta“ mitten in der Menschenmenge spricht, um beispielsweise zu erfahren, vor was für einem Gebäude man steht. Den Tipp auf den Bügel zur Steuerung kennt man schon vom Vorgängermodell. Das Armband hat den Vorteil, besonders unauffällig zu sein.
Die Unauffälligkeit sorgt dann auch für einen Zwiespalt – wir erinnern uns an die Google Glass und die Kampagne gegen „Glassholes“. Zuckerberg sagt, das Smartphone habe uns von der Umgebung getrennt. Die Brille mache es in seinen Augen besser, indem wir mit der Umwelt verbunden bleiben. Doch die Umwelt könnte auch ein Gesprächspartner am Esstisch sein, der nicht mitbekommt, dass wir gerade in der Brille Nachrichten von anderen Leuten lesen. Seien wir ehrlich: Es gibt genug Veranstaltungen, bei denen sich jeder mal unauffällige Ablenkung gewünscht hat, aber es kann auch unpassend sein.
800 US-Dollar für viel Spielerei
Die Brille soll schlanke 799 US-Dollar kosten. Der Verkaufsstart für Deutschland ist noch unbekannt. Es werden wohl regulatorische Gründe sein. Seltsam, dass die Ray-Ban Meta Display aber kommendes Jahr schon nach Frankreich und Italien kommen soll. Man darf also Hoffnung haben, dass Deutschland bis dahin auch noch auf der Liste steht. Meta kann dazu bisher keine Auskunft geben.
Ob die Brille bei dem Preis ein Verkaufsschlager wird, wie die klassische Ray-Ban Meta (RBM) es bereits ist? Das ist doch ein bisschen zu bezweifeln. Es wird aber sicherlich einige Menschen geben, die ausreichend gerne spielen und dabei sind, um das Geld auszugeben. Oder es gibt genug Menschen, die in vielen langweiligen Meetings und Veranstaltungen sitzen, für die sie Ablenkung brauchen.
Anders dürfte es dafür bei den beiden weniger prominent gezeigten Brillen sein. Die RBM ist bereits ein Klassiker, sie wird auch weiterhin Absatz finden. Die Oakley Meta HSTN hat ebenfalls genug Stylefaktor und denselben Funktionsumfang. Zuckerberg betont immer wieder, wie wichtig das Aussehen ist und da mag er absolut recht haben. Niemand will mit einem Klotz im Gesicht herumlaufen. Meta tut gut an der Partnerschaft mit EssilorLuxottica, dem Unternehmen hinter Ray-Ban, Oakley und so ziemlich jeder bekannten Brillenmarke.
Die Oakley Meta Vanguard ist für Sportler, die ohnehin ein teures Hobby haben oder ohnehin Profis sind, garantiert ausgesprochen reizvoll. Kein Rennradfahrer ohne Brille, warum also dann nicht gleich eine mit deutlich mehr hilfreichen Funktionen.
Aber: Meta warnt vor der Keynote, es ginge um die Zukunft – und die könne sich anders gestalten, als man denkt.
(emw)
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 1 Monat
Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 4 Wochen
Entwicklung & Codevor 4 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 2 Wochen
Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Tagen
UX/UI & Webdesignvor 3 TagenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 3 Monaten
Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 Digital Business & Startupsvor 3 Monaten
Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier
















