Künstliche Intelligenz
Wiresharks kleiner Bruder: Die Zukunft des Cloud-Analysetools Stratoshark
Wie Wireshark für Netzwerke soll Stratoshark Transparenz für Betriebssysteme und Apps schaffen durch die Analyse von Systemcalls und Logs. Das Open-Source-Tool baut in großen Teilen auf dem Quellcode von Wireshark auf. Dahinter steht Wireshark-Erfinder Gerald Combs, dessen Arbeitgeber Sysdig auch die zugehörigen Tools Falco und Sysdig zur Erfassung der Aktivitäten und Logs liefert.
Mitte Mai hat sich Sysdig entschieden, Stratoshark in die Hände der gemeinnützigen Wireshark Foundation zu legen. Über die Hintergründe sprach die iX-Redaktion mit dem Wireshark-Erfinder Gerald Combs und Alexander Lawrence, Director of Cloud Security Strategy bei Sysdig.
iX: Gerald, was hat es mit der Spende von Stratoshark an die Wireshark Foundation auf sich?
Gerald Combs: Die Wireshark Foundation ist eine gemeinnützige Organisation in den USA, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen im Umgang mit Netzwerkanalyse auszubilden. Mit der Spende von Stratoshark erweitern wir unsere Mission: Bisher liegt unser Fokus auf der Paket-Analyse, künftig wollen wir aber auch tief in Betriebssystem-Ereignisse blicken können.
iX: Was war die Motivation hinter der Entwicklung von Stratoshark und worin unterscheidet es sich konzeptionell von Wireshark?
Combs: Wireshark zerlegt Pakete mit seiner Dissektions-Engine in alle Protokollbestandteile, ermöglicht Filterung, Drill-Down und ausführliche Analysen. Stratoshark dagegen arbeitet nicht auf Basis von Netzwerk-Paketen, sondern auf Basis von Systemaufrufen und Protokollnachrichten. Es erlaubt ähnliche Filter- und Analysemöglichkeiten – nur eben in der Systemaufruf- und Cloud-Welt. Das User-Interface gleicht stark dem von Wireshark, damit Nutzer sofort zurechtkommen. Unter der Haube nutzen wir viele gemeinsame Bibliotheken, haben sie aber so erweitert, dass sie Systemaufrufe und Cloud-Logs interpretieren können. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Cloud-Systeme, aber Sie könnten dies auch nutzen, um jedes Linux-System wirklich in Ordnung zu bringen.
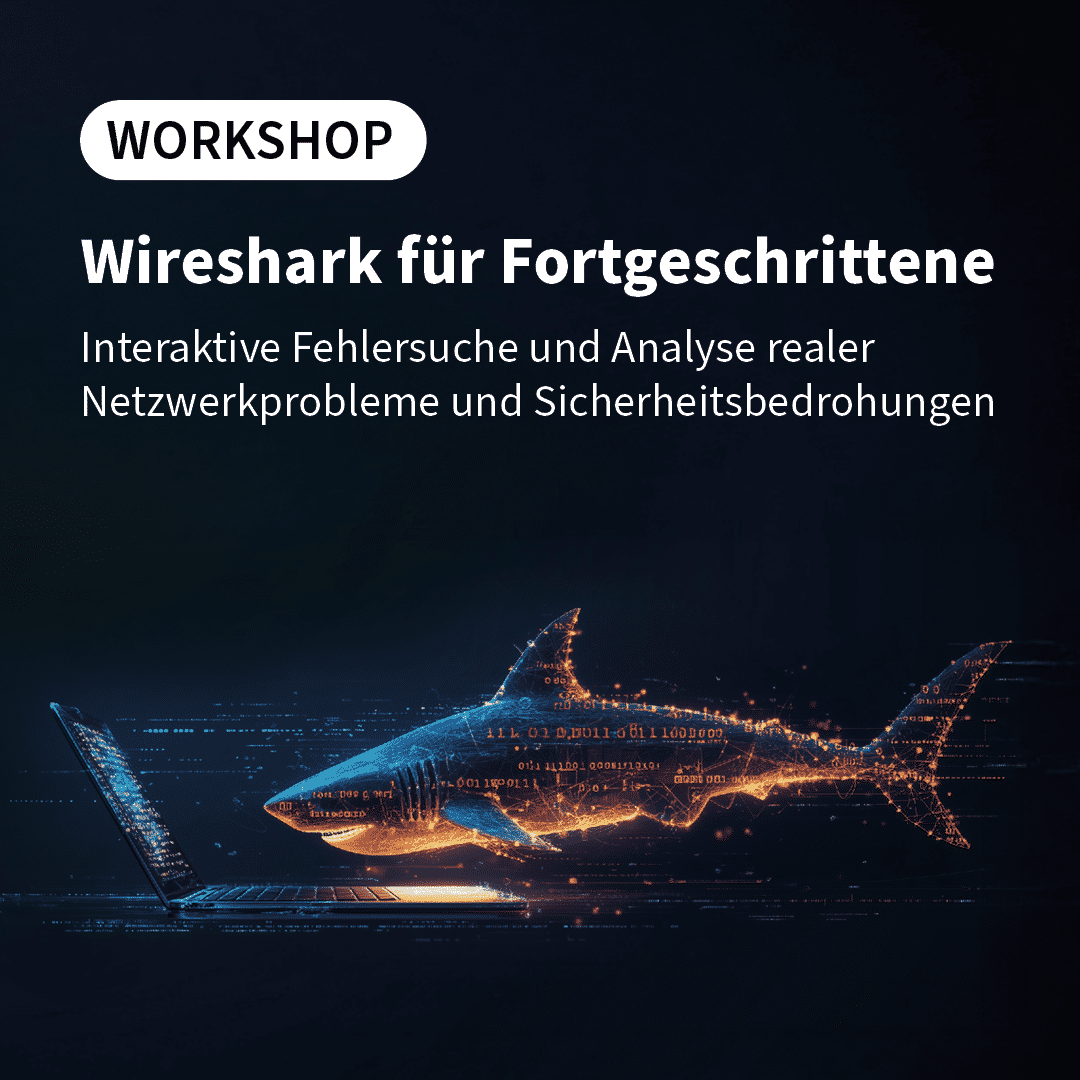
In diesem Praxis-Workshop vertiefen Admins ihre Wireshark-Kenntnisse, indem Sie reale Netzwerkprobleme und Sicherheitsbedrohungen in anonymisierten Fallstudien analysieren. Der Schwerpunkt liegt auf der praxisorientierten Fehlersuche in Netzwerkprotokollen wie IP, Ethernet, ICMP, HTTP und UDP. Dazu gehört die Analyse des TCP-Handshakes ebenso wie die Untersuchung von Performance-Problemen bei TCP-Verbindungen. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, Nutzdaten mit selbst entwickelten Skripten zu extrahieren und spezifische Pakete mit erweiterten Capture-Filtern langfristig aufzuzeichnen.
Anmeldung und Termine unter heise.de/s/m1eL0
iX: Wo liegt der Haupteinsatz von Stratoshark? Mehr als Debugging-Werkzeug oder als Sicherheits-Analysetool?
Combs: Im Moment liegt der Fokus auf der Sicherheitsanalyse. Ursprünglich haben wir Stratoshark als Ergänzung zu Falco entwickelt – einem hostbasierten IDS (Intrusion Detection System, Anmerkung der Redaktion) für Systemaufrufe. Falco erkennt und meldet verdächtige Ereignisse; Stratoshark erlaubt es, diese Events detailliert nachzuverfolgen. Wie in der Networking-Welt möchte man oft einen tieferen Einblick in das bekommen, was auf dem System vor sich geht.
iX: Wie viel Prozent des Codes teilt Stratoshark mit Wireshark? Wir haben Dissektions-Engines, Baumstrukturen zur Analyse, wie in Wireshark. Aber wie viel Prozent Code teilen sich die beiden Tools?
Combs: Ich habe keinen konkreten Prozentsatz, aber es gibt eine Menge Code, der geteilt genutzt wird. Das ist auch beabsichtigt. Wir haben diese wirklich leistungsstarke Analyse-Engine, die quasi nur darauf wartete, verwendet zu werden. So haben wir sie angepasst, um sie auch für Systemaufrufe zu verwenden. Der UI-Code sieht wieder sehr vertraut aus. Das ist beabsichtigt. Wir möchten diesen vertrauten Workflow haben, den man bereits aus Wireshark kennt. Wer die Arbeit mit Wireshark gewohnt ist, kann mit Stratoshark schnell loslegen und umgekehrt. Bei einigen der UI-Widgets gibt es ein paar Unterschiede in den Elementen.
Der andere große Unterschied ist die Art und Weise, wie wir die Ereignisse analysieren, die hereinkommen. Wir haben anderen Code für eingehende Ereignisse: Es ist ein Plug-in namens Falco, genauer Falco Bridge. Den Namen werden wir wohl noch in Falco Events ändern.
iX: Für welche Betriebssysteme ist Stratoshark verfügbar?
Combs: Offiziell bieten wir auf den Wireshark-Seiten Pakete für Windows und macOS an. Für Linux-Distributionen ist die Geschichte etwas komplexer. Die verschiedenen Linux-Distributionen haben traditionell ihre eigenen Wireshark-Pakete angeboten. Meine Hoffnung ist, dass sie das auch mit Stratoshark machen. Ich weiß, dass das für Debian und Ubuntu in Arbeit ist. Ich müsste aber prüfen, ob dies auch für Fedora der Fall ist. Die Erfassung von Systemaufrufen funktioniert derzeit nur unter Linux.
iX: Wie bekommt Stratoshark die relevanten Daten?
Combs: Wir nutzen die Bibliotheken libsinsp and libscap, die von Falco und dem CLI-Tool Sysdig verwendet werden, um Systemaufrufe zu erfassen. Sysdig war, glaube ich, das erste Tool, das diese beiden Bibliotheken verwendete. Die Erfassung erfolgt wahlweise über ein Kernel-Modul oder eBPF als eine Art neuere Standardtechnologie. Ich denke, wir werden uns in Zukunft auf eBPF konzentrieren. Zusätzlich existiert eine Plug-in-Schnittstelle, mit der man etwa Daten aus GCP- oder Kubernetes-Überwachungsprotokollen sowie aus AWS Cloud Trail einspeisen kann.
iX: Was steht als Nächstes auf der Stratoshark-Roadmap?
Combs: Die aktuelle öffentliche Version ist 0.9 und wir müssen zunächst alles in Form bringen. Wir arbeiten gerade an der Version 1.0, besonders an erweiterten Protokollanalyse-Funktionen. Danach folgt wahrscheinlich die finale Veröffentlichung im Spätsommer.
Künstliche Intelligenz
Vier Mähroboter im Test: Kein Kabel, kein Stress – und sicher für Igel & Co?
Mähroboter in Betrieb zu nehmen, ist einfacher geworden. Seit zwei Jahren gibt es mehr und mehr Geräte, deren Arbeitsbereich man nicht mehr mit einem zu verlegenden Begrenzungskabel einhegen muss. In der Gartensaison 2025 sind zwei weitere Trends für einen schnelleren Mähstart hinzugekommen.
Ein Schwung neuer Modelle verzichtet erstens auf die Navigation per Satellit und auf UWB-Funkmasten, die bisher als Ersatz oder Ergänzung eines Begrenzungskabels dienen. Stattdessen orientieren die Geräte sich anhand der Bildanalyse und Distanzmessungen eingebauter Kameras und Lasersensoren über den Arbeitsbereich. Dadurch entfallen der Aufbau und die Empfangssuche externer Antennen.
- Ohne Begrenzungsdraht und komplizierte Ersteinrichtung werden Mähroboter für immer mehr Gartenbesitzer interessant.
- Die getesteten Mähroboter lassen sich mithilfe ihrer Kameras, Lasersensoren und KI-basierten Automapping-Funktionen leichter einrichten.
- Bei schwierigen Lichtverhältnissen oder tarnender Umgebung versagen manche Systeme beim Igelschutz.

Dreame kombiniert eine Laserkuppel oben mit einer Kamera vorne. Damit erkennt der A2 auch kleine Hindernisse wie Igel auf der Fläche und am Rand sehr gut.
(Bild: Berti Kolbow-Lehradt)
Darüber hinaus wollen sich die smarten Newcomer mit durch KI aufgeschlaute Kamerasoftware selbst beibringen, wo der Rasen endet. Daher brauchen sie im Idealfall keine menschlich geführte Kennenlernrunde mehr. Alle vier Testmodelle beherrschen Automapping mithilfe interner Distanzsensorik.
Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Vier Mähroboter im Test: Kein Kabel, kein Stress – und sicher für Igel & Co?“.
Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.
Künstliche Intelligenz
CPU-Wegweiser 2025: So finden Sie den passenden Desktopprozessor für Ihre Zwecke
Seit Sommer 2024 geht es bei Desktop-Prozessoren Schlag auf Schlag. AMD brachte im August vergangenen Jahres mit den Ryzen 9000 „Granite Ridge“ die zweite Ryzen-Generation für die Plattform AM5 mit Zen-5-Rechenwerken und verbesserter Fertigung heraus. Anschließend folgten bis zum Frühjahr die für Gamer interessanten X3D-Varianten mit Riesen-Cache. Zudem aktualisierte der Chiphersteller seine Chipsätze und schrieb bei den teureren Mainboards USB4 vor.
Intel setzte im Herbst 2024 mit Core Ultra 200S „Arrow Lake“ zum Konter an. Die Prozessoren tragen nicht nur ein anderes Namensschema als bisher, sondern unterscheiden sich durch Chiplet-Aufbau, Fremdfertigung, stärkere Kerne, integriertes Thunderbolt 4 und die Fassung LGA1851 von den Vorgängern der Core-i-Serie. Für preiswerte Systeme bieten die Hersteller weiterhin CPUs der älteren Plattformen AM4 und LGA1700 an, sodass rund 300 verschiedene Modelle bei den Händlern liegen. Hinzu kommen noch aufgelötete Prozessoren für Mini-PCs wie Core- und Ryzen-Mobil-CPUs sowie Apples M4-Serie und neuerdings Qualcomm Snapdragon X hinzu.
Wie Sie angesichts dieser Fülle den Überblick behalten und den optimalen Prozessor für Ihren Einsatzzweck finden, erklären wir in diesem CPU-Ratgeber. Neben der Übersicht der aktuellen Plattformen und deren Eigenschaften gehen wir auf besondere Funktionen, aber auch Einschränkungen der jeweiligen Serie ein. Vergleichswerte für Performance und Effizienz finden Sie in einem separaten Artikel, in dem wir über 50 Prozessoren der vergangenen acht Jahre ins c’t-Labor geholt haben.
Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „CPU-Wegweiser 2025: So finden Sie den passenden Desktopprozessor für Ihre Zwecke“.
Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.
Künstliche Intelligenz
Mittwoch: Titanic-Tauchgang trotz Problemen, WhatsApp-Funktion gegen Scammer
Auf dem Weg zur Titanic implodierte im Sommer 2023 das Kohlefaser-Tauchboot Titan. Eine Untersuchung lässt kein gutes Haar an den Betreibern von Oceangate. Demnach hat das Management Sicherheitsprobleme ignoriert, obwohl es darauf hingewiesen wurde. Das hat dem Oceangate-Gründer und vier Mitfahrern das Leben gekostet. Derweil wird WhatsApp bei Gruppenchat-Einladungen von unbekannten Personen künftig eine „Sicherheitsübersicht“ zeigen. So sollen Nutzer mögliche Betrugsversuche schneller erkennen können. Kriminell organisierte Scams per Messenger-Diensten sollen damit eingedämmt werden. Gestern hat AMD sein bisher bestes Umsatzquartal knapp geschlagen. Dabei wurden Rekordumsätze mit Ryzen-Prozessoren für Desktop-PCs und starke Epyc-Verkäufe verzeichnet. Allerdings dreht das US-Exportverbot für KI-Beschleuniger nach China das Betriebsergebnis ins Minus. Trotzdem macht AMD mehr als dreimal so viel Nettogewinn wie ein Jahr zuvor – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.
„Die Firma war finanziell schwer angeschlagen und daher haben sie Entscheidungen getroffen, die die Sicherheit beeinträchtigten.“ So zitiert der aktuelle Untersuchungsbericht des US Coast Guard Marine Board of Investigation einen ehemaligen Mitarbeiter der US-Firma Oceangate. Sie baute das Tauchboot Titan. Bei einer Besichtigungsfahrt zum Wrack der Titanic am 18. Juni 2023 implodierte Titan, alle fünf Personen an Bord waren sofort tot. Das Unglück, bei dem auch Firmenchef Stockton Rush ums Leben kam, war vermeidbar; das macht der über 300 Seiten dicke Bericht deutlich. Er lässt kein gutes Haar am Management der Firma, das etwa Warnungen eines Betriebsleiters ignoriert und diesen nach Hinweisen auf Sicherheitsprobleme sogar gefeuert hat: Vernichtender Untersuchungsbericht zum tödlichen Titanic-Tauchgang.
Um Sicherheit in anderem Sinne geht es bei einer neuen WhatsApp-Funktion, mit der mögliche Betrugsversuche innerhalb dieses Messengers bekämpft werden. Bei Einladungen zu Gruppenchats von Personen, die nicht in der eigenen Kontaktliste stehen, wird künftig eine „Sicherheitsübersicht“ mit Informationen zu dieser Gruppe eingeblendet. Damit sollen Nutzer eventuelle Scams schneller erkennen können. Zwar gibt es bereits eine kurze Kontextkarte nach Gruppenchat-Einladungen unbekannter Personen, doch die neue Sicherheitsübersicht geht einen Schritt darüber hinaus. Diese Funktion ist Teil einer Kampagne von WhatsApp-Betreiber Meta Platforms gegen kriminelle Scammer, die verschiedene Plattformen nutzen, um gutgläubige Menschen zu betrügen: WhatsApps neue Warnung bei Gruppenchat-Einladungen soll Scams eindämmen.
7,685 Milliarden US-Dollar hat AMD im zweiten Quartal 2025 umgesetzt. Die genaue Zahl ist wichtig, da erst die letzten beiden Nachkommastellen den firmeneigenen Rekord beweisen – Ende 2024 machte AMD 7,658 Milliarden Dollar Umsatz. Verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum wächst AMDs Umsatz um 32 Prozent. Dennoch bricht das Betriebsergebnis auf ein Minus von 134 Millionen Dollar zusammen. AMD begründet das mit dem zwischenzeitlichen Exportverbot eigens für China angepasster KI-Beschleuniger in Form der Instinct MI308. Dagegen verkaufen sich insbesondere die eigenen Epyc- und Ryzen-Prozessoren für Server und Desktop-PCs prächtig. Die Epyc-CPUs sollen „den Gegenwind durch die Instinct-MI308-Auslieferung nach China mehr als ausgeglichen“ haben: Wegen China-Bann macht AMD Betriebsminus trotz Rekordumsatz.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.
Glasfaser-Verleger dürfen derzeit Wohnungen in Deutschland nur anschließen, wenn Eigentümer respektive Mieter zustimmen. Das macht die Sache doppelt ineffizient. Erstens müssen die Verleger für jeden Vertragsabschluss neu ausrücken, zweitens wird die Vernetzung selbst im Mehrparteiengebäude ineffizient. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) überlegt deshalb, ein „Recht auf Vollausbau“ zu schaffen, wie es bei Stromleitungen üblich ist. Damit hat er sich zwischen viele Stühle gesetzt. Die Wohnungswirtschaft läuft zusammen mit dem Breitbandverband Anga Sturm gegen die Überlegung. Grundsätzlich positiv äußert sich jetzt der Verband der Anbieter im Digital- und Telekommunikationsmarkt (VATM) zum Kampf um „Vollausbaurecht“ für Glasfaser: Jede Wohnung einzeln?
Fritzboxen, Fritz-Repeater, Fritz-Telefone und andere Produkte firmieren künftig nicht mehr unter dem Firmennamen AVM. Der Hersteller benennt sich 39 Jahre nach der Gründung von AVM GmbH in die FRITZ! GmbH um. Mit dem Wechsel will die Firma ihre Fritz-Marke in den Vordergrund stellen. Alle Produktmarken wie Fritzbox bleiben erhalten. „Die Namensänderung betrifft ausschließlich die Firmenbezeichnung – für Partner und Kunden ändert sich nichts“, betont das Unternehmen. Im Handel dürfte der Wandel schleichend stattfinden. Die meisten Shops führen die Produkte noch unter dem Firmennamen AVM. Produktverpackungen dürften mindestens über die nächsten Monate mit beiden Firmennamen auftauchen: AVM gibt seinen Namen für Fritzboxen & Co. auf.
Auch noch wichtig:
(fds)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 Online Marketing & SEOvor 2 Monaten
Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat
Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten











