Datenschutz & Sicherheit
Berliner Behörde greift jetzt auch auf Cloud-Daten zu
Das Berliner Landesamt für Einwanderung greift zur Identitätsfeststellung von abzuschiebenden Personen nicht nur auf lokal gespeicherte Daten auf Smartphones, Laptops oder USB-Sticks zu. Wie aus einer Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage hervorgeht, durchsucht die Behörde inzwischen auch Daten in Cloud-Diensten wie iCloud oder Google Drive. Die betroffenen Personen sind dabei nicht anwesend.
Bereits seit 2015 durchsuchen Ausländerbehörden Datenträger, wenn sie die Identität von abzuschiebenden Personen nicht auf anderen Wegen feststellen können. So wollen sie Hinweise für Namen und Staatsangehörigkeit finden, damit die Herkunftsländer einen Pass ausstellen.
Das Aufenthaltsrecht verpflichtet die betroffenen Personen, dabei mitzuwirken. Im Klartext: Sie müssen Geräte und auch die dazugehörigen Zugangsdaten herausgeben. Passiert das nicht, darf die Behörde Personen oder ihre Wohnungen durchsuchen.
Zurück zur Handarbeit
Bis 2020 arbeitete die Berliner Behörde dabei von Hand: Mitarbeiter*innen haben die Smartphones entsperrt und darauf nach Hinweisen gesucht. In den Verfahrenshinweisen der Behörde heißt es dazu: „So können etwa die Adressdaten in dem Mobiltelefon eines ausreisepflichtigen Ausländers beziehungsweise gespeicherte Verbindungsdaten aufgrund der Auslandsvorwahl wesentliche Hinweise auf eine mögliche Staatsangehörigkeit geben.“ Auch gespeicherte Reiseunterlagen seien relevant.
Ab 2020 hatte die Behörde eine Vereinbarung mit dem Berliner Landeskriminalamt und hat die Geräte mit einer IT-forensischen Software durchsuchen lassen. Mit dieser konnte sie sich auch Zugang zu gesperrten Geräten verschaffen, deren Besitzer*innen keine Zugangsdaten herausgegeben haben.
Nachdem die Berliner Datenschutzaufsicht auf das Verfahren aufmerksam wurde und eine Untersuchung einleitete, löste die Ausländerbehörde die Vereinbarung wieder auf. Der Einsatz der Software habe sich nicht gelohnt, teilte die Senatsinnenverwaltung damals mit. Die Geräte durchsuchte die Behörde aber weiter: wieder von Hand.
Behörde sieht Dokumente, Chats, Bilder
So ist es bis heute. Der Berliner Linken-Abgeordnete Niklas Schrader fragte die Landesregierung, ob und welche Software das Landesamt derzeit für die Durchsuchungen einsetzt. Der Innensenat antwortet: „Es werden keine solchen Produkte oder Softwarelösungen genutzt.“
Auf Nachfrage bestätigte die Senatsverwaltung, dass bei der händischen Durchsicht von Mobiltelefonen auch Inhalte in Cloud-Diensten durchgesehen werden. Das bedeutet: Behördenmitarbeitende können auf gespeicherte Dokumente, Chatverläufe oder Standortdaten zugreifen, die gar nicht direkt auf dem Gerät gespeichert sind – sondern über Dienste wie Google Drive, iCloud oder WhatsApp-Backups abrufbar sind. Welche Apps und Dienste auf dem Handy durchsucht werden, „obliegt im Einzelfall dem Mitarbeiter“, der das Gerät durchsucht.
Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahmen ist § 48 des Aufenthaltsgesetzes. Der Bundestag hat den Paragraf letztes Jahr mit den Stimmen der Ampel durch das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz verschärft. Davor durften nur lokal gespeicherte Daten auf Smartphones oder Laptops ausgelesen werden. Die neue Fassung erlaubt nun ausdrücklich auch den Zugriff auf Daten in Cloud-Diensten.
Keine statistische Erfassung, keine Transparenz
Im bundesweiten Vergleich ist die Zahl der in Berlin durchgeführten Handy-Auswertungen bislang eher gering. Zwischen 2018 und 2021 durchsuchte die Ausländerbehörde in insgesamt 64 Fällen Mobiltelefone, wie der Senat auf eine frühere Anfrage mitteilte. Nur in sechs Fällen habe die Maßnahme zur Klärung der Identität oder Staatsangehörigkeit beigetragen.
Wie häufig die Behörde seither auf Mobiltelefone oder Cloud-Konten zugegriffen hat, ist dagegen nicht bekannt. Die Senatsverwaltung teilte mehrfach mit, dass keine statistische Erfassung erfolgt – weder zur Anzahl der Fälle noch zu Alter, Geschlecht oder Herkunft der Betroffenen. Auch ob eine Auswertung erfolgreich war oder scheiterte, wird nicht systematisch erfasst.
Das gleiche gilt für die Frage, in wie vielen Fällen die Behörde Wohnräume der Betroffenen durchsucht hat, um Geräte zu finden.
Keine Beschwerden, aber Kritik
Trotz der tiefgreifenden Maßnahmen sind bislang keine Beschwerden bei der Berliner Datenschutzbeauftragten eingegangen, so der Senat. Eine rechtliche oder ethische Evaluation der Durchsuchung hat laut Senat nicht stattgefunden. Zwar sieht das Gesetz vor, dass nur Personen mit Befähigung zum Richteramt Zugriff auf die Daten erhalten. Sie sollen sicherstellen, dass keine besonders geschützten Daten zu den Akten genommen werden.
Die Datenschutzbeauftragte hatte im Rahmen ihrer Untersuchung allerdings darauf hingewiesen, wie sensibel die auf Smartphones und Computern gespeicherten Daten sein können. „Nicht nur lassen sich bspw. aufgrund der mit anderen Personen ausgetauschten Nachrichten Rückschlüsse auf sexuelle Orientierungen oder politische Ansichten ziehen; über Funktionen wie eine Terminverwaltung gelangen auch sehr schnell Gesundheitsdaten auf das Gerät.“ Die EU-Datenschutzregeln, deren Einhaltung die Behörde überwacht, schützen solche Daten besonders.
Dass die Behörde nach eigenem Ermessen auf die Daten zugreifen kann, wurde schon bei der Verabschiedung des Gesetzes kritisiert. Der Bundesrat etwa zweifelte an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, sorgte sich um den Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung und schlug vor einen Richtervorbehalts einzufügen.
Niklas Schrader, Sprecher für Innenpolitik der Linken-Fraktion, kritisiert, der Senat weiche Fragen aus und könne den Nutzen der Maßnahme nicht belegen. Dass sogar Daten auf Cloud-Diensten durchsucht werden, zeige, wie tief der Eingriff in die Intimsphäre der Betroffenen sei. „Wir fordern deshalb ein Ende dieser unverhältnismäßigen Praxis.“ Sie sei Teil eines entwürdigenden Regimes im Umgang mit Menschen, die in Deutschland Schutz suchten.
Drucksache 19 / 22 905
Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Niklas Schrader (LINKE)
vom 12. Juni 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. Juni 2025)
zum Thema: Instrumente für Handy-Forensik und Phone-Cracker bei den Berliner Sicherheitsbehörden und beim Landesamt für Einwanderung (Teil 4)
und Antwort vom 27. Juni 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 2. Juli 2025)
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Herrn Abgeordneten Niklas Schrader (LINKE)
über die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei – G Sen –
Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/22905
vom 12. Juni 2025 über Instrumente für Handy-Forensik und Phone-Cracker bei den Berliner
Sicherheitsbehörden und beim Landesamt für Einwanderung (Teil 4)
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:
1. Welche Produkte und Softwarelösungen werden derzeit (Stand Juni 2025) vom Landesamt für Einwanderung (LEA) bzw. anderen beteiligten Behörden für die forensische Auswertung von Mobilgeräten genutzt? (Bitte unter Angabe von Hersteller, Produktname, Version und Beschaffungsjahr auflisten!)
Zu 1.:
Es werden keine solchen Produkte oder Softwarelösungen genutzt.
2. Bestehen aktuell Verträge mit externen Anbietern wie Cellebrite? Wenn ja, seit wann, mit welchem Vertragsvolumen, welchen Laufzeiten und welchen Leistungsinhalten?
Zu 2.:
Auf die Antwort zu Frage 1. wird verwiesen. Es bestehen aktuell keine Verträge mit externen Anbietern wie Cellebrite.
3. Welche internen Dienstanweisungen, Leitfäden oder Schulungsunterlagen existieren zur Auswertung von Mobilgeräten im Rahmen von § 48 AufenthG/§ 48a AufenthG? Ich bitte um Übermittlung oder Zusammenfassung der zentralen Inhalte!
Zu 3.:
Die entsprechenden Verfahrenshinweise sind in den VAB A.48.3.1.-3c. veröffentlicht und können unter www.berlin.de/einwanderung/service/downloads/artikel.875097.php abgerufen werden.
4. Wurden in den Jahren 2023 und 2024 nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit dem LKA weiterhin Mobiltelefone zur Identitätsfeststellung ausgewertet?
a) Wenn ja, in wie vielen Fällen und mit welchen technischen Mitteln wurden diese Auswertungen durchgeführt? b) In wie vielen Fällen scheiterte die Auswertung, etwa weil betroffene Personen keine Zugangsdaten herausgegeben haben?
Zu 4.:
Es erfolgt keine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung.
5. Gab es seit dem 1. Januar 2023 Änderungen im Verfahren zur Auswertung von Mobiltelefonen zur Identitätsfeststellung beim LEA? Wenn ja, bitte mit Angabe etwaiger neuer Verfahrensschritte, Zuständigkeiten oder technischer Systeme auflisten!
Zu 5.:
Der Gesetzgeber hat mit dem Inkrafttreten des Rückführungsverbesserungsgesetzes zum 27.02.2024 die gesetzliche Möglichkeit in § 48 Absatz 3 bis 3b AufenthG geschaffen, nicht nur mitgeführte Datenträger zu durchsuchen, sondern auch die Wohnung des Betroffenen. Die entsprechenden Verfahrenshinweise sind in den VAB A.48.3.1.-3c. veröffentlicht und können unter www.berlin.de/einwanderung/service/downloads/artikel.875097.php abgerufen werden.
6. In welchen Anwendungen auf einem Mobiltelefon suchen Mitarbeitende des LEA nach Hinweisen, wenn sie Mobiltelefone von Hand durchsuchen? Gibt es Anwendungen, die von der Durchsuchung ausgeschlossen sind?
Zu 6.:
Zur Feststellung der bislang ungeklärten Identität und Staatsangehörigkeit werden Anwendungen durchsucht, die dazu Anhaltspunkte geben können. Die Entscheidung obliegt im Einzelfall dem Mitarbeiter des Landesamts für Einwanderung mit Befähigung zum Richteramt, der diese Durchsuchung durchführt.
7. Durchsucht das LEA bei der händischen Durchsuchung von Mobiltelefonen auch Daten, die in Cloud- Diensten wie iCloud oder Google Drive gespeichert sind?
Zu 7.:
Ja.
8. Welche Personengruppen waren in den Jahren 2023–2025 von Handy-Auswertungen betroffen? Bitte aufschlüsseln nach Jahr, Geschlecht, Alter, Herkunftsland!
9. Welche konkreten Datentypen (z. B. Kontakte, Messenger-Verläufe, Fotos, Standortdaten, Gesundheitsdaten) werden bei der forensischen Auswertung regelmäßig extrahiert und ausgewertet?
Zu 8. und 9.:
Es erfolgt keine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung.
10. In welcher Form werden die gefundenen Hinweise protokolliert? Existieren hierfür Vorlagen? Ich bitte um Übermittlung der Vorlagen!
Zu 10.:

Die Protokollierung erfolgt durch einfachen Aktenvermerk in der Ausländerakte des Betroffenen. Eine gesonderte Vorlage nur für den Zweck der Handy-Auswertung besteht nicht.
11. In wie vielen Fällen seit Januar 2023 hat die Auswertung von Mobilgeräten zur zweifelsfreien Feststellung von Identität oder Staatsangehörigkeit beigetragen? In wie vielen Fällen blieb die Maßnahme ergebnislos?
Zu 11.:
Es erfolgt keine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung.
12. In welcher Form wird in welchen Akten dokumentiert, wenn Betroffene die Herausgabe von Zugangsdaten verweigern?
Zu 12:
Eine entsprechende Verweigerung wird durch einfachen Aktenvermerk in der Ausländerakte des Betroffenen dokumentiert.
13. Inwiefern hat eine mögliche Verweigerung Auswirkungen auf aufenthaltsrechtliche Verfahren, insbesondere im Hinblick auf eine angeblich fehlende Mitwirkungspflicht?
Zu 13.:
Das Aufenthaltsgesetz sieht im Fall der Verweigerung der Mitwirkung der Ausländerin bzw. des Ausländers bei der Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit vor, dass ein Bußgeld verhängt werden kann. In Betracht kommt zudem der Erlass einer Ausweisung auf der Grundlage des § 54 Abs. 2 Nr. 8 b) AufenthG. Die bzw. der Betroffene muss zuvor auf die Rechtsfolgen hingewiesen worden sein und in Kenntnis dessen seine Verweigerung aufrechterhalten haben.
14. Wie viele Beschwerden, Hinweise oder rechtliche Einwände gegen die Handy-Auswertung wurden seit 2023 bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI) eingereicht? Welche Empfehlungen oder Prüfungen resultierten daraus?
Zu 14.:
Bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sind seit 2023 keine Beschwerden, Hinweise oder rechtlichen Einwände gegen die Handy-Auswertung eingegangen.
15. Wurde die Praxis der Handy-Auswertung durch die Landesregierung oder Fachbehörden einer rechtlichen oder ethischen Evaluation unterzogen, insbesondere im Hinblick auf Grundrechte (Art. 1, 2 GG), Datenschutz (DSGVO) und aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bzw. des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur digitalen Privatsphäre? Wenn ja, mit welchen Ergebnissen? Bitte unter Angabe konkreter technischer, organisatorischer oder prozeduraler Schutzmaßnahmen (z. B. Protokollierung, Zugriffsbeschränkung, Speicherfristen) auflisten!
Zu 15.:
Die Datenträgerauswertung erfolgte nach den Vorgaben des Gesetzes. § 48 Abs. 3b S. 6 AufenthG sieht vor, dass der Datenträger nur von einem Bediensteten ausgewertet werden darf, der die Befähigung zum Richteramt hat. Damit ist der Schutz der Rechte bereits gesetzlich gewährleistet. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung wurden durch die Auswertung von Datenträgern zudem weder erlangt noch verwertet.
16. Welche Maßnahmen trifft der Senat, um sicherzustellen, dass datenschutzrechtliche und menschenrechtliche Standards bei der Auswertung von Mobilgeräten von ausreisepflichtigen Personen eingehalten werden?
Zu 16.:
Die nachgeordneten Behörden, die zur Datenträgerauswertung befugt sind, handeln nach den geltenden Normen.
17. Wie lange werden die Mobiltelefone der betroffenen Personen im Durchschnitt für die Durchsuchung einbehalten?
Zu 17.:
Es erfolgt keine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung.
18. Werden die Mobiltelefone im Beisein der betroffenen Personen durchsucht?
Zu 18.:
Nein.
19. In wie vielen Fällen wurden Räumlichkeiten der betroffenen Personen durchsucht, um Mobiltelefone oder andere Datenträger für die Durchsuchung einzuziehen?
Zu 19.:
Es erfolgt keine statistische Erfassung im Sinne der Fragestellung.
Berlin, den 27. Juni 2025
Datenschutz & Sicherheit
Auslegungssache 144: Wege aus der US-Abhängigkeit
Die Abhängigkeit von US-amerikanischen IT-Diensten birgt konkrete Risiken. Deutlich wurde dies jüngst etwa im Fall von Karim Khan, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), dem Microsoft plötzlich seine Konten sperrte. Grund seien Sanktionen der US-Regierung gegen den IStGH gewesen. Solche „Killswitch“-Aktionen zeigen die Verwundbarkeit auch von europäischen Nutzern. Zudem scannen Dienste wie Microsoft und Google automatisch Inhalte in ihren Cloud-Speichern und melden verdächtige Funde an US-Strafverfolgungsbehörden.
In Episode 144 des c’t-Datenschutz-Podcasts widmen sich c’t-Redakteur Holger Bleich und heise-Justiziar Joerg Heidrich gemeinsam mit Peter Siering dem Thema digitale Souveränität. Siering, seit 35 Jahren bei heise und Leiter des Ressorts Systeme und Sicherheit, bringt seine langjährige Erfahrung mit Microsoft-Produkten und Open-Source-Alternativen in die Diskussion ein.
Investitionsbereitschaft gefordert
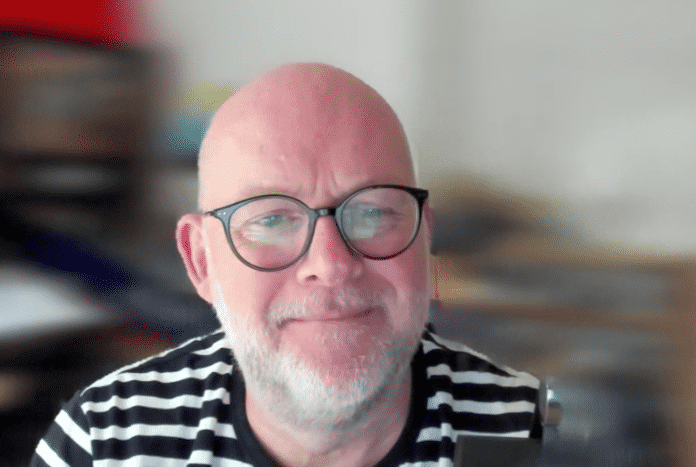
(Bild: c’t-Ressortleiter „Systeme & Sicherheit“ Peter Siering in der Auslegungssache)
[Link auf Beitrag 4807783]
Für den Ausstieg aus Microsoft 365 empfiehlt Siering Nextcloud als zentrale Alternative. Die Open-Source-Software bietet kollaborative Dokumentenbearbeitung, Chat und Videokonferenzen. Kleine Unternehmen können diese Lösung über lokale Systemhäuser beziehen, müssen aber Schulungsaufwand und Umstellungspannen einkalkulieren, wie Siering betont. Der Wechsel erfordere Investitionsbereitschaft.
Bei Cloud-Diensten existieren durchaus europäische Alternativen zu den US-Hyperscalern wie AWS oder Azure. OVH aus Frankreich und IONOS aus Deutschland bieten vergleichbare Dienste an, wenn auch mit weniger granularen Optionen. Die Preisunterschiede sind dabei überraschend gering. Wichtig sei, von Anfang an auf Anbieterunabhängigkeit zu achten und proprietäre Lösungen zu vermeiden, erläutert Siering.
Wechselwilligen empfiehlt er als ersten Schritt eine Bestandsaufnahme: Wo liegen meine Daten? Habe ich sie leichtfertig aus der Hand gegeben? Der Wechsel zu europäischen E-Mail-Anbietern und Cloud-Speichern sowie die Nutzung alternativer Suchmaschinen und Browser sind praktikable Sofortmaßnahmen. Für Unternehmen lohnt die Suche nach lokalen Dienstleistern, die europäische Alternativen implementieren können.
Episode 144:
Hier geht es zu allen bisherigen Folgen:
(hob)
Datenschutz & Sicherheit
Online-Wahlen in Ontario: Hohes Risiko von Wahlbetrug
Am Beispiel der Kommunalwahlen Ontarios 2022 zeigen kanadische Forscher hohes Wahlbetrugsrisiko bei Online-Wahlen auf. Die Forscher dreier Universitäten haben zwar die Wahlserver nicht überprüft, aber schon bei den E-Voting-Webseiten Fehler gefunden. Noch schwerer wiegt die Handhabung der für die Stimmabgabe notwendigen Codes. In 70 Prozent der Kommunen mit Online-Wahl war das Wahlbetrugsrisiko hoch oder extrem.
Bei den Kommunalwahlen Ontarios 2022 waren 10,7 Millionen Personen wahlberechtigt. Etwa die Hälfte der Kommunen, generell kleinere, bot Online-Stimmabgabe an. Von diesen haben mehr als 70 Prozent die Stimmabgabe mittels papierenem Stimmzettel überhaupt abgeschafft. Insgesamt hätten 3,8 Millionen Ontarier online oder per Telefon abstimmen können.
Sechs E-Voting-Anbieter teilen sich den Markt der bevölkerungsreichsten Provinz Kanadas auf. Intelivote bedient die größte Zahl an Kommunen, Scytl die größte Zahl an Wahlberechtigten. In den zur Stimmabgabe aufgesetzten Webseiten des Marktführers Scytl sowie dem in Ontario weniger bedeutenden Anbieter Neuvote haben die Forscher eine Sicherheitslücke gefunden: Mittels cross-site framing attack war es Angreifern möglich, Wähler bei der Online-Stimmabgaben zu betrügen.
Kein Schutz gegen Umleitungen oder iframes
Denn die Stimmabgabe-Webseiten waren nicht gegen Einbettung in HTML iframes geschützt. Mit einem zwischengeschalteten Proxy und iframes und wäre es beispielsweise möglich gewesen, die angezeigte Reihenfolge der Kandidaten zu manipulieren, sodass die Stimme des Wählers vom Server anders registriert wurde, als der Wähler glaubte, zu wählen.
Das haben die Forscher Scytl demonstriert, das am nächsten Tag eine Abhilfemaßnahme ergriffen hat. Bei Neuvote haben die Forscher die Lücke zu spät bemerkt, um noch vor dem Wahlgang eingreifen zu können. Ob es solche Angriffe gegeben hat, ist unbekannt.
Leider mangelte es schon beim Schutz gegen Umleitungen auf andere, gefälschte Webseiten, ganz ohne iframes. Mittel der Wahl wäre HSTS mit Strict Transport Security, worauf Scytl verzichtet hat. Die übrigen fünf Anbieter hatten zwar HSTS, aber vier von ihnen waren nicht in den voreingestellten Listen der gängigen Webbrowser eingetragen. Damit bleibt die Webseite anfällig für eine böswillige Umleitung beim ersten Aufruf. Und weil 87 Prozent der Kommunen für ihre Online-Wahl völlig neue URLs verwendet haben, lief HSTS, selbst wenn aktiviert, regelmäßig ins Leere.
Gravierender ist allerdings das Risiko banalen Wahlbetrugs durch Verwenden fremder Wahlcodes. Das ist simpel.
Fremde Wahlcodes liegen zur freien Entnahme auf
Für die Stimmabgabe wird den Wählern automatisch ein Brief mit Anleitungen und ihrem persönlichen Zugangscode geschickt, ob sie das wünschen oder nicht. Viele wünschen es nicht, die Wahlbeteiligung lag unter 37 Prozent. Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass auch E-Voting die Wahlbeteiligung langfristig nicht steigert, häufig sogar senkt.
In den meisten Fällen müssen Kanadier ihre Post abholen, von sogenannten community mailboxes, oder, in größeren Wohnhäusern, von Hausbrieffächern. Unerwünschte Post wird routinemäßig gleich vor Ort aussortiert, entweder in einen Recyclingbehälter oder, bei falscher Adressierung, in einen Behälter für den Briefträger.
Genau das geschieht auch mit den Kuverts mit den Wahlcodes. Die Empfänger vernichten nicht gewünschte Codes nicht, sondern entsorgen das Kuvert sofort – häufig ungeöffnet, weil schon von außen erkennbar ist, was drin ist. Damit ist es ein Leichtes, solche Kuverts einzusammeln und in fremdem Namen zu wählen.
Datenschutz & Sicherheit
Meta hört bald zu, wenn du dich mit der KI unterhältst
Den Meta-Chatbot können Menschen über Instagram, Whatsapp und Facebook ansprechen. Laut Meta nutzen ihn monatlich mehr als eine Milliarde Menschen. Viele davon teilen intime Informationen mit der Software.
Die Gespräche, die Menschen mit der sogenannten Künstlichen Intelligenz führen, will Meta künftig auslesen und speichern. Damit sollen Anzeigen treffsicherer personalisiert werden und die Daten sollen auch beeinflussen, welche Posts Nutzer*innen in den Sozialen Netzwerken angezeigt bekommen. Das erklärte Meta gestern in einem Blogpost. Der Konzern behält sich dabei vor, die Informationen aus den Gesprächen in allen seinen Produkten zu nutzen.
Ein Beispiel nannte der Konzern direkt: Wer sich mit der KI etwa übers Wandern unterhalte, bekomme danach womöglich Empfehlungen für Wandergruppen, Wanderstrecken von Bekannten und Werbung für Wanderschuhe angezeigt.
Auch sensible Konversationen werden ausgelesen
Meta gibt zwar an, sensible Konversationen über religiöse Ansichten, die sexuelle Orientierung, politische Meinungen, Gesundheit und ethnische Herkunft nicht für personalisierte Werbung nutzen zu wollen, die Daten werden aber dennoch mit ausgelesen.
Die neue Regelung will Meta ab dem 16. Dezember umsetzen, allerdings zunächst nicht in der EU und Großbritannien. Dort solle das Feature später ausgerollt werden, weil die hiesigen Datenschutzbestimmungen strenger seien. Für das KI-Training werden die Chatprotokolle in Europa wohl schon genutzt.
Seit Juni ist bereits bekannt, dass Meta mit Hilfe von KI Anzeigen erstellen will. Werbetreibende müssen dann nur ein Produktbild und ein Budget vorgeben. Meta möchte durch diese Investitionen die größte Einnahmequelle Werbung noch rentabler machen. Hier bieten sich auch Spielräume für individuelle Personalisierung von Anzeigen – anhand der mit dem Chatbot erhobenen Daten.
Nutzer*innen teilten unbewusst Chatprotokolle
Meta hat den Chatbot für seine Messenger erst vor wenigen Monaten in Europa eingeführt. Er stand schon mehrfach in der Kritik, etwa weil ihm erlaubt war, „sinnliche“ und „romantische“ Konversationen mit Minderjährigen zu führen. Ein anderes Mal, weil viele Nutzer*innen ihre teils sehr persönlichen Chatprotokolle scheinbar unbewusst veröffentlicht hatten.
Die Nutzer*innen können einstellen, in welchem Ausmaß die ihnen ausgespielte Werbung personalisiert werden soll, aber es gibt keine Möglichkeit, sich gegen die Datenerfassung zur Personalisierung zu wehren – außer, den Chatbot nicht zu nutzen. In Whatsapp kann es allerdings sein, dass andere Nutzer*innen ihn zu einer Konversation hinzuziehen. Das lässt sich mit der Funktion „erweiterter Chat-Datenschutz“ verhindern. Oder mit dem Verzicht auf die datensammelwütige App zugunsten von datensparsamen Alternativen.
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 1 Monat
Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 1 Monat
Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen
-

 Online Marketing & SEOvor 2 Monaten
Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows
















