Künstliche Intelligenz
40 Jahre Amiga – die Arcade-Maschine für Zuhause
Dies ist Teil Zwei einer dreiteiligen Serie über 40 Jahre Amiga. Der Artikel zur Geschichte und Architektur des Amiga wurde bereits veröffentlicht. Der nächste Teil erscheint am morgigen Freitag.
Der Amiga brachte die Spielhalle ins Jugendzimmer. Ob „Defender of the Crown“, „Turrican“ oder „Shadow of the Beast“: Der Erstkontakt war für viele ein einschneidender Moment. Man erlebte neue Spielerfahrungen, da der Amiga in vielen Bereichen der Konkurrenz meilenweit voraus war. Wir bieten einen Rückblick mit einigen Spiele-Highlights zu der einstigen Zukunftsmaschine und zeigen auf, was an ihr so wegweisend war.
Als der Amiga 1985 auf den Markt kam, zeigte er auf Heimcomputern bisher nicht gekannte Grafik- sowie Soundfähigkeiten. Eine Auflösung von 640×400 Pixel in bis zu 4096 Farben gleichzeitig und Vier-Kanal-Sound mit Sampling – was aus heutiger Sicht kaum beeindruckt, war 1985 bahnbrechend. Und selbst wenn aus technischen Gründen 320×256 Pixel in 32 Farben gleichzeitig in den Spielen die Regel war, überragte das noch immer die Konkurrenz. Und zwar bei PCs, Heimcomputern und Konsolen.
Der ein Jahr zuvor vorgestellte Apple Macintosh vermochte nur Graustufen-Grafik darzustellen, der IBM-PC piepte zumeist rudimentär und war mit CGA-Grafik ausgestattet, deren kümmerliche 16-Farben-Palette so wirkte wie aus einer Packung Textmarker inspiriert. Selbst der Rivale Atari 520 ST, der kurz vor dem Amiga 1000 vorgestellt wurde, bot nur 16 Farben gleichzeitig – immerhin aus einer Palette von 512. Zudem musste der ST mit dem AY-3-8910 einen kostengünstigen Soundchip der 8-Bit-Homecomputerära auftragen, der etwa auch im Schneider CPC zum Einsatz kam.
Arcadeautomaten waren bis dahin der Maßstab
Die Referenz für Computerspielerlebnisse waren stattdessen die Arcade-Automaten, die eine Grafik- und Soundpracht boten, die kein Heimcomputer in der gleichen Qualität darzustellen vermochte – bis der Amiga kam. Dank seiner Custom-Chips, die Spezialaufgaben übernahmen und damit den Hauptprozessor entlasteten, war der Amiga 1000 zum Erscheinen einzigartig in seiner Leistung. Der Spiele-Start war jedoch zäh. Obwohl die Hardware prädestiniert fürs Gaming war, wurde bei seiner Präsentation in New York am 23. Juli 1985 nicht ein Spiel gezeigt. Commodore positionierte ihn eher als Alternative zum Macintosh und IBM-PC.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.
Geoff Crammonds „Stunt Car Racer“ bestach durch die beeindruckende Fahrphysik. Zwei gut gefederte Rennwagen kämpften in Rennstrecken mit Rampen und Schluchten um den Sieg. Es reichte dabei nicht nur schnell zu sein, sondern musste auch die Stabilität der Karosserie beachten.
Die ersten Games, die noch 1985 für den Amiga erschienen, wie etwa „Seven Citys of Gold“ sahen eher aus wie bessere C64-Umsetzungen, welche die einzigartigen Grafik- und Soundfähigkeiten des Amiga gar nicht ausreizten. Das änderte sich 1986, wobei zwei Spiele für Aufsehen sorgten: „Marble Madness“ war die Umsetzung eines Atari-Arcadetitels. Das Spiel, in dem man eine Kugel durch ein isometrisches 3D-Labyrinth steuern musste, sorgte für Begeisterung: Die Amiga-Version war dem Automaten ebenbürtig und die Maussteuerung funktionierte sehr gut, was das Spiel aber nicht einfach machte. Der Automat hatte einen riesigen Trackball.

Marble Madness: In einem Labyrinth musste man eine Kugel bis zum Ziel balancieren ohne vom Rand zu fallen, was angesichts der vielen Gefahren eine Herausforderung war. Die Amiga-Version unterschied sich kaum von dem Automaten.
„Defender of The Crown“ war wiederum wie ein interaktiver Mantel-und-Degen-Film: Im Spiel kämpfte man im mittelalterlichen England um die Alleinherschaft und musste dabei drei andere Anwärter ausstechen. Darin gab es farbenfrohe Ritterspiele, holde Prinzessinnen, die es zu retten galt und Burgen, die man erobern musste – das alles in einer Grafik- und Soundpracht, die zuvor so noch nie auf Heimcomputern gesichtet wurde.
Kurioserweise gilt die Atari-ST-Konvertierung als die spielerisch bessere Version, weil die Amiga-Version unter höchstem Zeitdruck fertig werden musste und einige Spielelemente fehlen. Grafisch und soundtechnisch ist die Version für Commodores Rechner dennoch runder.

Als der Amiga 1987 auf dem Markt kam, schlug er ein wie eine Bombe. Nun wurde Gaming bezahlbar.
(Bild: heise online)
Entwickler Cinemaware machte sich mit ihren atmosphärischen, cineastisch angehauchten Spielen einen Namen. Ob mit „Lords of The Rising Sun“, was als „Defender of The Crown“ rund um Japan galt, die B-Movie-Parodie „It Came From The Desert“, wo eine Stadt vor Riesenameisen beschützt werden sollte, oder „Wings“, das die Luftkämpfe des Ersten Weltkriegs simulierte – alle Spiele verband eine dichte Kino-Atmosphäre.
Mit dem Amiga 500 erfolgte der Durchbruch im Gaming
Das Jahr 1987 war wegweisend: Mit dem Amiga 500 kam der mit Abstand erfolgreichste Rechner der Amiga-Serie auf den Markt: Als Tastaturrechner und wesentlich günstiger als der Amiga 1000 stand nun seinem Erfolg als Gaming-Maschine nichts mehr im Weg. Mit „Ports of Call“ kam im selben Jahr ein echter Zeitfresser auf den Markt: Rolf-Dieter Klein und der leider im März 2025 verstorbene Martin Ulrich schufen eine Wirtschaftssimulation, in der man eine Reederei übernahm und Gewinne erwirtschaften und auch mal die Schiffe im Hafen unfallfrei einparken musste. Die andere Wirtschaftssimulation, die aus Deutschland kam und schnell Kultstatus erlangte, war das 1989 erschienene „Oil Imperium“ – hier musste man keine Öltanker einparken, sondern Ölbohrungen schneller als die Konkurrenz durchführen und den Bohrer dabei nicht zerstören. Es galt Konkurrenten auszuschalten und erfolgreich zu handeln. Beide Titel entwickelten sich schnell zu Kultspielen und festigten den Ruf, dass aus Deutschland gute Wirtschaftssimulationen kommen.
Künstliche Intelligenz
Kommentar: KI frisst Junior-Stellen – und unsere Zukunft?
Wer dieser Tage durch Stellenausschreibungen in der IT-Branche stöbert, stößt auf ein klares Muster: Senior Developer gesucht – bitte mit zehn Jahren Berufserfahrung, vertieften Kenntnissen in zahlreichen Frameworks und am besten noch Praxiserfahrung in Machine Learning. Junior Developer? Fehlanzeige!

Madeleine Domogalla arbeitet als Redakteurin in der iX-Redaktion bei heise und ist für Softwareentwicklungsthemen zuständig. Darüber hinaus betreut sie IT-Konferenzen, online und vor Ort.
Die neuesten Zahlen bestätigen den Eindruck, denn während Senior-Positionen nur leicht zurückgehen, schrumpfen Junior-Stellen im IT-Bereich dramatisch. Die Einstiegspositionen sind in Deutschland seit 2020 um mehr als die Hälfte zurückgegangen, wie das Jobportal Indeed meldet. Und das in einer Branche, die uns seit Jahren predigt, es fehle an Nachwuchs. Ironie des digitalen Zeitalters. Wir schaffen die Stellen ab, aus denen dieser Nachwuchs überhaupt erst hervorgehen kann.
Zu kurzfristig gedacht
Natürlich, künstliche Intelligenz liefert beeindruckende Produktivitätsschübe. Sie generiert Boilerplate-Code in Sekunden, schreibt automatisierte Tests, schlägt Bugfixes vor oder dokumentiert Schnittstellen nahezu selbstständig. Routineaufgaben, die meist Juniors erledigten, lassen sich so mit einem Prompt effizienter umsetzen. Aber genau an einer Stelle bleibt KI blind: Menschen ausbilden, ihnen Erfahrung vermitteln und sie zu erfahrenen Fachkräften heranwachsen lassen.
Unternehmen, die heute glauben, mit KI kurzfristig teure Einstiegspositionen kompensieren zu können, sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen. Denn ohne Junior-Entwicklerinnen und -Entwickler von heute gibt es keine Senior Engineers von morgen – keine Softwarearchitektinnen, keine Tech-Leads, keine CTOs.
Chancen erkennen und nutzen
Was bedeutet das für junge Menschen? Der Einstieg wird härter, aber nicht unmöglich. Wer sich früh mit KI-gestützter Entwicklung auseinandersetzt, kann sich von anderen abheben. Unternehmen müssen lernen, mit KI nicht nur Effizienz, sondern auch Lernräume zu schaffen. Denn wer heute keine Nachwuchskräfte einbindet, hat morgen keine Fachkräfte mehr.
Die Zukunft der Entwicklung liegt nicht nur im effizienteren Programmieren, sondern in der Fähigkeit, Strategien zu entwerfen, Systeme zu gestalten und eben diese KIs zu steuern – Aufgaben, die man weder im Alleingang noch ohne Erfahrung bewältigen kann.
Wenn der IT-Arbeitsmarkt hierzulande also nicht zur Sackgasse werden soll, brauchen wir dringend ein Umdenken: weniger Angst davor, dass KI Arbeit schneller erledigt, mehr Mut zu Investitionen in junge Talente. Denn die größte Umwälzung, die uns drohen kann, ist nicht die KI. Es ist das Fehlen der Menschen, die lernen müssen, mit ihr zu arbeiten.
(mdo)
Künstliche Intelligenz
Drei Tage Anwesenheit: Microsoft beordert Angestellte zurück ins Büro
Angestellte von Microsoft müssen wieder mindestens drei Tage pro Woche ins Büro, los geht’s ab Februar für alle, die in und um Redmond bei Seattle nicht mehr als 50 Meilen (80 Kilometer) von einem Standort entfernt wohnen. Das hat Amy Coleman, die Personalleiterin des US-Konzerns, jetzt in einem Memo an die Belegschaft angekündigt. Die Anwesenheitspflicht an der Mehrzahl der Wochentage soll dann in zwei weiteren Schritten erst auf die restlichen Standorte in den USA und später auf jene im Rest der Welt ausgeweitet werden, schreibt Coleman. Das US-Magazin The Verge zitiert anonyme Microsoft-Beschäftigte mit der Einschätzung, dass der Schritt auch zum Ziel haben dürfte, die Belegschaft zu reduzieren. „Es geht nicht um Personalabbau“, versichert die Managerin dagegen.
Rückkehrpflicht gegen den Trend
Die Personalchefin begründet den Schritt mit den „eindeutigen Daten“, wenn Menschen vor Ort zusammenarbeiten, dann seien sie erfolgreicher. Sie wären motivierter, leistungsfähiger und erzielten bessere Ergebnisse. Bei der Entwicklung der KI-Produkte, „die diese Ära definieren“, bräuchte Microsoft die Energie und Dynamik, die entstehe, „wenn kluge Menschen Seite an Seite arbeiten und zusammen Probleme lösen“. Gleichzeitig solle die Flexibilität, die man bei Microsoft wertschätze, nicht aufgegeben werden. Die Betroffenen erhalten demnach jetzt eine personalisierte E-Mail, Ausnahmeregelungen können danach beantragt werden.
Mit dem Schritt verabschiedet sich auch Microsoft jetzt weitgehend von Regelungen, die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt worden waren. Andere US-Konzerne sind bei der Pflicht zur Rückkehr ins Büro schon deutlich weiter, Amazon etwa hat schon für Anfang des Jahres alle Angestellten ins Büro zurückbeordert. Als Hindernis hat sich dabei erwiesen, dass es überhaupt nicht genug Arbeitsplätze für die Beschäftigten gegeben hat. In Deutschland bleibt die Zahl der Angestellten im Homeoffice dagegen stabil, besonders in der IT-Branche arbeiten viele zumindest teilweise von zu Hause. „Prominente Beispiele einzelner Unternehmen, die ihre Beschäftigten zurück ins Büro holen, bleiben Einzelfälle“, hieß es zuletzt vom Wirtschaftsinstitut ifo.
(mho)
Künstliche Intelligenz
Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: Nvidias Super-Netzwerktechnik
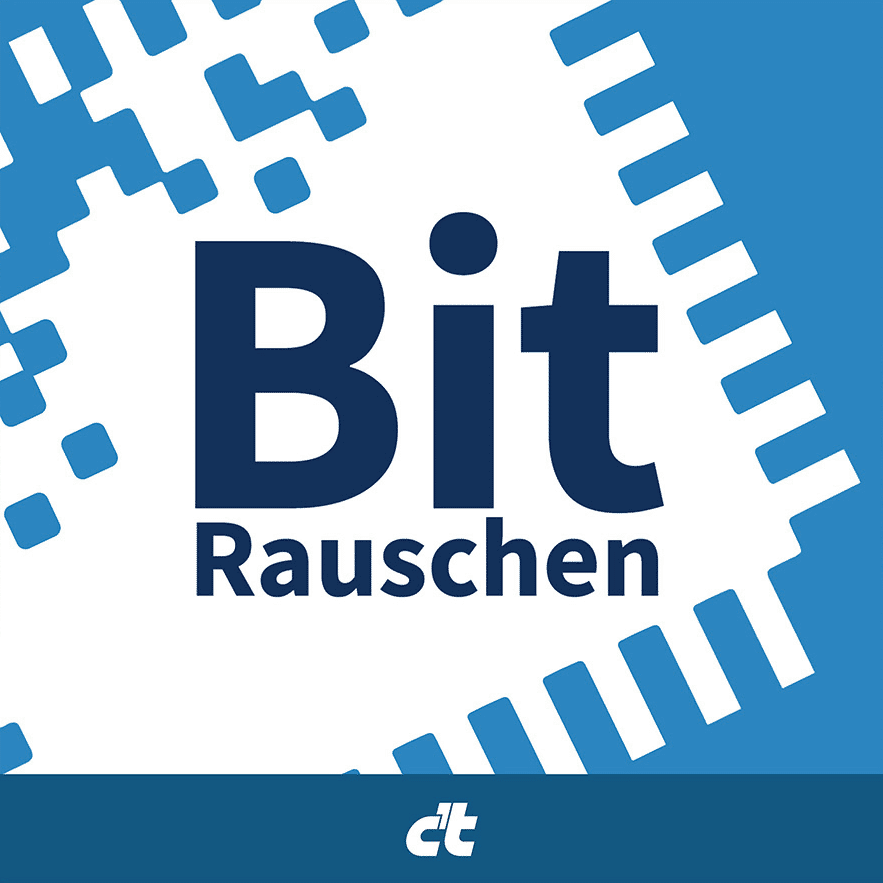
Den Prozessor-Podcast von c’t gibt es jeden zweiten Mittwoch …
Nvidia jagt von einem Umsatzrekord zum nächsten und ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Das liegt vor allem an den starken KI-Beschleunigern, die den aktuellen KI-Hype befeuern.
Doch KI-Chips alleine machen noch kein optimales KI-Rechenzentrum – sonst würden Konkurrenten wie AMD oder Cerebras viel mehr davon verkaufen. Es braucht noch mehr Zutaten, etwa die etablierte Programmierschnittstelle CUDA.
Weniger im Rampenlicht steht eine weitere wichtige Komponente: die Vernetzungstechnik NVLink. Nvidia hat sie geschickt fortentwickelt und tief in die KI-Beschleuniger integriert. Mit InfinityFabric und offenen Ansätzen wie Ultra Ethernet und Ultra Accelerator Link (UAL) wollen die Konkurrenten aufholen.
Was NVLink so besonders macht, erklärt c’t-Redakteur Carsten Spille in Folge 2025/19 von „Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t“.
Podcast Bit-Rauschen, Folge 2025/19 :
Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik zum Bit-Rauschen. Rückmeldungen gerne per E-Mail an bit-rauschen@ct.de.
Alle Folgen unseres Podcasts sowie die c’t-Kolumne Bit-Rauschen finden Sie unter www.ct.de/Bit-Rauschen
(ciw)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 3 Wochen
Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 7 Tagen
Entwicklung & Codevor 7 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
















