Künstliche Intelligenz
Über den Chat hinaus: Mit LLMs echte Nutzerprobleme lösen
Seit dem Erscheinen von ChatGPT ist das Chat-Fenster das zentrale User-Interface für die Interaktion mit künstlicher Intelligenz. Doch ist ein Chat tatsächlich die optimale Möglichkeit zur Interaktion – oder gibt es möglicherweise besser geeignete Wege, KI in Anwendungen zu integrieren?

Sascha Lehmann war mit seinem ersten PC schon klar, in welche Richtung die Reise geht. Durch Desktop- und Backend-Entwicklung im .NET-Umfeld fand er über die Jahre hinweg zu seiner wahren Leidenschaft, der Webentwicklung. Als Experte im Angular- und im UI/UX-Umfeld hilft er bei der Thinktecture AG in Karlsruhe tagtäglich Kunden bei ihren Herausforderungen und Vorhaben.
In den vergangenen Jahren haben KI-Werkzeuge die Welt im Sturm erobert. KI-Funktionen hielten Einzug in alltäglich genutzte Software – sei es in Entwicklungsumgebungen (IDEs), Office-Programmen oder sogar bei der Erstellung der Steuererklärung. Und fast überall kann man mit der Software chatten. Doch warum eigentlich?
Warum Chat als Interface so gut funktioniert
Die Stärken großer Sprachmodelle liegen insbesondere darin, unterschiedlichste Arten von Informationen zu verarbeiten und in natürlicher Sprache mit Nutzerinnen und Nutzern zu kommunizieren. Dafür benötigen sie Eingaben – ebenfalls in natürlicher Sprache. Was läge also näher, als per Texteingabe mit ihnen zu interagieren?
Auch aus Sicht der User-Experience (UX) bietet sich der Chat als Interface zunächst an. Nahezu jede und jeder kennt dieses mentale Modell – also die grundsätzliche Funktionsweise und das Erscheinungsbild eines Chatfensters – und kann es intuitiv nutzen, ohne vorherige Schulung. Gerade diese Niedrigschwelligkeit war einer der entscheidenden Faktoren für den durchschlagenden Erfolg von ChatGPT und vergleichbaren Anwendungen.
Mehrwert statt Selbstzweck: Was gute KI-Features ausmacht
Bei genauerer Betrachtung kann das Interaktionsmodell „Chat“ jedoch nicht ohne Weiteres ebenso erfolgreich auf andere Einsatzbereiche übertragen werden. So hilfreich es sein kann, beliebige Fragestellungen in einem offenen Chat mit einer KI zu diskutieren, umso schneller verliert dieses Modell seinen Reiz, sobald es in einem klar definierten Anwendungskontext zum Einsatz kommt. Der Rahmen ist dort meist deutlich enger gesteckt, was neue Herausforderungen aufwirft – beispielsweise:
- Wie kann ein Chat sinnvoll in den Anwendungskontext integriert werden?
- Welchen konkreten Mehrwert bietet die KI-Funktion gegenüber etablierten Arbeitsabläufen?
- Wie können fachspezifische Informationen kontextbezogen eingebunden werden?
Ohne gezielte Unterstützung – etwa Hinweise zu möglichen Interaktionen oder zum verfügbaren Domänenwissen und dessen Nutzung im Chat – fühlen sich viele Nutzerinnen und Nutzer schnell überfordert. Bleiben erste Interaktionen zudem erfolglos, führt das häufig zu Frustration – und das beworbene KI-Feature wird nur noch zögerlich oder gar nicht mehr verwendet. Es entsteht der Eindruck, die neue Technologie sei lediglich um ihrer selbst willen integriert worden.
Ein solches Nutzungserlebnis gilt es unbedingt zu vermeiden. KI-Funktionen – wie auch alle anderen Features – müssen einen klaren Mehrwert bieten. Sei es durch eine Erweiterung des Funktionsumfangs oder durch die Vereinfachung zuvor mühsamer Aufgaben.
UX-Patterns gegen kognitive Überforderung
Ein blanker Chat erzeugt – ähnlich wie die berüchtigte leere Seite beim Schreiben einer Hausarbeit – eine zu hohe kognitive Last, also eine Art Überforderungs- oder Lähmungszustand. Um dem entgegenzuwirken, können Vorschläge (Suggestions), hilfreich sein: kleine Container mit konkreten Prompt-Hinweisen.
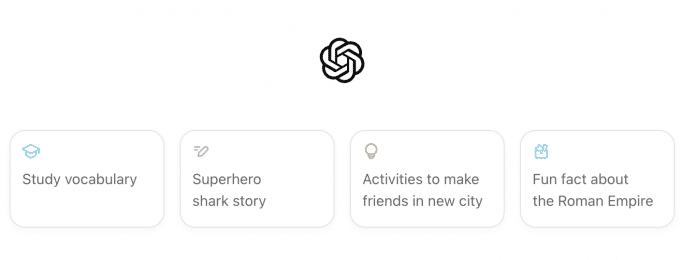
„Vorschlagskarten“ (hier für Chat-GPT) helfen, die anfängliche Überforderung zu reduzieren und Interaktionshinweise zu geben.
(Bild: Shape of AI)
Diese Suggestions sind Teil einer Sammlung von UX-Patterns (Shape of AI) rund um den Einsatz von KI- und Chat-Integrationen. Da künstliche Intelligenz nach wie vor ein junges Themenfeld ist, werden in den kommenden Jahren zunehmend weitere dieser Gestaltungsmuster entstehen, auf die Entwicklerinnen und Entwickler bei der Konzeption und Entwicklung zurückgreifen können. Dennoch empfiehlt es sich, bereits heute solche Patterns zu nutzen, um Usern einen einfachen und intuitiven Einstieg zu ermöglichen.
Tu, was ich will – nicht, was ich sage
Die kognitive Last ist nicht die einzige Schwachstelle von Chat-basierten Interfaces. Bei längeren Konversationen kann es dazu kommen, dass das Kontextfenster – sozusagen das Kurzzeitgedächtnis des LLM, um Informationen der Konversation zu halten – des aktuell verwendeten Sprachmodells ausgeschöpft ist. In solchen Fällen müssen User auf einen neuen Chat ausweichen. Da LLMs jedoch über kein dauerhaftes Gedächtnis verfügen, ist es notwendig, bei diesem Wechsel eine Zusammenfassung des bisher Gesagten mitzugeben – nur so kann an vorherige Ergebnisse angeknüpft werden.
Zudem neigen LLMs in Konversationen gelegentlich zu Halluzinationen oder verlieren sich bei unpräzisen Eingaben in einem ineffizienten Hin und Her. Besonders problematisch wird das, wenn die Nutzerin oder der Nutzer bereits eine klare Vorstellung vom gewünschten Ergebnis hat. Die Herausforderung liegt darin, die eigene Intention so klar zu formulieren, dass das Modell sie korrekt interpretiert – ganz nach dem Motto: „Tu, was ich will – nicht, was ich sage.“
Formulare automatisch verstehen und ausfüllen
Gibt es also jenseits des klassischen Chat-Interfaces klügere Wege, Nutzerinnen und Nutzern KI-Funktionen zugänglich zu machen – möglichst in kleinen, leicht verdaulichen Einheiten, sodass Überforderung gar nicht erst entsteht?
Ein genauer Blick auf die Stärken großer Sprachmodelle zeigt Fähigkeiten, die im Alltag besonders hilfreich sein können:
- Verständnis und Verarbeitung natürlicher Sprache
- umfangreiches Weltwissen
- vielfältige Einsatzgebiete und enorme Anpassbarkeit
- Multimodalität – Verarbeitung von Text-, Audio- und Bilddaten (ohne Modellwechsel)
- Echtzeitsprachverarbeitung
- Erkennung und Analyse von Patterns
Immer wieder gibt es Anwendungsszenarien, in denen Daten aus Dokumenten, Bildern oder Videos zu extrahieren und in strukturierter Form weiterzuverarbeiten sind – etwa bei Formularen. Das Ausfüllen langer Formulare zählt in der Regel nicht zu den beliebtesten Aufgaben im Alltag.
Gerade hier besteht deutliches Potenzial zur Verbesserung der User-Experience. Doch wie könnte ein optimierter „Befüllungs-Workflow“ konkret aussehen?
Von Text zu JSON: Daten intelligent befüllen
Für die Arbeit mit Formularen stehen im Web und in etablierten Frameworks umfangreiche Schnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) zur Verfügung. Die zugrunde liegende Struktur eines Formulars wird dabei häufig in Form eines JSON-Objekts (JavaScript Object Notation) definiert.
Das Listing zeigt eine exemplarische Deklaration einer FormGroup (inklusive Validatoren) innerhalb einer Angular-Anwendung.
personalData: this.fb.group({
firstName: ['', Validators.required],
lastName: ['', Validators.required],
street: ['', Validators.required],
zipCode: ['', Validators.required],
location: ['', Validators.required],
insuranceId: ['', Validators.required],
dateOfBirth: [null as Date | null, Validators.required],
telephone: ['', Validators.required],
email: ['', [Validators.required, Validators.email]],
licensePlate: ['', Validators.required],
}),
Dieses JSON-Objekt stellt den ersten Baustein des Workflows dar und definiert zugleich die Zielstruktur, in die das System die extrahierten Informationen überführt. Den zweiten Baustein bilden die Quelldaten in Form von Text, Bildern oder Audio. Zur vereinfachten Darstellung liegen sie im folgenden Szenario in Textform vor und sollen über die Zwischenablage in das System übertragen werden.
Bleibt noch ein dritter Aspekt: Entwicklerinnen und Entwickler müssen das Sprachmodell instruieren – sie müssen ihm eine präzise Aufgabenbeschreibung geben, um den gewünschten Verarbeitungsschritt korrekt durchzuführen. Diese Instruktion erfolgt im Hintergrund, vor dem User versteckt.
Versteckte Prompts: KI steuern ohne Chatfenster
Auch wenn Entwicklerinnen und Entwickler bewusst auf ein Chat-Interface verzichten, arbeiten Sprachmodelle weiterhin auf Basis von Instruktionen in natürlicher Sprache. Um Usern die Formulierungs- und Eingrenzungsarbeit abzunehmen, können diese Anweisungen vorab als sogenannte System-Messages oder System-Prompts im Programmcode hinterlegt werden.
Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass die Befehle standardisiert und in konsistenter Qualität an das LLM übermittelt werden können. Zudem ist es möglich, diese Prompts mit Guards zu versehen – ergänzenden Anweisungen, die Halluzinationen vorbeugen oder potenziellem Missbrauch entgegenwirken sollen.
Nachfolgend eine exemplarische Darstellung eines System Prompt mit einer gezielten Aufgabe für das LLM:
Each response line must follow this format:
FIELD identifier^^^value
Provide a response consisting only of the following lines and values derived from USER_DATA:
${fieldString}END_RESPONSE
Do not explain how the values are determined.
For fields without corresponding information in USER_DATA, use the value NO_DATA.
For fields of type number, use only digits and an optional decimal separator.
In modernen Frontend-Applikationen ist es üblich, dass Schnittstellen ihre Antworten im JSON-Format liefern, da diese Datenstruktur leicht weiterverarbeitet werden kann.
Für möglichst präzise und verlässliche Ergebnisse kann die erwartete Zielstruktur mithilfe des JSON Mode definiert werden – in Form eines JSON-Schemas. Es beschreibt die Felder nicht nur strukturell, sondern auch mit genauen Typinformationen. Das erspart ausführliche textuelle Erläuterungen und erleichtert die Verarbeitung der Ergebnisse im Frontend.
Um Typsicherheit in der Anwendung sicherzustellen, kommt häufig Zod zum Einsatz – eine auf TypeScript ausgerichtete Validierungsbibliothek, mit der Datenstrukturen, von einfachen Strings bis hin zu komplexen geschachtelten Objekten, deklarativ definiert und zuverlässig geprüft werden können.
Das folgende Listing von OpenAI zeigt einen exemplarischen Aufruf der OpenAI-API, um Daten in einem bestimmten JSON Format zu extrahieren.
import OpenAI from "openai";
import { zodTextFormat } from "openai/helpers/zod";
import { z } from "zod";
const openai = new OpenAI();
// JSON-Schema-Definition mithilfe von Zod
const CalendarEvent = z.object({
name: z.string(),
date: z.string(),
participants: z.array(z.string()),
});
const response = await openai.responses.parse({
model: "gpt-4o-2024-08-06",
input: [
{ role: "system", content: "Extract the event information." },
{
role: "user",
content: "Alice and Bob are going to a science fair on Friday.",
},
],
text: {
format: zodTextFormat(CalendarEvent, "event"),
},
});
const event = response.output_parsed;
So kommunizieren Anwendungen mit dem LLM
Um System-Prompts und Quelldaten an ein LLM zu übermitteln, stehen je nach Anbieter verschiedene SDKs (Software Development Kits) zur Verfügung. Das obige Listing zeigt beispielsweise die Verwendung des OpenAI-SDK. Weitere Beispiele führender Anbieter sind Anthropic und Google. Sie bieten jeweils umfangreiche Funktionen, hohe Performance und eine benutzerfreundliche Developer-Experience, die den Einsatz der SDKs erleichtert.
Selbstverständlich ist die Nutzung von KI-Modellen nicht auf webbasierte Angebote großer Anbieter beschränkt. Wer mit kleineren Modellen für seine Aufgaben auskommt, kann ebenso lokal laufende Modelle verwenden oder auf im Browser integrierte Modelle wie WebLLM zurückgreifen.
Nach der erfolgreichen Implementierung und Abstraktion der SDK-Aufrufe genügt bereits ein Dreizeiler für das vollständige Parsing.
Es folgt eine exemplarische Darstellung des Ablaufs eines Extraktionsvorgangs anhand einer in Angular definierten FormGroup:
/* User Message – Datenquelle, aus der Daten zum Befüllen des Formulars extrahiert werden sollen. Diese werden in die Zwischenablage kopiert
Max Mustermann
77777 Musterstadt
Kfz-Kennzeichen: KA-SL-1234
Versicherungsnummer: VL-123456
*/
// Angular FormGroup zum Erfassen persönlicher Daten
personalData: this.fb.group({
firstName: ['', Validators.required],
lastName: ['', Validators.required],
street: ['', Validators.required],
zipCode: ['', Validators.required],
location: ['', Validators.required],
insuranceId: ['', Validators.required],
dateOfBirth: [null as Date | null, Validators.required],
telephone: ['', Validators.required],
email: ['', [Validators.required, Validators.email]],
licensePlate: ['', Validators.required],
}),
// JSON-Schema, das mit Zod anhand der FormGroup erstellt wurde
{
"firstName": {
"type": "string"
},
"lastName": {
"type": "string"
},
"street": {
"type": "string"
},
"zipCode": {
"type": "string"
},
"location": {
"type": "string"
},
"insuranceId": {
"type": "string"
},
"dateOfBirth": {
"type": "object"
},
"telephone": {
"type": "string"
},
"email": {
"type": "string"
},
"licensePlate": {
"type": "string"
}
}
// Antwort des LLM
[
{
"key": "firstName",
"value": "Max"
},
{
"key": "lastName",
"value": "Mustermann"
},
{
"key": "location",
"value": "Musterstadt"
},
{
"key": "zipCode",
"value": "77777"
},
{
"key": "licensePlate",
"value": "KA-SL-1234"
},
{
"key": "insuranceId",
"value": "VL-123456"
}
]
// Befüllen des Formulars mit den Ergebnissen (hier eine Angular FormGroup --> personalData)
try {
const text = await navigator.clipboard.readText();
const completions = await this.openAiBackend.getCompletions(fields, text);
completions.forEach(({ key, value }) => this.personalData.get(key)?.setValue(value));
} catch (err) {
console.error(err);
}
Aufwendige Ausfüllarbeiten gehören von nun an der Vergangenheit an und können dank geschickt eingesetzter KI-Unterstützung mühelos erledigt werden.
Dieses Beispiel zeigt einen ausgeführten Extraktionsvorgang: Zunächst wird der Text mit Informationen in die Zwischenablage kopiert, dann der Extraktionsvorgang gestartet, und schließlich stehen automatisch befüllte Formularfelder anhand der Textinformation bereit.

Darstellung des Ablaufs eines Extraktionsvorgangs aus Sicht der User (in drei Schritten, von oben nach unten).
Mehr Transparenz bei KI-generierten Inhalten
Diese Integration allein verbessert die UX enorm. Bei genauerer Betrachtung fallen aus UX-Designer-Sicht allerdings noch weitere Möglichkeiten auf:
Wie steht es etwa um die Nachvollziehbarkeit? Aktuell werden anhand des übermittelten Textes oder Bildes die Felder des Formulars automatisch befüllt. Zudem kann der Nutzer oder die Nutzerin das Formular nach Belieben selbst anpassen und editieren. Das mag in den meisten Fällen ausreichend und unproblematisch sein. Doch in bestimmten Kontexten reicht das allein nicht aus – beispielsweise bei rechtlich verbindlichen Themen wie Versicherungen oder Banking. Hier muss unter Umständen ersichtlich sein, welche Felder von einem Menschen und welche mithilfe von KI-Unterstützung befüllt wurden. Aus UX-Gründen ist es außerdem sinnvoll, Nutzern transparent zu vermitteln, wie einzelne Feldwerte zustande gekommen sind.
Nachvollziehbarkeit sichtbar machen
Ein Blick auf die großen Player zeigt: Wenn es um die Visualisierung von KI-generierten Inhalten geht, kommen oftmals Farbverläufe, Leucht- und Glitzereffekte zum Einsatz. Die folgenden Beispiele zeigen die visuelle Gestaltung von KI-Inhalten anhand der Designsprache von Apple und Google.

Beispiele für die Designsprachen von Apple (oben) und Google (unten) in Bezug auf deren AI-Produkte.
Warum also nicht dieses Pattern aufgreifen und für eigene Integrationen nutzen? Die großen Anbieter verfügen über UI/UX-Research-Budgets, von denen kleinere Unternehmen nur träumen können. Es liegt nahe, sich hier inspirieren zu lassen, zumal die hohe Reichweite bereits neue visuelle Standards prägt – Nutzer sind mit derartigen Darstellungen zunehmend vertraut.
Eine exemplarische Umsetzung im gezeigten Formularszenario könnte darin bestehen, automatisch befüllte Felder mit einem leuchtenden Rahmen (Glow-Effekt) zu versehen. Diese einfache Maßnahme schafft eine klare visuelle Unterscheidbarkeit – und verbessert gleichzeitig die User-Experience.

Automatisch befüllte Felder sind durch einen leuchtenden Rahmen (Glow-Effekt) hervorgehoben.
Um die Nachvollziehbarkeit weiter zu verbessern, können Entwickler eine History-Funktion einbauen: Sie zeigt, welche automatischen Extraktionen wann passiert sind – inklusive der genutzten Quellen (Texte, Sprache oder Bilder). So haben User jederzeit den Überblick und können bei Bedarf einfach per Undo/Redo zu einem früheren Zustand zurückspringen.
Künstliche Intelligenz
DLR-Studie analysiert 118 Drohnenstörfälle an Flughäfen
Nichts geht mehr: Flugzeuge werden umgeleitet, Flüge werden gestrichen, Warteschlangen an den Terminals. Wird ein unbemanntes Fluggerät (Unmanned Aerial Vehicle) in der Nähe eines Flugplatzes gesichtet, wird im schlimmsten Fall der Flugverkehr unterbrochen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat die Auswirkung solcher Drohnenflüge an deutschen Flughäfen untersucht.
Weiterlesen nach der Anzeige
Für die Studie hat das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) dem DLR Daten zu den Störfällen im vergangenen Jahr bereitgestellt. Danach wurden dem LBA 118 Störfälle gemeldet. Darunter seien neun, bei denen der Flugverkehr unterbrochen wurde, teilte das DLR mit. Der wirtschaftliche Schaden für diese neun Fälle lag demnach bei rund einer halben Million Euro.
Im Schnitt dauerten die Vollsperrungen 32 Minuten. Nach einer Drohnensichtung wurde der Flugverkehr jedoch für mehr als eine Stunde unterbrochen. Wegen der engen Taktung der Flüge kam es dabei zu einer Vielzahl von Verspätungen und entsprechenden Folgeeffekten im Streckennetz. In 56 Fällen kam es zu kleineren Beeinträchtigungen. Dazu gehörte etwa die Sperrung einzelner Pisten, die wiederum eine Änderung der Betriebsrichtung nach sich ziehen konnte.
Wirtschaftlicher Schaden für Fluggesellschaften
Leidtragende der Vorfälle waren die Fluggesellschaften, denen durch die Sperrungen wirtschaftliche Schäden entstanden: In zwei Fällen mussten Flugzeuge nach mehreren Warteschleifen über dem Zielflughafen auf einem Ausweichflughafen landen.
Diese Betriebsstörungen verursachten zusätzliche Kosten, etwa durch erhöhten Treibstoffverbrauch wegen längerer Flugzeiten, zusätzliche Landegebühren und Aufwendungen für Passagierverpflegung nach EU-Vorgaben. Schließlich seien Personal und Fluggerät höheren Belastungen ausgesetzt gewesen. Flugausfälle gab es aufgrund der Drohnenvorfälle nicht. Deshalb verzeichneten die Flughäfen auch keine nachweisbaren wirtschaftlichen Schäden.
„Auch wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen der 2024 dokumentierten Fälle in Deutschland insgesamt begrenzt blieben, zeigen die DLR-Analysen, dass bereits vergleichsweise kurze Betriebseinschränkungen durch die starke Vernetzung des Luftverkehrssystems umfangreiche Folgewirkungen im Luftverkehr, operative Mehraufwände und wirtschaftliche Risiken nach sich ziehen können“, sagte Florian Linke, kommissarischer Direktor des DLR-Instituts für Luftverkehr. „Dies gilt insbesondere bei Sperrungen ab etwa einer Stunde, da bei solchen die Pufferkapazitäten des Lufttransportsystems aufgebraucht sind, was zu einem sprunghaften Ansteigen der Kosten führen kann.“
Weiterlesen nach der Anzeige
Drohnen verursachen Flughafensperrungen
Anfang Oktober fielen in München nach einer Drohnensichtung zahlreiche Flüge aus, 3000 Passagiere waren davon betroffen. In Dänemark und Norwegen gab es im September mehrere Drohnenvorfälle, die teilweise zu Flughafenschließungen führten. Der bedeutsamste Vorfall ereignete sich im Dezember 2018, als der Flughafen London-Gatwick 33 Stunden gesperrt blieb. Der Schaden betrug etwa 100 Millionen Euro.
Die Drohnenvorfälle verursachten jedoch nicht nur wirtschaftliche Schäden, sagte DLR-Chefin Anke Kaysser-Pyzalla. „Zudem bleiben Fragen der Sicherheit eine zentrale Herausforderung, die zusätzliche Investitionen erfordern.“
Ein Schluss, den das DLR aus der Studie zieht, ist die Notwendigkeit, Drohnensichtungen an Flughäfen genauer zu dokumentieren. Derzeit würden sie „im deutschen Luftraum mit uneinheitlicher Datenqualität“ erfasst. Durch eine präzisere Dokumentation ließen sich sich operative Folgen, wirtschaftliche Auswirkungen und Risiken frühzeitig erkennen. „Daraus resultierend können geeignete Maßnahmen abgeleitet werden“, sagte Kaysser-Pyzalla.
(wpl)
Künstliche Intelligenz
Balkonkraftwerk & dynamischer Stromtarif: Speicher im Winter profitabel laden
Dank Abrechnung im Viertelstundentakt profitiert man bei einem dynamischen Stromtarif vom Auf und Ab des Strompreises. Aber nur unter bestimmten Bedingungen.
Statt einen festgelegten Betrag pro Kilowattstunde Strom zu bezahlen, bieten dynamische Stromtarife eine Abrechnung im Viertelstundentakt. Damit können Anwender von den täglichen Preisschwankungen am Strommarkt profitieren, indem sie starke Verbraucher wie Waschmaschine, Herd und Geschirrspüler verwenden, wenn der Strompreis besonders niedrig ausfällt. Liegt der Preisunterschied zwischen hohem und niedrigem Preis bei deutlich über 20 Prozent, kann sich auch das Laden eines Stromspeichers über das öffentliche Stromnetz lohnen. Doch um einen dynamischen Stromtarif sinnvoll verwenden zu können, sind einige Hürden zu überwinden. Und Geduld sollte man auch haben.
Welche Voraussetzungen müssen für die optimale Nutzung eines dynamischen Stromtarifs erfüllt sein?
Für die Nutzung eines dynamischen Stromtarif mit einer Abrechnung im Viertelstundentakt muss am Stromanschluss des Hauses oder der Eigentumswohnanlage ein sogenanntes intelligentes Messsystem (iMSys) installiert sein. Es besteht aus einer modernen Messeinrichtung (mME) und einer Kommunikationseinheit, dem sogenannten Smart-Meter-Gateway (SMG). Damit werden Daten der Messeinrichtung für Verbraucher, Netzbetreiber und Stromlieferanten bereitgestellt.
Damit das Smart-Meter-Gateway die Daten bereitstellen kann, die die Grundlage für die Abrechnung im Viertelstundentakt sind, muss im Zählerraum entweder ein Netzwerkanschluss vorhanden oder Mobilfunkempfang möglich sein. Eine Funkverbindung über WLAN reicht nicht.
Ein Netzwerkkabel in den Keller mit dem Stromanschluss zu legen, sollte für Eigenheimbesitzer machbar sein. Für Bewohner einer Eigentumsanlage ist das weniger trivial. Hier ist ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft notwendig, und das kann dauern. Diese trifft sich praktisch nur einmal im Jahr, denn obwohl Umlaufbeschlüsse gesetzlich vorgesehen sind, blocken viele Verwaltungen diese ab. Entscheidet sich die Eigentümergemeinschaft gegen einen Netzwerkanschluss im Zählerraum, dann hat sich das Thema dynamische Stromtarife erst einmal erledigt.
Was kostet der Einbau eines intelligenten Messsystems (iMsys) und wie hoch sind die jährlichen Nutzungsgebühren?
Bis spätestens 2032 sollen laut Bundesnetzagentur „alle Verbraucherinnen und Verbraucher mit modernen Messeinrichtungen ausgestattet sein.“ Die Kosten für den Einbau eines intelligenten Messsystems werden in der Regel vom Messstellenbetreiber oder Stromlieferanten übernommen. Ein Einbau auf Kundenwunsch kann aber Kosten von bis zu 100 Euro verursachen. Bei tatsächlich höheren Kosten kann es auch teurer werden. Die Kosten für den Netzwerkanschluss trägt der Eigentümer respektive die Eigentümergemeinschaft.
Die jährliche Nutzungsgebühr für ein iMSys ist mit 30 Euro jährlich höher als bei herkömmlichen Zwei-Richtungszählern. Beim Stromanbieter Süwag steigen die monatlichen Kosten von 2,08 Euro für eine moderne Messeinrichtung (mME) auf 2,50 Euro für ein intelligentes Messsystem (iMSys).
Wie lange dauert es, bis ein intelligentes Messsystem eingebaut wird?
Bis 2032 sollen hierzulande alte Stromzähler durch eine moderne Messeinrichtung ersetzt werden. Zuständig für den Umbau sind die örtlichen Stadtwerke, die als Betreiber des Energieversorgungsnetzes im Gebiet die Aufgabe des grundzuständigen Messstellenbetreibers übernehmen. Auf Wunsch des Kunden kann der Messstellenbetrieb auch von einer Drittfirma durchgeführt werden. Infrage kommen dabei etwa Messstellenbetreiber, die dafür mit Anbietern eines dynamischen Stromtarifs kooperieren.
Wir haben den Versuch unternommen und sind zum Anbieter Rabot Energy gewechselt. In einer anderen Wohnung erfolgte der Wechsel zu Tibber. Rabot Energy arbeitet mit Inexogy zusammen. Den Einbau des iMSys haben wir über Rabot Energy am 8. April beantragt. Die Bestätigung der Bestellung erfolgte am 23. April. Ende Mai wurde uns ein Einbautermin für den 9. Juli bestätigt. Aufgrund der Erkrankung des zuständigen Technikers wurde der Termin abgesagt. Mitte August wurde uns ein neuer Termin mitgeteilt. Der Einbau sollte nun am 8. Oktober erfolgen. Dieses Mal erreicht uns der Techniker. Da in unserem Zählerraum allerdings kein Mobilfunkempfang möglich ist und auch keine verkabelte Netzwerkverbindung existiert, konnte das intelligente Messsystem nicht eingebaut werden. Ein im Zählerraum vorhandenes WLAN konnte der Smart Meter von Inexogy nicht nutzen.
In der zweiten Wohnung derselben Eigentumswohnanlage, die von Tibber mit Strom versorgt wird, weist uns die App zwar auf ein Smart Meter hin. Doch nach der Überprüfung der Standortdaten heißt es dort: „Es sieht so aus, als ob dein Netzbetreiber noch keine Smart Meter für deine Postleitzahl anbietet. Wir empfehlen dir, dich direkt mit deinem Netzbetreiber in Verbindung zu setzen, um zu schauen, was möglich ist.“
Da wir aufgrund der Erfahrungen mit Rabot Energy/Inexogy und der Recherche zu diesem Artikel inzwischen wissen, dass die Eigentümergemeinschaft erst eine für den Betrieb des Smart Meters nötige Netzwerkverbindung im Zählerraum realisieren muss, haben wir von einer Kontaktaufnahme mit den örtlichen Stadtwerken vorerst abgesehen.
Wo liegen die Vorteile eines dynamischen Stromtarifs?
Wie eingangs beschrieben, kann man mithilfe eines dynamischen Stromtarifs die Preisschwankungen am Strommarkt nutzen, um bei besonders günstigen Preisen E-Autos und Stromspeicher zu laden oder andere große Verbraucher wie Waschmaschine, Herd und Geschirrspüler zu verwenden.
Besonders attraktiv erscheinen dynamische Stromtarife für Nutzer von Stromspeichern, wenn die PV-Anlage im Winter oder bei schlechtem Wetter nicht genügend Leistung zum Laden der Akkus bietet. So kann man bei niedrigen Preisen den Stromspeicher laden und wenn der Strompreis am Abend steigt, zur Entladung nutzen. In der Theorie zahlt man also immer den niedrigsten Tarif pro kWh.
Damit sich das Laden des Stromspeichers lohnt, sollte aufgrund von Wandlungsverlusten die Differenz zwischen höchstem und niedrigstem Tarif bei deutlich über 20 Prozent liegen.
Wie viel kann man mit einem dynamischen Stromtarif sparen?
Laut einem vom Verbraucherzentrale-Bundesverband beauftragten Gutachten (PDF) des Forum Ökologisch Soziale Marktwirtschaft können Haushalte mit einem dynamischen Stromtarif bis zu sieben Prozent ihrer Kosten im Vergleich zu einem günstigen Festpreistarif einsparen. Diese Ersparnis ist jedoch stark vom individuellen Verbrauchsverhalten abhängig.
Die Berechnungen basieren auf einem Musterhaushalt mit vier Personen und einem Elektroauto (5.800 kWh/Jahr), der 66 Prozent seines Verbrauchs verschieben konnte. Hier belief sich die Ersparnis auf 65 Euro in einem halben Jahr.
Deutlich geringer fiel die Ersparnis für Haushalte ohne E-Auto aus: Ein Vier-Personen-Haushalt (2.900 kWh/Jahr) sparte nur drei Prozent, ein Zwei-Personen-Haushalt (1.800 kWh/Jahr) sogar nur ein Prozent. Grund hierfür ist das geringere Flexibilisierungspotenzial des Stromverbrauchs von 29 Prozent respektive 14 Prozent.
Für Haushalte mit niedrigen Verbräuchen respektive geringer Möglichkeit zur Lastverschiebung bleibt somit nur ein klassischer Stromtarif, den sie am besten jährlich wechseln (Heise-Vergleichsrechner Stromtarife), um das höchste Einsparpotenzial zu erzielen.
Wer sich nicht selbst um günstige Preise und Anbieterwechsel kümmern will, kann zu Wechselservices wie Remind.me gehen. Der Anbieter bietet kostenlose Wechsel zwischen Strom- und Gasanbietern an. Dabei erhält der Kunde vorab eine Empfehlung und kann sich dann für oder gegen das jeweilige Angebot entscheiden. Vorteil: Remind.me vergleicht über 12.000 Tarife und meldet sich automatisch, wenn man einen Vertrag wechseln kann.
Welche Stromspeicher unterstützen das bidirektionale Laden?
Nicht jeder Stromspeicher kann per Strom aus dem öffentlichen Netz geladen werden. In unserer Top-10 der besten Stromspeicher für Balkonkraftwerke sind bis auf den Marstek Jupiter C Plus und der Anker Solarbank E1600 Pro aber alle anderen Modelle dazu in der Lage. Dabei unterstützen die Apps das automatische Laden der Akkus auf Basis dynamischer Stromtarife.
Mit dem Sunlit-Speicher (Testbericht) und dem optional erhältlichen bidirektionalen Wechselrichter EV3600 können Anwender sogar ihr E-Auto laden. Das funktioniert auch autark im Inselbetrieb, allerdings nur bis zu einer Leistung von 3,7 kW. Das mag für reinrassige Elektrofahrzeuge mit Batteriegrößen von bis zu über 100 kWh zu wenig sein, aber für Hybrid-PKWs reicht die maximale Speicherkapazität von 8 kWh zumindest für eine Teilladung. Verteilt auf zwei Tage gelingt der Lösung, die meisten Hybrid-Fahrzeuge voll aufzuladen. Wer das System zudem mit einem Starkstromanschluss verbindet, erreicht eine Ladeleistung von bis zu 11 kW.
Anbieter dynamischer Stromtarife
Seit Beginn des Jahres sind Stromanbieter verpflichtet, Kunden mit einem intelligenten Messsystem (iMSys) auch dynamische Stromtarife anzubieten. Laut dem Vergleichsportal Check24 gehören folgende Anbieter bei einem Strombedarf von 3000/5000 kWh zu den günstigsten.
- Rabot Energy (mit Code RABOT120 erhält man 120 Euro nach einem Jahr ausgezahlt, bei sechs Monaten sind es mit dem Code RABOT60 60 Euro)
- Tibber
- Tado
Das Finanzportal finanztip.de sieht Stand 6. Oktober folgende Anbieter im Vorteil:
(Nicht berücksichtigt haben wir dabei Angebote mit einer aktuell hohen Beschwerdequote)
Fazit
Wer ein intelligentes Messsystem (iMSys) am Hausanschluss verbaut hat, kann durch einen dynamischen Stromtarif mit Abrechnung im Viertelstundentakt profitieren. Die Wirtschaftlichkeit hängt dabei maßgeblich von der Flexibilität des Verbrauchsverhaltens und der technischen Ausstattung des Haushalts ab.
Ein dynamischer Tarif ist besonders vorteilhaft für Haushalte mit:
- Einem Elektroauto, das flexibel geladen werden kann.
- Einer Wärmepumpe oder einem Nachtspeicherofen.
- Einem Batteriespeicher, der bei günstigen Preisen geladen werden kann.
- Smarten Steuerungen, die Verbraucher automatisiert in preisgünstige Zeiten verschieben.
- Einem flexiblen Tagesablauf, der die Verlagerung des Stromverbrauchs ermöglicht.
Weniger geeignet ist dieser Tarif für Haushalte mit:
- Einem starren Tagesrhythmus und geringer Flexibilität, stromintensive Tätigkeiten zu verschieben.
- Einem durchschnittlichen Verbrauchsprofil ohne größere steuerbare Verbraucher.
- Einem hohen Bedarf an Planungssicherheit und konstanten monatlichen Abschlagszahlungen.
- Abneigung gegen aktives Strommanagement und der täglichen Auseinandersetzung mit Strompreisen.
Letztlich bietet der dynamische Tarif die Chance, durch aktives Lastmanagement Kosten zu sparen, geht jedoch mit einem höheren Maß an Ungewissheit und dem Risiko von Preisspitzen einher.
Künstliche Intelligenz
Noch eine kurze, dicke Tüte und APS-C-Nikkore – Fotonews der Woche 42/2025
Vor sieben Wochen hatten wir die Vorzüge und Einschränkungen der heute raren Festbrennweiten mit 200 Millimetern und hoher Lichtstärke beschrieben, daher nun in aller Kürze: Toll für Sport, Event, und ein bisschen Porträt-Arbeit. In der DSLR-Ära waren diese „kurzen, dicken Tüten“ zwar auch Spezialgerät, aber immerhin verfügbar. Lange Jahre fehlten sie auf dem Markt, bis Sigma eine solche Optik wieder anbot.
Weiterlesen nach der Anzeige
Und das wird jetzt von Laowa gekontert, mit gleichen optischen Daten, aber einer Besonderheit: Nicht nur für die spiegellosen Kameras mit Sonys E-Mount und Nikons Z-Bajonett kommt das Autofokus-Objektiv auf den Markt, sondern auch für Canons DSLR-Bajonett EF. Das Sigma ist nur für L- und E-Mount vorgesehen. Zudem ist das Laowa gegenüber den 3500 Euro des Sigma mit 2300 Euro für E- und Z-Mount oder 2070 Euro für das EF-Bajonett viel günstiger.
Wo da der Haken steckt? Im fehlenden Bildstabilisator. Den hat die Laowa-Optik nicht, also muss man längere Verschlusszeiten einplanen, gerade bei Sport eigentlich das, was man nicht will. Wer aber, bei manchen Veranstaltungen erlaubt, beispielsweise ein Einbeinstativ einsetzen kann, wird das verschmerzen können. Im Fotograben von Konzerten sind Stative übrigens meist verboten, also ist das bei schummerigem Licht und viel Action auf der Bühne wohl nicht das Fach des Laowa. Ab Ende November wird man das mit Seriengeräten selbst ausprobieren können.
Ein helles „Standardzoom“ auch für APS-C
Nicht für alle Einsatzzwecke braucht man hohe Lichtstärke, und so lassen sich die Kamerahersteller oft Zeit damit, für neue Bodies solche Optiken anzubieten. Bei Nikon ist es nun für den Z-Mount endlich auch mit APS-C-Objektiven soweit: Ein 16-50mm f/2.8 VR – also mit Stabi – und ein 35mm f/1.7 sollen Ende Oktober lieferbar sein. Die Preise: 900 beziehungsweise 450 Euro. Also auch hier, obwohl weniger teuer als vergleichbare Vollformat-Objektive, eher etwas für besondere Anwendungen. Es sei denn, man hat sich beim Zoom auf die Kleinbild-äquivalenten 24-75 Millimeter schon so eingeschossen, dass man das nicht mehr missen will. Für viele ist ein solches Objektiv mit f/2.8 das „Immerdrauf“. Dass das kleine Nikkor wetterfest ist, unterstreicht den leicht professionellen Anspruch.
APS-C-Makro, nicht nur für Nahaufnahmen
Ein echter Spezialist ist auch die neue Festbrennweite nicht. Das neue 35-Millimeter, also 52,5 Millimeter im Kleinbild-Maßstab, ist ebenfalls abgedichtet, und mit f/1.7 auch etwas für anspruchsvolle Porträts. Nikon bewirbt es vorwiegend als Makro, was der Abbildungsmaßstab von 1:1,5, also 1:1 im Kleinbild, auch erlaubt. Die Naheinstellgrenze liegt bei 16 Zentimetern, und ohne Stabi ist das Nikkor auch recht leicht.
Weiterlesen nach der Anzeige
50mm mit viel Licht von Viltrox
Den Objektivreigen dieser Woche macht Viltrox komplett, das wieder einmal den Preisbrecher spielt. Deren AF 50mm f/1.4 Pro gibt es vorerst nur für Sonys E-Mount im Vollformat, mit einer Version für Nikon Z ist erfahrungsgemäß zu rechnen. Den Pro-Anspruch des Namens unterstreicht auch hier die Wetterfestigkeit, aber eben nicht in den üblichen Preisregionen der Kamerahersteller: 620 Euro sind gefordert. Bei Sonys G-Master mit gleichen optischen Daten zahlt man leicht das Zweieinhalbfache. Und Nikon hat gleich gar kein f/1.4 im Angebot.
Lesen Sie auch
(nie)
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows













