Künstliche Intelligenz
Top 10: Die besten Fitness-Tracker im Test – Testsieger Amazfit für nur 90 Euro
Whoop 4.0
Whoop 4.0 will als Fitness-Wearable helfen, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit basierend auf wissenschaftlicher Grundlage zu optimieren. Für wen sich das Armband mit integriertem optischen Sensor lohnt, klären wir im Test.
- guter KI-Coach
- integrierte Trainingsdatenbank für Kraftsport
- guter Pulssensor
- teuer
- kein integriertes GPS
- Stressmessung teilweise ungenau
Whoop 4.0 im Test
Whoop 4.0 will als Fitness-Wearable helfen, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit basierend auf wissenschaftlicher Grundlage zu optimieren. Für wen sich das Armband mit integriertem optischen Sensor lohnt, klären wir im Test.
Im Segment der Fitness-Tracker ist das Whoop 4.0 in gleich mehrerlei Hinsicht ein besonderes Produkt. Denn anders als die Geräte von Fitbit, Garmin, Huawei und Co. verzichtet der Hersteller des Whoop-Bands auf ein Display. Gemessene Daten lassen sich dementsprechend nur in der App ablesen. Ferner bekommen Anwender das Whoop 4.0 weitestgehend kostenlos, müssen für die Nutzung aber ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Wir haben uns das Whoop 4.0 mit seiner einzigartigen Funktionsweise genauer angeschaut und klären in unserem Test, für wen sich die Anschaffung des Wearables und das zugehörige Abonnement lohnt.
Design: Wie trägt man Whoop?
Wie bereits erwähnt, verzichtet der Hersteller beim Whoop 4.0 vollständig auf ein Display. Damit möchte das Unternehmen eine seiner Meinung nach unnötige Ablenkung eliminieren und den Fokus auf die reine Datenanalyse legen. Das Gerät besteht dementsprechend aus einem kleinen schwarzen Gehäuse, in dem der Akku und die Sensoren des Trackers eingebaut sind, bestehend aus fünf LEDs mit grünem und infrarotem Licht sowie vier Fotodioden, die Herzfrequenz, Hauttemperatur und Blutsauerstoff messen.
Neben dem eigentlichen Gerät ist im Lieferumfang ein gewebtes Stoffarmband und ein drahtloses Akku-Ladepack enthalten. Das Armband lässt sich flexibel in der Größe anpassen und wird am Gehäuse des Whoop 4.0 eingeklemmt. Mit einem Bügelmechanismus kann man anschließend das Armband am Handgelenk fixieren. Was auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig wirkt, entpuppt sich in der Praxis als durchdachte und bequeme Lösung, die dazu führt, dass man das Whoop 4.0 im Alltag kaum spürt.
Whoop bietet zudem eine Vielzahl an Zubehör an, darunter neben verschiedenen Armbändern aus unterschiedlichen Materialien und Bizepsbändern für das Tragen am Oberarm auch Arm-Sleeves oder Unterwäsche, in der man das Wearable platzieren kann. Dadurch hat man die Möglichkeit, das Whoop 4.0 an verschiedenen Stellen am Körper zu tragen und es weitestgehend unter der eigenen Kleidung verschwinden zu lassen. Für bestimmte Sportarten, bei denen ein Armband am Handgelenk hinderlich oder sogar gefährlich sein kann, ist das definitiv ein Vorteil gegenüber anderen Fitness-Trackern.
Das Whoop 4.0 ist übrigens nach IP68-Standard zertifiziert und übersteht damit ein Eintauchen in zehn Metern Wassertiefe für maximal zwei Stunden. Der Tracker eignet sich dementsprechend auch für den Einsatz bei diversen Wassersportarten.
Einrichtung: Kann man Whoop auch ohne Mitgliedschaft nutzen?
Das Whoop 4.0 funktioniert nur im Rahmen eines Abo-Modells. Die Einrichtung erfolgt ein wenig anders als bei einem herkömmlichen Fitness-Tracker. Möchte man das Whoop 4.0 ausprobieren, erstellt man einen Account bei Whoop und lässt sich das Whoop 4.0 zuschicken. Für Neukunden ist eine 30-tägige kostenlose Testphase inklusive. Sobald der Test abgelaufen ist, wird man in der App aufgefordert, ein Abo abzuschließen, damit man weiter alle Funktionen von Whoop nutzen kann.
Die Einrichtung des Trackers an sich funktioniert aber denkbar einfach. Wir laden die Whoop-App auf unser Smartphone herunter, loggen uns mit unserem Account ein und koppeln das Wearable via Bluetooth über die Geräteeinstellungen mit dem Handy. Nach erfolgreicher Kopplung können wir uns durch ein Tutorial klicken, das uns die wichtigsten Funktionen des Whoop-Bands und der App erklärt.
Aktivität & Training: Was zeichnet Whoop auf?
Obwohl es sich beim Whoop 4.0 um ein Fitnessarmband handelt, gibt es im Vergleich zu klassischen Smartwatches (Bestenliste) und Fitness-Trackern (Bestenliste) einige wesentliche Unterschiede. Das wichtigste Detail vorweg: Das Whoop verzichtet auf ein Display, sodass die Bedienung nur in Verbindung mit dem Smartphone möglich ist. GPS-Features oder ein Schrittzähler fehlen komplett.
Stattdessen misst Whoop die tägliche Belastung, der unser Körper ausgesetzt ist, und bewertet sie auf einer Skala von null bis 21. Um die jeweilige Anstrengung eines Tages zu berechnen, berücksichtigt der Tracker verschiedene biometrische Daten wie Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung und Hauttemperatur. Der gesamte Belastungswert basiert dann sowohl auf körperlicher Aktivität wie Sport oder Arbeit als auch auf Stress und Erholungsmaßnahmen.
Zusätzlich gibt es eine Anzeige für den täglichen Stresslevel, den sogenannten Stress-Monitor. Dieser zeigt an, wie viel Zeit wir mit wie viel Stress verbracht haben. Dabei unterscheidet Whoop zwischen Phasen mit niedrigem, mittlerem und hohem Stress sowie Stress innerhalb und außerhalb von Belastungsaktivitäten sowie beim Schlafen. Diese Werte vergleicht der Tracker mit anderen Tagen und zeigt langfristige Trends auf, von denen wir ableiten können, ob bestimmte Aktivitäten uns besonders viel Stress verursachen. In der Praxis funktionierte das größtenteils zuverlässig und nachvollziehbar. Allerdings kam es in einem Fall zu seltsamen Werten, als die Testerin entspannt auf dem Sofa lag, das Whoop-Band aber einen hohen Stresslevel attestierte.
In Kombination mit dem Stress-Monitor können wir anhand der Logbuch-Funktion prüfen, wie sich bestimmte Verhaltensweisen auf unsere physische und psychische Gesundheit sowie Erholung auswirken. Dazu legen wir in der App eine Auswahl verschiedener Verhaltensweisen fest, etwa „Dehnübungen gemacht“, „genug Wasser getrunken“ oder „Spät arbeiten“. Die Optionen zur Personalisierung des Logbuchs umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten und Gewohnheiten aus den Bereichen Erholung, Ernährung, Gesundheitszustand, Lifestyle, Medikamente, mentale Gesundheit, Schlaf und mehr. Wer regelmäßig die entsprechenden Daten im Logbuch einträgt und eine Gewohnheit variabel ausführt, erhält in der App konkrete Informationen über deren Auswirkungen. Dabei unterscheidet Whoop, in welchem Maß eine Gewohnheit der eigenen Erholung hilft oder schadet. Im Fall unserer Testerin berechnete der Fitness-Tracker, dass die Einnahme von entzündungshemmenden Medikamenten wie Ibuprofen die Erholung um sieben Prozent verschlechtert.
Ob diese Analysen tatsächlich realistische Werte ergeben, lässt sich subjektiv schwer einschätzen. Wer sich die Mühe macht und über mehrere Tage die entsprechenden Daten im Logbuch einträgt, kann aber zumindest gewisse Trends ausmachen und erhält Anregungen, welche Gewohnheiten die physische und psychische Erholung beeinflussen könnten.
Neben den Gesundheitsdaten im Alltag zeichnet Whoop auch konkrete Trainingseinheiten auf. Körperliche Belastung registriert das Armband automatisch, wer aber eine bestimmte Sportart tracken möchte, muss die Aufzeichnung zunächst manuell in der App aktivieren. Hat man ein paar Einheiten derselben Sportart abgeschlossen, erkennt das Armband mit der Zeit aber automatisch, wenn man eine entsprechende Trainingseinheit ausführt. Wir haben die automatische Trainingserkennung mit dem Laufen ausprobiert, was in unserem Fall auch reibungslos funktioniert hat.
Starten wir ein Ausdauertraining, etwa Laufen oder Radfahren, können wir die Strecke aufzeichnen. Allerdings muss dafür die App auf dem Smartphone aktiv sein und Zugriff auf unseren Standort erhalten, weil das Whoop 4.0 nicht über ein eigenes GPS-Modul verfügt. Anhand unserer aktuellen Belastungsdaten empfiehlt uns die App ein spezifisches Belastungsziel, das wir aktivieren oder deaktivieren können. Erreichen wir das Ziel, erhalten wir eine Benachrichtigung in der App. Das Ziel berücksichtigt unsere Trainings- und Erholungsziele, die wir wiederum in der App festlegen können.
Nutzer, die das Whoop 4.0 vorwiegend für Krafttraining verwenden möchten, können sich den Strength-Trainer zunutze machen. Dabei handelt es sich um eine Art Trainingsdatenbank in der App, die vorprogrammierte Workouts unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade beinhaltet. Außerdem können wir mithilfe des Strength-Trainers eigene Trainingseinheiten erstellen und dabei sowohl Übungen als auch Sätze und Wiederholungen definieren. Die App gibt dann an, welche Muskelgruppen wir mit dem jeweiligen Training konkret belastet haben.
Ferner haben wir die Möglichkeit, in der App konkrete Ziele für Training und Fitness festzulegen. Dazu stellt uns Whoop in der App einige Fragen, auf deren Basis wir dann Empfehlungen für unseren Trainingsalltag erhalten. Empfiehlt Whoop uns in der App dann etwa basierend auf unserer aktuellen Erholung eine bestimmte Trainingsbelastung, können wir direkt über die App eine entsprechende Aktivität starten, um das Belastungsziel zu erreichen. Das funktionierte im Test absolut intuitiv und problemlos.
Neben der Belastungsaufzeichnung bietet die Whoop-App noch einen separaten Reiter für die Erholung. Dabei berücksichtigt Whoop verschiedene Werte wie unseren Schlaf, unsere Ruheherzfrequenz und unsere Herzfrequenzvariabilität. Um unseren Erholungswert zu berechnen, vergleicht die App die aktuellen Daten mit früheren Messungen und gibt einen Prozentsatz aus. Je niedriger unser Ruhepuls und je höher unsere Herzfrequenzvariabilität bei guter Schlafleistung ausfallen, desto besser bewertet Whoop unsere Erholung. Die gemessenen Werte für Ruhepuls und HFV wichen in unserem Fall nur minimal von den Daten unseres Kontrollgeräts (Garmin Fenix 7) ab. Entsprechend lassen sich also glaubwürdige Rückschlüsse über den Grad unserer Erholung aus den Analysen der Whoop-App ziehen.
Insgesamt bietet das Whoop 4.0 eine Vielzahl an Möglichkeiten, das eigene Training aufzuzeichnen, allerdings liegt der Fokus des Wearables primär auf der erlittenen Belastung. Daten wie Schritt- und Trittfrequenz, Durchschnittstempo oder VO2 Max sucht man vergebens. Dass man zudem für praktisch jede Aktivität das Smartphone benötigt, weil das Armband über kein eigenes Display verfügt, schränkt den Nutzen des Wearables beim Training ein. Wer auf Daten wie Herzfrequenz oder das Lauftempo angewiesen ist, kommt also um den Einsatz einer zusätzlichen Smartwatch einschlägiger Hersteller nicht herum. Das führt wiederum die Intention von Whoop teilweise ad absurdum, ein ablenkungsfreies Armband anbieten zu wollen.
Schlaf: Was kann Whoop alles messen?
Das Schlaf-Tracking gehört zu den zentralen Funktionen des Whoop 4.0, weil unser Schlaf signifikante Auswirkungen auf unsere Erholung hat. Der Tracker berechnet unsere Schlafaktivität anhand von Daten wie Herzfrequenz, Hauttemperatur, Dauer und den einzelnen Schlafphasen. Die von Whoop in der App aufbereitete Statistik berücksichtigt unsere Zeit im Bett, die Beständigkeit unseres Schlafs (also die Variabilität unserer Schlaf- und Weckzeiten), das Maß an erholsamem Schlaf sowie unser Schlafdefizit. Unsere Schlafleistung gibt an, wie viel wir geschlafen haben im Vergleich mit der benötigten Menge an Schlaf.
Die App erklärt sämtliche Schlafparameter in ausführlichen Informationsboxen. Alle Daten werden zudem in einzelnen Tabellen aufbereitet und vorangegangenen Tagen, Wochen und Monaten gegenübergestellt, sodass wir langfristige Trends ablesen können. Einschlaf- und Aufwachzeitpunkt hat das Whoop 4.0 in unserem Test zuverlässig aufgezeichnet. Die Messungen der Schlafphasen entsprachen unserem subjektiven Empfinden und wichen nur geringfügig von den Daten unseres Kontrollgeräts ab.
Bei Bedarf kann man in der Whoop-App auch eine Weckfunktion aktivieren. Das Whoop 4.0 weckt seinen Nutzer dann entweder zu einer bestimmten Uhrzeit oder auf Wunsch im Rahmen eines Zeitfensters mit der intelligenten Weckfunktion. Das Band vibriert dann, wenn wir uns entsprechend der Messung unserer Schlafphasen gerade besonders nahe am Wachzustand befinden. Um die Vibration zu deaktivieren, müssen wir mit dem Finger auf die Oberseite des Whoop-Bands tippen. Das funktionierte im Test nicht immer zuverlässig.
Features: Welche Funktionen gibt es noch?
Neben den zahlreichen Analyse-Funktionen für Belastung, Erholung und Schlaf verfügt das Whoop 4.0 über einen integrierten K.I.-Bot. Dieser sogenannte Whoop-Coach befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase, funktioniert aber in deutscher Sprache und beantwortet uns Fragen zu unseren Daten. Wir können beispielsweise nach konkreten Trainingsempfehlungen fragen oder um eine Einschätzung unserer Schlafdaten bitten. Dabei gilt: Je mehr Daten das Whoop-Band bereits über uns gesammelt hat, desto genauer und umfangreicher fallen die Antworten des Bots aus. In unserem Fall hat die K.I. durchaus nachvollziehbare Antworten auf unsere Fragen gegeben. Die Antwortzeit blieb mit wenigen Sekunden dabei jederzeit im annehmbaren Rahmen.
Für Frauen bietet das Whoop 4.0 übrigens noch die Möglichkeit, den eigenen Zyklus aufzuzeichnen. Dabei kann man Symptome wie einen aufgeblähten Bauch oder konkrete Schmerzen über das Logbuch notieren. Tragen wir den Beginn der Periode ein, informiert uns die App über die aktuelle Zyklusphase und berät uns zur Trainingsintensität. Außerdem macht Whoop konkrete Angaben zur Schlafeffizienz, abhängig von unseren Zyklusdaten. Die Empfehlungen in der App sind hilfreich für Frauen, die zyklusbasiert trainieren möchten. Leider verzichtet Whoop auf eine Option, mit deren Hilfe wir unsere Körpertemperatur und weitere Zyklusdaten notieren können. Für Methoden wie NFP ist das Zyklustracking von Whoop daher nicht geeignet.
Akku: Wie lange läuft das Whoop 4.0?
Whoop gibt die Akkulaufzeit des Whoop 4.0 mit rund fünf Tagen an. Diesen Wert konnten wir in unserem Test bestätigen: Nach drei Trainingseinheiten in fünf Tagen zu je etwa anderthalb Stunden war die Ladung des Akkus nach knapp fünf Tagen erschöpft. Der Hersteller liefert den Tracker aber mit einem kabellosen Akku-Pack aus, das ebenfalls wasserdicht ist. Dadurch kann man die Laufzeit des Wearables deutlich verlängern, ohne es ablegen zu müssen. Das Akku-Pack wird einfach über das Whoop-Band geschoben und lädt den Akku dann unterwegs wieder auf. Um das Akku-Pack selbst aufzuladen, ist im Lieferumfang ein USB-C-Ladekabel enthalten. Wer möchte, kann außerdem zusätzliche Akku-Packs im Online-Shop von Whoop zum Preis von 49 Euro (genauer gesagt 59 Euro für variable Farben) erwerben.
Preis: Wie viel kostet Whoop 4.0?
Anders als die meisten anderen Anbieter am Markt für Wearables verfolgt Whoop ein Preismodell, das nicht auf dem Modell „Buy to Use“ basiert. Anstatt also einmalig mehrere hundert Euro für das Whoop 4.0 zu investieren, müssen Nutzer ein Abonnement abschließen. Darin enthalten sind das Whoop 4.0 als Neugerät oder generalüberholtes Gebrauchtmodell inklusive Superknit-Armband und Akkupack. Neukunden können den Tracker für 30 Tage kostenlos testen. Am Ende der Testphase muss man dann ein kostenpflichtiges Abo abschließen, andernfalls wird das Whoop 4.0 nutzlos.
Für das Abonnement bietet Whoop verschiedene Bezahlpläne an. Ein Monatsabo kostet 30 Euro, allerdings liegt die Mindestlaufzeit bei 12 Monaten. Nach Ablauf der 12 Monate ist das Abo jeweils monatlich kündbar. Alternativ können wir auch direkt ein Jahresabo abschließen und auf einen Schlag 264 Euro zahlen. Die monatlichen Kosten belaufen sich dann auf 22 Euro. Die teuerste Version ist Whoop Pro. Hier zahlen wir einmalig 408 Euro (34 Euro pro Monat), erhalten dafür aber 20 Prozent Rabatt auf alle Artikel im Shop sowie einen Gratisartikel alle drei Monate.
Fazit: Für wen lohnt sich das Whoop?
Der Hersteller hat mit dem Whoop 4.0 eine klare Zielgruppe vor Augen, nämlich die der Daten-Nerds. Wer am liebsten jedes noch so kleine Detail tracken und den Körper minutiös überwachen möchte, kommt mit dem Whoop 4.0 definitiv auf seine Kosten. Der Umfang der Datenanalysen ist immens und erlaubt tiefgreifende Einblicke in die eigenen Gewohnheiten.
Am Ende muss sich Whoop aber die Frage gefallen lassen, wer dieses Wearable wirklich benötigt. Zwar bewirbt der Hersteller explizit damit, dass der Tracker ein ablenkungsfreies Training ermöglicht, aber diese Prämisse läuft ins Leere, wenn wir für viele Features eben zum Smartphone greifen oder auf andere, zusätzliche Tracker und Smartwatches ausweichen müssen.
Ja, das, was das Whoop 4.0 machen soll und will, macht es gut. Aber ob man dafür wirklich 22 Euro oder mehr im Monat zahlen muss, lässt sich nur sehr individuell beantworten. Denn alle Funktionen und Analysen, die Whoop bietet, liefern auch die Mitbewerber am Markt für smarte Wearables und Fitness-Tracker. Eine Garmin Fenix 7 zeichnet genauso den Schlaf, die Herzfrequenz und die Belastung auf wie das Whoop 4.0 und hat zudem noch viele weitere nützliche Features zu bieten, dank derer man wirklich auf ein Smartphone verzichten kann.
Möchte man zusätzlich noch Gewohnheiten tracken, die sich möglicherweise auf die eigene Erholung auswirken, kann man das auch ohne Whoop tun – nämlich ganz altmodisch mit Stift und Papier oder mit einer kostenlosen Smartphone-App wie Habitnow oder Daylio. Das Whoop 4.0 ist also letztlich nur für diejenigen Nutzer interessant, die typische Trackingfeatures für Schlaf, Belastung und Erholung nicht mit anderen Maßnahmen aufzeichnen können oder wollen.
Künstliche Intelligenz
Günstiger als am Black Friday – Top-Angebote kurz vor Weihnachten
Auch nach der Black Week sind viele Produkte noch immer zu Tiefstpreisen im Angebot. Wir zeigen, was sich jetzt noch lohnt.
Während der Black Week gab es viele Produkte zu Tiefstpreisen. Obwohl die meisten Angebote abgelaufen sind, gibt es noch immer Top-Produkte zum Bestpreis. Manche sind sogar günstiger als während der Black Week.
Wir prüfen die Angebote von Amazon und anderen Händlern sowie von chinesischen Versendern wie Aliexpress & Co. Dabei verlassen wir uns weder auf Streichpreise noch auf angeblich horrende Nachlässe, sondern prüfen bei allen Deals im Preisvergleich die realistischen Straßenpreise der letzten Monate. So finden wir Produkte, die es noch nie günstiger gab („Tiefstpreise“) sowie echte Schnäppchen. Da wir viele dieser Geräte auch selbst getestet haben, lassen wir schlechte Produkte gleich ganz weg.
Viele Angebote bei Amazon sind nur für Prime-Kunden verfügbar. Ein Prime-Probe-Abo gibt es für 30 Tage kostenlos. Danach beträgt die monatliche Gebühr 9 Uhr. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden.
Die besten Angebote
Top-Produkte von Markenherstellern zu Tiefstpreisen und absolute No-Brainer: Diese Angebote muss man kennen.
Mähroboter
Saugroboter
- Narwal Flow, Saugroboter mit Wischfunktion mit 22.000 Pa, zum Tiefstpreis für 799 Euro statt 899 Euro (-11 %)
- Roborock Qrevo Edge 5V1, Saug-/Wischroboter inkl. Absaug-/Reinigungsstation mit 18.500 Pa, zum Tiefstpreis für 449 Euro statt 499 Euro (-10 %)
- Roborock Qrevo Curv S5X, Saug-/Wischroboter inkl. Absaug-/Reinigungsstation mit 17.000 Pa zum Tiefstpreis für 500 Euro statt 640 Euro (-22 %)
- Dreame Mova Z60 Ultra mit 28.000 Pa zum Tiefstpreis für 840 Euro statt 899 Euro (-7 %; bei Ebay mit Code: SANTA) → Testbericht
- Roborock Saros 10R mit 20.000 Pa, ausfahrbaren Wischmopps und Reinigungsstation für 899 Euro statt 1039 Euro (-13 %) → Testsieger
Akkusauger & Saugwischer
- Dreame H15 Pro Saugwischer in Schwarz, 5000 mAh Akku, 400 W, Roboterarm, dreifache Kantenabdeckung, 21.000 Pa Saugleistung, 0-Tangle, 100 °C Bürstenwäsche, 5 min 90 °C Trocknung, 180° Lie-Flat für 349 Euro statt 499 Euro (-30 %)
- Mova X4 Pro Saugwischer 20.000 Pa, Heißwasser-Wischfunktion, Tangle-Free, Selbstreinigung bei 100 °C, Push-In-Basisstation, LED-Bürstenkopf, Doppelkante, intelligente Saugkraftregelung für 329 Euro statt 474 Euro (-31 %)
- Mova M10 Saugwischer, Flach 180°, 90° Drehbar, 18.000 Pa Saugkraft, 0,9 kg Gewicht, 75 °C Bürstenreinigung, 5 Min. Heißlufttrocknung, Verhedderungsfrei, Bürste mit Doppelichtungsrotation für 199 Euro statt 259 Euro (-23 %)
- Roborock F25 LT Saugwischer für 250 Euro statt 300 Euro (-17 %)
- Roborock F25 BX Saugwischer für 248 Euro statt 299 Euro (-17 %)
- Dreame H12 Pro Saugwischer, 16.000 Pa Saugkraft, Selbstreinigung, 1,6 l Fassungsvermögen (900ml Frischwasser, 700ml Schmutzwasser) für 169 Euro statt 179 Euro (-6 %, Code DREAME25-01A an Kasse eingeben)
Balkonkraftwerke und Speicher
- Anker Solarbank 3 (inklusive Zusatzakku) mit 5,38 kWh zum neuen Tiefstpreis für 1339 Euro (249 Euro pro kWh); Hinweis: Das Angebot stammt von Ebay-Händler Solarmars, der ein autorisierter Anker-Partner ist.
- Ecoflow Stream Ultra X mit 3,84 kWh für 995 Euro (259 Euro pro kWh)
- Marstek Jupiter C Plus* (inklusive Zusatzakku) mit 5,12 kWh zum Tiefstpreis für 844 Euro (165 Euro pro kWh, günstiger als zum Black Friday)
- Zendure Solarflow 800 Pro mit 3,84 kWh für 879 Euro (224 Euro pro kWh) oder einzeln für Zendure Solarflow 800 Pro mit 1,92 kWh zum Tiefstpreis für 413 Euro und Zusatzakku AB2000X für 389 Euro, mit einem Gesamtpreis für 3,84 kWh von 802 Euro (209 Euro pro kWh, günstiger als zum Black Friday). Zendure bietet eine lokale Integration für Home Assistant.
*Die Marstek-Speicher weisen eine Bluetooth-Sicherheitslücke auf, mit der Fremde in Bluetooth-Reichweite auf den Speicher zugreifen können. Sie kann aktuell nur geschlossen werden, wenn das eigene Smartphone eine dauerhafte Verbindung zum Marstek-Speicher hat. Marstek will die Lücke bis Ende des Monats über ein App-Update schließen.
Balkonkraftwerke mit Speicher:
- Zendure Solarflow 800 Plus mit zwei 440-Watt-Panel und 1,92 kWh für 479 Euro statt 679 Euro (-29 %, Rabatt zeigt sich erst an der Kasse)
- Zendure Solarflow 800 Pro mit vier 440-Watt-Panel und 1,92 kWh für 700 Euro statt 799 Euro (-12 %, Rabatt zeigt sich erst an der Kasse)
- Solarmars Balkonkraftwerk mit vier bifazialen 500-Watt-Modulen (2000 Watt), Anker Solarbank 3 mit 2,69 kWh und integriertem Wechselrichter für 1230 Euro (50 Euro günstiger als am Black Friday, inklusive Smart Meter, Versand, 3-Meter-Schuko-Anschlusskabel, Halterungen und vier 3 m lange MC4-Kabel) → Testbericht
- Solago-Balkonkraftwerk 4 × 500 Watt-Panel (2000 Watt) und Anker Solarbank 3 mit 2,69 kWh, Flachdachhalterung für 1299 Euro (inklusive Versand, Smart Meter und vier Paar MC4-Kabel mit 5 Meter Länge) → Testbericht
- Powerness Growatt Nexa 2000, Balkonkraftwerk mit 2000 Watt Solarleistung und 2,0-kWh-Speicher für 669 Euro bei Abholung und 839 Euro mit Versand (ohne Halterung und ohne MC4-Verlängerungskabel)
- Powerness Ecoflow Stream Ultra X, Balkonkraftwerk mit 2000 Watt Solarleistung und Ecoflow-Speicher mit 3,84 kWh, Smart Meter für 1199 Euro (Abholung) und 1299 (Versand)
Powerstations
VPN
- NordVPN 12 Monate für 30 Euro (2,5 Euro pro Monat)
- CyberGhost bietet mit über 11.000 Servern ein riesengroßes Netzwerk und ist aktuell für 2,19 Euro pro Monat zu haben. Vier Monate gibt’s extra obendrauf (-83 %).
- Surfshark erlaubt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig zum Angebotspreis von 1,99 Euro pro Monat. Drei Monate gibt’s extra dazu (-87 %).
Preishinweis: Unsere Preisangaben enthalten 19 % Mehrwertsteuer. Viele VPN-Anbieter werben mit Nettopreisen, weshalb deren Angaben abweichen können.
Alle VPN-Angebote gelten nur für die 2-Jahres-Abonnements. Alle VPN-Tipps gibt’s im VPN-Anbieter-Vergleich von heise download.
Smarte Beleuchtung von Govee
Mit der Uplighter Stehleuchte präsentiert Govee eine außergewöhnliche Stehlampe. Sie zaubert tolle Animationen an die Decke, kann aber dank einer zweiten Leuchte auch als einfache Leselampe genutzt werden. Aktuell ist sie zum neuen Tiefstpreis für 133 Euro statt 190 Euro (- 30 %) erhältlich.
Mit der Uplighter Stehleuchte präsentiert Govee eine außergewöhnliche Stehlampe. Sie zaubert tolle Animationen an die Decke, kann aber dank einer zweiten Leuchte auch als einfache Leselampe genutzt werden. Aktuell ist sie zum neuen Tiefstpreis für 133 Euro statt 190 Euro (- 30 %) erhältlich.
Govee Floor Lamp Pro: Einwandfreie Farbübergänge, LEDs nicht zu sehen und beleuchteter Sockel mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher
Govee Outdoor RGBIC-Wandleuchte Smart LED Downlight (H7075), 2er-Set für 100 Euro statt 170 Euro (-41 %)
Smarte Beleuchtung
- Govee Uplighter Stehleuchte (siehe Bildergalerie), Matter, klasse Deckenbeleuchtung mit Animationen zum neuen Tiefstpreis für 133 Euro statt 180 Euro (-30 %, bisheriger Tiefstpreis 139 Euro)
- Govee Curtain Lights, 520 LEDs, 2 m × 1,5 m (siehe Bildergalerie), zum neuen Tiefstpreis für 65 Euro statt 130 Euro (-50 %)
- Govee Outdoor Wandleuchte, 2er-Set (siehe Bildergalerie) zum Tiefstpreis für 100 Euro statt 170 Euro
- Govee Outdoor Neon Rope Light, LED-Streifen 10m (siehe Bildergalerie) für 120 Euro statt 199 Euro (-40 %)
- Govee Floor Lamp Pro mit Lautsprecher (siehe Bildergalerie) für 150 Euro statt 180 Euro (-15 %) → Testsieger
- Govee Permanent Outdoor LED-Leuchten, 15 Meter (siehe Bildergalerie), zum Tiefstpreis für 110 Euro statt 180 Euro (-39 %)
- Govee Pendelleuchte, RGBIC, Weißlicht, drei Lichtringe, Matter, für 135 Euro statt 170 Euro (-26 %)
- Govee Deckenleuchte RGBIC (H60A1), 24 Watt, 2400 lm, Ø30cm, zum Tiefstpreis für 40 Euro statt 49 Euro (-18 %)
- Govee Deckenleuchte RGBIC (H60A6), 48,5 Watt, 4300 lm, Ø38cm, zum Tiefstpreis für 75 Euro statt 100 Euro (-25 %)
- Philips Hue Indoor LED-Strip für 39 Euro statt zuletzt 52 Euro (-15 %)
- Philips Hue Lightstrip Plus für 50 Euro statt zuletzt 68 Euro (-26 %)
- Govee Neon Rope Light 2 (H61D53) mit LED-Streifen, Matter und 5 Meter zum Tiefstpreis für 60 Euro statt 80 Euro (-19 %)
- Govee Strip Light 2 Pro mit LED-Streifen, Matter und 5 Meter zum Tiefstpreis für 70 Euro statt 85 Euro (-18 %)
- Govee Tischlampe 2 Pro x Sound von JBL zum neuen Tiefstpreis für 119 Euro statt zuletzt 145 Euro (-18 %, günstiger als zum Black Friday)
Smarte Türschlösser und -öffner
Smarte Thermostate für Heizkörper und Fußbodenheizungen
- Meross MTS215B für 60 Euro statt 80 Euro, smartes WLAN-Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter (-25 %) →Testbericht
- Tado X, smartes Thermostat für Fußbodenheizungen zum Tiefstpreis für 63 Euro statt 78 Euro (-20 %)
- Bosch Raumthermostat II 230 Volt für 70 Euro statt 88 Euro (-20 %, bisheriger Tiefstpreis 72 Euro), smartes Thermostat für Fußbodenheizungen
- TP-Link Kasa KE100 Kit für 33 Euro statt 50 Euro (-33 %, bisheriger Tiefstpreis 43 Euro) smartes Heizkörperthermostat mit Hub →Preis-Leistungs-Sieger
- Fritzdect 302, smartes Heizkörperthermostat für Fritzbox-Nutzer, für rund 47 Euro statt zuletzt 52 Euro (-10 %) →Testbericht
- Tado X smartes Heizkörperthermostat für 55 Euro statt 70 Euro (-21 %, bisheriger Tiefstpreis 52 Euro) →Technologie-Sieger
- Tado X, 3er-Set mit Bridge für 140 Euro statt 222 Euro (-61 %) bei Tink Plus (Anmeldung erforderlich)
- Homematic IP, Starter-Set mit Access Point und 5x Homematic IP Basic für 140 Euro statt 180 Euro (-22 %)
Smart Home
- Sonoff Zigbee Gateway ZBDongle-E, kompatibel mit Home Assistant, für rund 19 Euro statt 23,5 Euro (-15 %) →Testbericht
- Home Assistant Connect ZWA-2, USB-Dongle von Nabu Casa mit Z-Wave für 63 Euro (neues Produkt)
- Home Assistant Connect ZBT-2, USB-Dongle Casa mit Zigbee/Thread für 49 Euro (neues Produkt)
- X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, TÜV-Zertifiziert, Funkrauchmelder mit WLAN im 6er-Set für 91 Euro (-12 %, günstiger als am Black Friday)
- Shelly Plus Smoke, smarter WLAN-Rauchmelder für rund 32 Euro (-20 %)
- Meross Rauchmelder 3er-Set, kompatibel zu Matter, zum neuen Tiefstpreis für 80 Euro (-6 %)
- Aqara Rauchmelder mit Zigbee zum Tiefstpreis für 34 Euro statt 45 Euro (-24 %)
- Switchbot Thermo-Hygrometer mit langer Batterielaufzeit für 13 Euro (-30 %) und im 3er-Set für 26 Euro →Testbericht
- Switchbot 1-Kanal-Unterputzschalter 16A für rund 9 Euro (-25 %)
- Switchbot Plug Mini smarte Steckdose mit Energiemessung, kompatibel zu Matter, für 12 Euro statt 14 Euro (-14 %)
Soundbars
Fernseher & Streaming
- Streaming-Bundle: Netflix (Werbung), Disney Plus (Werbung), RTL+ und Magenta TV für 7 Euro statt 28 Euro (Einzelpreise)
- Amazon Music aktuell drei Monate kostenloses Abo inklusive Dolby Atmos statt einen Monat, danach 10,99 Euro
- Philips 32PHS6000, 32 Zoll HD-LED-Smart-TV zum Tiefstpreis für 119 Euro statt 144 Euro (-17 %)
- Xiaomi TV F 65, 65 Zoll 4K UHD zum Tiefstpreis für 339 Euro statt 389 Euro (-
Software
Bürostühle & höehenverstellbare Tische
Laptops
- Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9 in Luna Grey mit 14,5 Zoll, 2880 x 1800 Pixel, 120 Hz, OLED, AMD Ryzen AI 9 365, 32/1000 GB, USB4, USB-C 3.1, HDMI 2.1 und Wi-Fi 6E für 1154 Euro statt 1444 Euro (-20 %)
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX10) in Eclipse Black mit 16 Zoll, 2560 x 1600 Pixel, 240 Hz, OLED, Intel Core i9-14900HX, 16/1000 GB, Nvidia GeForce RTX 5070, 2x USB-C 3.1, HDMI, LAN und Wi-Fi 6E mit einem Rucksack für 1499 Euro statt 1699 Euro (-12 %
Mini-PCs
- Ninkear L12 Pro mit Intel i9-12900HK, 32/1000 GB, USB-C, HDMI 2.0, Displayport 1.4, 2x LAN und Wi-Fi 6E für 595 Euro statt 800 Euro (-15 %; Coupon anwählen, günstiger als am Black Friday)
- Koosmile KT-M9 mit integriertem Display, Intel Core i9-12900HK, 32/1000 GB, HDMI 2.1, Displayport 1.4a, USB-C und Wi-Fi 6 für 539 Euro statt 639 Euro (-16 %, günstiger als am Black Friday)
- GMKTec Evo-T1 mit Intel Ultra 9 285H, 64/2000 GB, HDMI 2.1, Displayport 1.4, 2x USB4 und Wi-Fi 6 für 1160 Euro statt 1420 Euro (-18 %)
- GMKtec EVO-X2 mit AMD Ryzen AI Max+ 395, 64/1000 GB, HDMI 2.1, Displayport 1.4, 2x USB4 und Wi-Fi 7 für 1499 Euro statt 2460 Euro (-39 %)
- Minisforum MS-A1 als Barebone ohne CPU, RAM und SSD, mit 2x 2,5G-LAN, 4x PCIe-SSD-Steckplatz, USB4, Oculink, HDMI 2.1 und Displayport 2.0 für 250 Euro (Tiefstpreis)
PC-Monitore
- Asus ROG Strix XG27AQDMGR, 27-Zoll-OLED mit 2560 x 1440 Pixel zum Tiefstpreis für rund 501 Euro statt 594 Euro (-16 %)
- LG 27G610A-B, 27-Zoll-IPS mit 2560 x 1440 Pixel zum Tiefstpreis für 169 Euro statt 219 Euro (-23 %)
- Asus ROG Swift OLED PG32UCDP, 32-Zoll-OLED mit 3840 x 2160 Pixel zum Tiefstpreis für 932 Euro statt 1004 Euro (-7 %)
PC: Komponenten und Zubehör
WLAN-Router, Repeater & Co.
- Fritzfon X6 DECT-Telefon für 69 Euro statt 79 Euro (-12 %)
- MSI Roamii BE Lite Mesh-System mit Wi-Fi 7 als 1-Pack für 90 Euro statt 101 Euro (-10 %)
Smartphones
- Motorola Edge 60 Neo mit 12/256 GB in Pantone Shadow mit Code EDGE60NEODE zum Tiefstpreis für 365 Euro statt 400 Euro (-13 %)
- Xiaomi 15T Pro mit 12/256 GB in Schwarz zum Tiefstpreis für 551 Euro statt 599 Euro (-8 %)
- Google Pixel 9a mit 8/256 GB in Schwarz zum Tiefstpreis für 449 Euro statt 499 Euro (-10 %)
Powerbank & Ladegeräte
- Ecoflow Rapid Magsafe-Powerbank mit 5000 mAh, 30 W, Qi2 (15 W), integriertem USB-C-Kabel und USB-C-Port in Schwarz für 29 Euro statt 45 Euro (-36 %, günstiger als am Black Friday) → Testbericht
- Baseus EnerCore Powerbank mit 10000 mAh, 45W, einziehbarem USB-C-Kabel und Display für 26 Euro statt 36 Euro (-17 %, Coupon anwählen, günstiger als am Black Friday)
- Ugreen Nexode Pro 160W Ladegerät mit 4 Ports, 3x USB-C (1 Port: 140 W; insgesamt max. 160 W), 1x USB-A (22,5 W), Quick Charge 4+, USB-PD 3.1, Samsung AFC, SCP und PPS (3,3 bis 21 V bei 5 A) bei Ebay für 45 Euro statt 58 Euro (-22 %, günstiger als am Black Friday)
- Baseus Enercore 67W USB-C-Ladegerät mit ausziehbarem Kabel und 2 Ports (2x USB-C) für 24 Euro statt 28 Euro (-14 %, günstiger als am Black Friday)
- Ugreen Nexode Powerbank 145W in Grau mit 25.000 mAh, 1x USB-A (22,5 W), 2x USB-C (65 W) und USB-PD 3.1 für 45 Euro statt 55 Euro (-18 %) → Testbericht
- Powerbank von EnergyQC mit 35 W, 20.000mAh, integriertem Kabel und LED-Display für 20 Euro statt 24 Euro (-17 %)
Android-Tablets
- Tabwee T60 Pro Tablet mit 13,4 Zoll und Widevine L1 inkl. Tastatur und Stift für 180 Euro (Code: TU6CZ47W; gültig bis 9.12) statt 400 Euro (-55 %)
Smartwatches & Wearables
- Huawei Watch D2 mit 1,82“ AMOLED-Display, EKG, mit Code HEISSE30 zum Tiefstpreis für 240 Euro statt 310 Euro (-23 %)
- Google Pixel Watch 4 zum Tiefstpreis für 359 Euro statt 438 Euro (-18 Prozent)
Kopfhörer
- Bwers & Wilkins Px7 S3 Over-Ear-Kopfhörer für 299 Euro statt 340 Euro (-12 %, günstiger als am Black Friday)
- Apple Air Pods 4 zum Tiefstpreis für 111 Euro statt zuletzt 129 Euro (-14 %)
- Baseus EP10 NC für 20 Euro statt 40 Euro (-50 %)
- Soundpeats Air 5 Pro mit aptX Lossles, LDAC und Noise Cancelling zum neuen Tiefstpreis für 104 Euro statt 140 Euro (-26 %)
Beamer
Heißluftfritteusen
- Tefal EY901N Dual Easy Fry in Schwarz/Grau mit 2700 W, 8,3 l Fassungsvermögen und Temperaturbereich 40 bis 200 Grad bei Ebay für 99 Euro statt 115 Euro (-14 %)
- Philips HD9285/90 Connected XXL Airfryer (5000 Series) mit 2000 W, 7,2 l Fassungsvermögen und Temperaturbereich 40 bis 200 Grad für 99 Euro statt 120 Euro (-17 %)
- Philips NA350/00 Dual Basket (3000 Series) mit 2750 W, 9 l Fassungsvermögen und Temperaturbereich 40 bis 200 Grad für 100 Euro statt 138 Euro (-28 %)
- Cosori Dual Basket (CAF-R903-AEU) mit 1750 W, 8,5 l Fassungsvermögen und Temperaturbereich 35 bis 230 Grad für 119 Euro statt 140 Euro (-18 %)
- Ninja DZ400EUSTGD Dual Zone in Grau/Gold mit 2470 W, 9,5 l Fassungsvermögen und Temperaturbereich 40 bis 240 Grad für 180 Euro statt 200 Euro (-10 %)
- Cosori Dual Blaze Twin Fry 10l in Schwarz/Silber mit 2800 W, 10 l Fassungsvermögen und Temperaturbereich 35 bis 240 Grad für 180 Euro statt 195 Euro (-8 %)
Luftreiniger, -befeuchter & Diffusoren
- Philips AC4221, neuester Philips-Luftreiniger mit CADR 600 m³/h zum Tiefstpreis für 350 Euro (-10 %, bisheriger Tiefstpreis 350 Euro) →Testbericht
Überwachungskameras und Videotürklingel
E-Scooter
E-Bike
Häufige Stolperfallen und typische Marketing-Tricks bei Rabatten
Wer selbst stöbert, sollte die realistischen Straßenpreise immer im Preisvergleich checken. Die von den Händlern angegebenen Streichpreise und die daraus ergebenen hohen Rabatte von teilweise über 50 Prozent beziehen sich häufig auf die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller und haben mit dem realen Straßenpreis nichts zu tun.
Manche Hersteller und Händler heben auch die Preise kurz vor dem Event an. Damit ergeben sich zwar tatsächlich hohe Nachlässe „im Vergleich zu gestern“, aber auch diese Angaben sind unrealistisch – wenn auch nicht gelogen.
Wer bei einem chinesischen Händler kauft, bezahlt in vielen Fällen weniger. Allerdings besteht im Gewährleistungs- oder Garantiefall die Gefahr eines schlechteren Service. Außerdem ist das Einfordern von Verbraucherrechten (Rückgabe, Gewährleistung) mit Hürden versehen oder nicht möglich. Wir verlinken hier Händler, mit denen wir im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht haben.
Exklusiv-Vorteile sichern mit Gutscheinen
Nicht immer sind zusätzliche Gutscheincodes im Preisvergleich aufgelistet. Wir ergänzen jede Schnäppchenmeldung um zusätzliche Gutscheincodes – wo verfügbar – und betrachten den Endpreis in unserer Bewertung. Wir probieren alle Voucher zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aus. Es kann aber sein, dass sie später vergriffen sind. In dem Fall freuen wir uns über einen Hinweis an redaktion@techstage.de.
Fazit
Die Angebote zeigen, dass man auch nach dem Black Friday noch ein Schnäppchen machen kann. Einige Produkte sind sogar günstiger. Die Auswahl ist allerdings nicht mehr so groß.
Künstliche Intelligenz
Star Trek: Wie Diplomatie mit künstlichen Intelligenzen funktioniert
Die Serie „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ ist erstmals von 1987 bis 1994 über die Bildschirme geflimmert. In 178 Folgen erkundet die Crew um Captain Jean-Luc Picard den Weltraum und dessen unendliche Weiten. Mehr als einmal muss sie sich dabei auch mit künstlichen Intelligenzen auseinandersetzen, die an Bord der Enterprise ihr Unwesen treiben.
- Anhand von ausgebüxten Naniten, mikroskopisch kleinen Robotern, diskutiert Star Trek die Frage, wie Menschen und Roboter miteinander koexistieren können, insbesondere wenn verschiedene Interessen aufeinanderprallen.
- Wann ist eine Maschine mehr als ihre Teile und wann wird künstliches Leben schützenswert? Damit befassen sich die Serienmacher in einer Folge rund um die Exocomps – Reparaturroboter, die eines Tages Anzeichen eines Selbsterhaltungstriebs entwickeln.
- In einer anderen Episode hat ein Hologramm scheinbar ein Bewusstsein entwickelt, doch sein Wunsch nach Freiheit lässt sich mit der vorhandenen Technik nicht erfüllen. Wie geht man mit einer Technologie um, die über einen hinauswächst?
Wir schauen uns anhand von drei Episoden an, wie die Crew mit Naniten, Exocomps und Hologrammen umgeht – und wie der Android Data eine Verbindung zwischen Mensch und Maschine herstellt.
Star Treks „Die Macht der Naniten“
In der Episode „Die Macht der Naniten“ (Staffel 3, Folge 1, im Original: „Evolution“) kommt es auf der Enterprise immer wieder zu technischen Ausfällen. Auch wenn der Bordcomputer zunächst keine Fehlfunktion erkennt, scheint das gesamte System außer Kontrolle geraten zu sein – oder wie Chefingenieur Geordi La Forge es formuliert: Es wirkt, als wäre jemand in das System hineingestiegen, um es zu zerstören, denn nicht nur die Programme sind betroffen, sondern auch die Hardware.
Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Star Trek: Wie Diplomatie mit künstlichen Intelligenzen funktioniert“.
Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.
Künstliche Intelligenz
Kleiner E-Book-Reader nimmt Smartphones huckepack
Der chinesische Hersteller Xteink verkauft einen ungewöhnlich kleinen E-Book-Reader. Die Idee hinter dem X4: Er ist kompakter als moderne Smartphones, sodass er an deren Rückseite passt. Mithilfe von Magneten hält er an iPhones oder aktuellen Pixel-Modellen von Google.
Weiterlesen nach der Anzeige
Der Xteink X4 soll sich so primär unterwegs leichter verstauen lassen. Er funktioniert jedoch stets als eigenständiges Gerät, braucht also keine Verbindung zum Smartphone. Für Modelle ohne rückseitige Magnete bietet der Hersteller anklebbare Magnetstreifen an.
Kompakt mit 4,3-Zoll-Bildschirm
Der E-Book-Reader verwendet ein 4,3 Zoll großes E-Ink-Display, das ausschließlich Schwarz und Weiß darstellen kann. 800 × 480 Pixel ergeben eine Pixeldichte von 220 ppi.
Das Gerät ist 114 mm hoch, 69 mm breit und 5,9 mm tief. Damit überragt es bei einem aktuellen iPhone ohne Hülle den Kamerabuckel etwas. Das Gewicht liegt bei 74 Gramm.
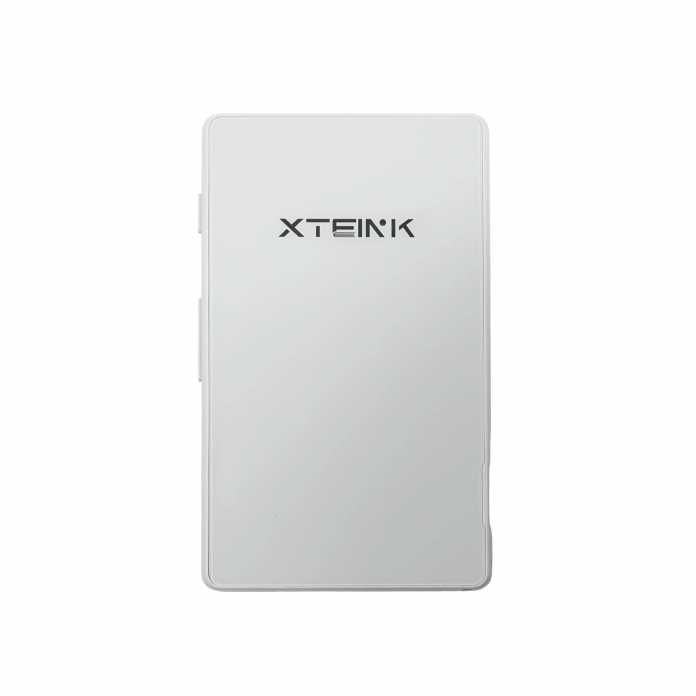
Den Xteink X4 gibt es auch in einem hellen Gehäuse.
(Bild: Xteink)
Die Ausstattung ist simpel: Das Display beherrscht kein Touch und hat keine Hintergrundbeleuchtung. Die Bedienung erfolgt über Tasten. Im Inneren sitzt ein ESP32-Controller mit 128 MByte RAM. E-Books liegen auf einer microSD-Speicherkarte – eine mit 32 GByte liegt bei.
Xteink installiert ein eigenes Betriebssystem vor, ohne Unterstützung von Drittanbieter-Apps. Eine deutsche Lokalisierung gibt es nicht, aber englische Systemsprache. Der E-Book-Reader kann EPUB- und TXT-Dateien öffnen.
Weiterlesen nach der Anzeige
Der Akku fasst 650 mAh und soll bis zu 14 Tage halten, bei einer täglichen Lesezeit von einer bis drei Stunden. Die Aufladung erfolgt per USB-C. Für kabellosen Datenaustausch kann sich der E-Book-Reader per 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth mit anderen Geräten verbinden.
Nicht vor Weihnachten da
Der Xteink X4 kostet 69 US-Dollar plus 8 US-Dollar Versand, umgerechnet rund 66 Euro. Hinzu kommt Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent für den Versand nach Deutschland, was knapp 80 Euro ergibt. Die Auslieferung soll zum 24. Dezember beginnen. Aktuell gibt es noch einen 10-Prozent-Gutschein. Alternativ ist der E-Book-Reader über Aliexpress vorbestellbar.
(mma)
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet
-

 Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten
Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle
-
Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten
Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac
-

 Social Mediavor 3 Monaten
Social Mediavor 3 MonatenSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?












