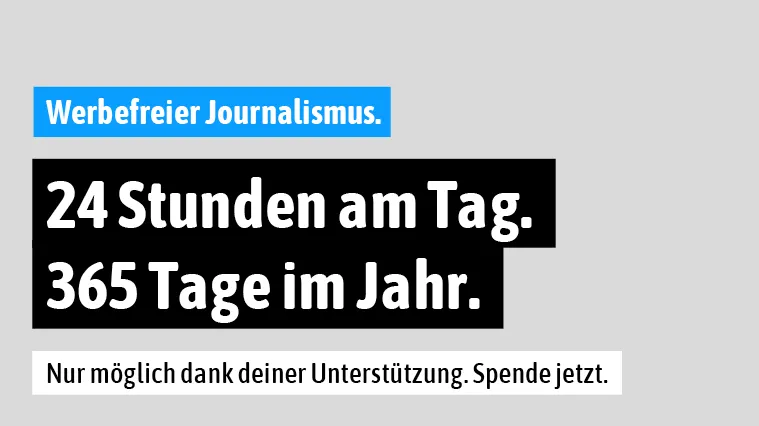500 Milliarden Euro sollen die Infrastruktur in Deutschland aufmöbeln. Das ist die Hoffnung bei einem Sondervermögen, das der Bundestag noch nach den Wahlen, aber vor Konstituierung der neuen schwarz-roten Regierung beschloss. Er einigte sich damit auf einen Weg, neue Schulden zu machen, ohne die geltende Schuldenbremse grundsätzlich abzuschaffen.
Doch mit dem Ja zu den Milliardeninvestitionen hat die Arbeit erst begonnen. Nun konkretisieren sich die Pläne dazu, wie das Geld genau verteilt werden soll, wofür es ausgegeben werden darf und was dies für Länder und Kommunen bedeutet. Und mit der Konkretisierung beginnen Streitpunkte und Begehrlichkeiten klarer zu werden.
Wir geben einen Überblick, was das Sondervermögen Infrastruktur bedeutet, was feststeht und was noch geklärt werden muss.
Was ist das Sondervermögen für Infrastruktur?
Kurz vor der Konstituierung des neuen Bundestages haben die damaligen Abgeordneten einer Änderung des Grundgesetzes zugestimmt. Dort steht nun in Artikel 143h:
Der Bund kann ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro errichten.
Damit kann die Bundesregierung entsprechende Kredite aufnehmen, die nicht von der Schuldenbremse betroffen sind.
Wer bekommt wie viel von den 500 Milliarden?
100 der 500 Milliarden Euro erhalten laut Grundgesetz die Länder. Sie können es aber nicht beliebig einsetzen, sondern müssen dem Bund berichten, was sie mit dem Geld getan haben. Der wiederum kann dann prüfen, ob das Geld „zweckentsprechend“ eingesetzt wurde, also ob es tatsächlich für Infrastruktur genutzt wird.
Weitere 100 Milliarden sollen in den Klima- und Transformationsfonds gehen. Dieser Fonds finanziert beispielsweise Projekte zur Elektromobilität und zur Halbleitertechnik.
Wie genau die Aufteilung aussieht, soll ein Bundesgesetz regeln, dem im Fall der Länderbeträge auch der Bundesrat zustimmen muss. Ein Entwurf für das sogenannte Errichtungsgesetz hat Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) laut einem Bericht des Spiegel ins Bundeskabinett eingebracht. Die Ministerien sollen demnach am 24. Juni über den Entwurf abstimmen.
Was muss in einem Errichtungsgesetz noch geregelt werden?
Eine der großen Fragen ist, was alles zu Infrastruktur zählt und wofür die 500 Milliarden Euro eingesetzt werden können. Im Gesetzentwurf sind in der Begründung folgende Bereiche aufgezählt: „Zivil- und Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhaus-Investitionen, Investitionen in die Energieinfrastruktur, in die Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur, in Forschung und Entwicklung und Digitalisierung“.
Unklar ist außerdem, wie genau die Berichtspflichten für die Länder aussehen. Nach dem Willen der Finanzministerkonferenz sollen die „sowohl zeitlich als auch inhaltlich auf ein Mindestmaß“ beschränkt sein. Außerdem wollen sie, dass neben den speziell für die Länder reservierten 100 Milliarden Euro auch weitere Mittel über Bund-Länder-Programme für Landesangelegenheiten genutzt werden.
Was müssen die Länder noch entscheiden?
Auf einer Finanzministerkonferenz haben sich die Finanzchefs von Ländern und Bund darauf geeinigt, dass die 100 Milliarden für die Bundesländer entsprechend dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt werden sollen. Das heißt: Zu zwei Dritteln zählt das Steueraufkommen, zu einem Drittel die Bevölkerungszahl.
An der Spitze der Länder steht damit Nordrhein-Westfalen, es bekäme einen Anteil von etwa 21 Milliarden Euro. Am Ende der Liste stehen Bremen und das Saarland, ihnen würde je rund 1 Milliarde Euro zustehen.
Bevor es aber richtig losgehen kann, braucht es das oben erwähnte Bundesgesetz, das auch regelt, wie die Beträge eingesetzt werden dürfen.
Kommt das ganze Geld auf einmal?
Nein, laut Grundgesetz können Investitionen aus dem Sondervermögen innerhalb der nächsten zwölf Jahre bewilligt werden. Ob etwa die Länder das Geld in festen Raten und Zeitabständen oder abhängig vom Status konkreter Projekte bekommen, ist noch nicht abschließend geklärt.
Laut einem Spiegel-Bericht sollen zumindest die 100 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds „in zehn gleichmäßigen Tranchen bis 2034 überwiesen“ werden.
Der neue Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat in seiner Antrittsrede im Bundestag angekündigt, er wolle das zur Verfügung stehende Geld „möglichst schnell verbauen“.
Wie schnell kommt das Sondervermögen?
Der neue Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat in Aussicht gestellt, dass noch vor der Sommerpause ein Gesetz für die Einrichtung des Sondervermögens Infrastruktur in den Bundestag kommt. Der anvisierte Termin für die Kabinettsabstimmung ist der 24. Juni.
Da die letzte Sitzungswoche des Bundestages am 11. Juli endet, ist eine so kurzfristige Verabschiedung nicht realistisch.
Wie viel Digitales steckt im Sondervermögen?
Wie viel vom Sondervermögen in digitale Infrastruktur fließt, ist noch nicht absehbar. Dafür braucht es neben dem Bundesgesetz noch einen Wirtschaftsplan. Fest steht aber, dass die Begehrlichkeiten an den Mitteln groß sind.
Die Digitalminister:innen von Bund und Ländern schreiben: „Neben der Modernisierung des Staates und der öffentlichen Verwaltung durch Digitalisierung benötigen wir einen kräftigen Impuls für die digitalen Schlüsseltechnologien und souveräne, europäische IT-Infrastrukturen.“
Auf ihrer Konferenz im Mai forderten sie außerdem, der Bund solle prüfen, „ob Investitionen in Cloud und KI künftig auch aus dem zu errichtenden Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden können“.
Was sind Streitpunkte?
Für Diskussionen sorgt die Frage, wofür das Geld ausgegeben werden darf. Es soll für zusätzliche Investitionen da sein – aber wann ist das der Fall? Die grüne Haushaltspolitikerin Paula Piechotta hat dem Finanzminister etwa bereits vorgeworfen: „Er rechnet sich seinen Haushalt schön“. Sie hat bei den Haushaltsberatungen offenbar den Eindruck gewonnen, dass Lars Klingbeil reguläre Haushaltslöcher mit dem Zusatzgeld stopfen könnte.
Ein anderes Streitthema ist die Verteilung an Länder und Kommunen. Bekommen sie „nur“ die extra für sie vorgesehenen 100 Milliarden Euro oder auch etwas vom Rest? Wie eng sollen die Vorschriften sein, was sie mit dem Geld tun dürfen? Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen.
Das Präsidium des Deutschen Städtetags begrüßt, dass 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen ausdrücklich für die Länder und Kommunen bestimmt sind. Die Mittel sollten aber schnell und unkompliziert vor Ort ankommen, betont Verbandspräsident Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster (CDU).
Darüber hinaus sollten die Kommunen auch an den weiteren 300 Milliarden Euro „partizipieren“ können, so die Forderung des Städtetages. Er unterstreicht zugleich, dass dies nicht die kommunale Finanzkrise löse. Dafür brauche es weitere Reformen und Entlastungen.
Ins gleiche Horn stößt der Städte- und Gemeindebund. Dessen Hauptgeschäftsführer André Berghegger warnte den Bund, die Verwendung der Mittel einzuschränken: „Städte und Gemeinden wissen sehr genau, welche Infrastrukturmaßnahmen bei Straßen, Schulen, Brücken oder sonstigen Bereichen prioritär angegangen werden müssen“.
Dass es weitergehende Maßnahmen brauche, sagt auch der Vorsitzende des Deutschen Landkreistages, Achim Brötel (CDU). Er fordert einen deutlich höheren Anteil, den die Kommunen von der Umsatzsteuer erhalten. Damit könnten Landkreise, Städte und Gemeinden weit viel mehr anfangen „als mit einem großen Investitionsprogramm, bei dem der Bund die Bedingungen aufstellt und das möglicherweise dann noch nicht einmal die drängendsten kommunalen Bedarfe trifft“.
Was sagen Vertreter:innen der Zivilgesellschaft und Branchenverbände?
Henriette Litta, Geschäftsführerin bei der Open Knowledge Foundation Deutschland, sieht das angekündigte Sondervermögen grundsätzlich positiv. „Es kommt aber natürlich darauf an, wie genau diese Mittel eingesetzt werden“, so Litta gegenüber netzpolitik.org. „Wir brauchen eine missionsorientierte Finanzierungsstrategie für digitale Infrastruktur, die gut koordiniert, aus einem Guss umgesetzt und wirkungsorientiert begleitet wird.“
Sie fordert, „eine widerstandsfähige technologische Infrastruktur für unsere Demokratie“ zu schaffen. Dafür brauche es mehrere Voraussetzungen:
Erstens müssen die Grundlagen für Innovation verbreitert werden: Die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten an Forschungseinrichtungen müssen gestärkt und miteinander vernetzt werden; Kompetenzen im Bereich der digitalen Bildung müssen auf allen Ebenen gefördert werden. Zweitens muss ein breites Ökosystem für die Erprobung von Ideen geschaffen werden, in dem Start-ups und zivilgesellschaftliche Technologieinitiativen Software prototypisieren, Daten analysieren oder Algorithmen entwickeln können. Drittens müssen wir, wenn Prototypen funktionieren, Strukturen aufbauen, um Produkte zu skalieren, anzupassen und (dauerhaft) nutzbar zu machen. Viertens müssen wir – wenn Innovation zu Infrastruktur wird – ein stabiles System bereitstellen, um Produkte zu betreiben und die Verfügbarkeit, Qualität, Sicherheit und Standards zu gewährleisten, die wir für diese Produkte brauchen.
Dass es dringend Investitionen in zentrale, flächendeckende Verwaltungsstrukturen geben müsse, sagt Ann Cathrin Riedel, Geschäftsführerin bei NExT e. V. und ehemalige Vorsitzende bei LOAD – Verein für liberale Netzpolitik. „Dazu zählen vorrangig Basisdienste, die der Bund kostenfrei zur Verfügung stellen sollte, damit sie kostenlos von den Kommunen nachgenutzt werden können“, so Riedel gegenüber netzpolitik.org. Ein Vorbild sei hier Sachsen-Anhalt, das seinen Kommunen Paymentdienste anbiete.
Geld allein reiche aber nicht aus, sagt Riedel, sondern es brauche außerdem klare politische Verantwortung für einzelne Themen. „Beim Thema Verwaltungstransformation und Staatsmodernisierung muss jede:r Minister:in begreifen, dass sie für dafür in ihrem Bereich verantwortlich ist, denn sie werden keines ihrer politischen Vorhaben umsetzen können, wenn hier die Verwaltung nicht digital transformiert ist.“ Dazu gehöre auch, sich mit technischen Standards zu beschäftigen, die zentral vorgegeben werden müssten, damit der Datenaustausch auch funktioniere, sagt Riedel.
Der Digitalbranchenverband Bitkom hat bereits im März einen Digitalpakt Deutschland vorgeschlagen, den das Sondervermögen mit 100 Milliarden Euro finanzieren soll. Vier Felder nimmt der Verband dabei in den Blick: „Digitale Transformation der Wirtschaft, Aufbau eines sogenannten Deutschland Stacks durch die Förderung von Schlüsseltechnologien und Infrastrukturen, Verwaltungsdigitalisierung und digitale Bildung“.
Die Hälfte des Geldes solle demnach in „Innovationsförderung“ fließen, gemeint sind damit Tech-Start-ups, Künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Mit 35 Milliarden soll die Wirtschaft unter anderem mittels Sonderabschreibungen und Investitionsprämien einen „Digitalbooster“ erhalten. Zehn Milliarden Euro sollen der Verwaltungsdigitalisierung zugutekommen, fünf Milliarden der Bildung.