Apps & Mobile Entwicklung
Gen2 statt Gen1: Nvidia setzt bei DGX Station direkt auf SOCAMM 2

SOCAMM feierte als neue Spezial-RAM-Lösung erst im Frühjahr Premiere. Nun könnte es ganz schnell ein Update geben, welches dann auch Nvidia will. Denn die erste Generation soll nicht ausreichend für das sein, was der Hersteller benötigt. Und Nvidias Drang zu schnellerem Speicher wurde zuletzt des Öfteren benannt.
SOCAMM: Das steckt dahinter
SOCAMM steht für Small Outline Compression Attached Memory Module. Es ist ein neuer Standard für Speichermodule, die mit energiesparenden DRAM-Chips bestückt werden und die vorrangig zunächst für den Einsatz im KI-Umfeld gedacht sind. Die Basis für SOCAMM sind die Erfahrungen, die mit CAMM/CAMM2 bereits gemacht wurden, bei SOCAMM wird jedoch noch stärker auf ein kleines Profil sowie auf energiesparenden und schnellen Speicher geachtet.
Spezifiziert ist ein Modul, das 90 mm lang, aber nur 14 mm hoch ist. Nvidias DGX Station ist das erste System, das diese Module einsetzt, welche direkt neben der Grace-CPU auf der Platine verschraubt werden. Technische Probleme an mehreren Stellen einschließlich SOCAMM verhinderten bisher den Marktstart der DGX Station. Gezeigt wurden sie im letzten halben Jahr auf jeder Messe, die Website zeigt jedoch weiterhin unverändert den Hinweis „Notify me“. DGX Station ist „der ultimative Destkop-AI-Supercomputer“, der wie DGX Spark und die Grace-Blackwell-Supercomputer-Blades auf Nvidias Grace-Blackwell-APU setzt.
SOCAMM 2 soll vor allem schneller werden
Wie asiatische Medien nun berichten, scheint Nvidia die bisherige Lösung jedoch nicht auszureichen. Sie basiert auf vier LPDDR5X-Chips mit 7.500 oder 8.533 MT/s, mit denen sich wahlweise 32, 64 oder auch schon 128 GByte realisieren lassen. Bei SOCAMM 2, wie er in den Berichten genannt wird, sollen sowohl der Modulaufbau als auch die 694 I/O-Kontakte unverändert bleiben, es wird jedoch direkt mit 9.600 MT/s gestartet.
Das klingt nicht nach einer echten zweiten Generation, auch wenn Details noch unbekannt sind. Zu einem großen Teil wird es aber auch eine Frage der Zulieferer sein. Denn bisher hatte Micron den initialen Zuschlag zur Lieferung von SOCAMM an Nvidia, nun sollen jedoch alle drei Branchenriesen im Geschäft sein und die beiden koreanischen Hersteller SK Hynix und Samsung ihre Chance wittern.
Die neuen Lösungen könnten ab Anfang 2026 in die Serienproduktion übergehen. Zugleich wird angeblich bereits über die Zukunft mit LPDDR6 nachgedacht.
Apps & Mobile Entwicklung
CB-Fotowettbewerb: Sodann sollst du zählen bis drei, nicht mehr und nicht weniger

Der monatliche Fotowettbewerb der ComputerBase-Community geht in die nächste Runde. Im November 2025 werden Aufnahmen zum Thema „Drei“ gesucht. Bilder können wie üblich bis zum 20. Tag des Monats eingereicht werden, dann beginnt die Abstimmung innerhalb der Community.
Gruseln vor der Drei
Der Fotowettbewerb im vergangenen Oktober stand jahreszeitlich angemessen unter dem Motto „schaurig, gruselig und unheimlich“. Insgesamt 17 Aufnahmen kamen zusammen, wobei die Einreichung von Community-Mitglied leboef insgesamt 58 Prozent der Teilnehmenden an der Abstimmung eine ihrer drei Stimmen entlocken konnte. Das bedrückende Schwarz-Weiß-Bild zeigt kahle Bäume auf morastig-feuchtem Untergrund.

Die Redaktion gratuliert zum gelungenen Foto und dem ersten Platz. Wie üblich gebührt leboef damit einhergehend das Recht, das Thema für den nachfolgenden Monat zu setzen. Gesucht sind diesmal Bilder zum abstrakten Thema „Drei“.
Das neue Thema lautet: „Drei“ – keine Einschränkungen. Ob die Krallen von Dreifingerfaultieren, Dreiecke, oder die Ziffer „3“ an sich ästhetisch umgesetzt. Die Zahl Drei soll auf irgendeine Art und Weise im Bild eine Bedeutung haben.
Community-Mitglied leboef
Damit sind alle interessierten Community-Mitglieder aufgefordert, bis zum 20. November 2025 um 23:59 Uhr eine Aufnahme (JPEG oder PNG) zum Thema per E-Mail mitsamt dem eigenen Benutzernamen im ComputerBase-Forum an Initiator lowrider20 einzusenden.
Teilnahmebedingungen und Abstimmung
Je registriertem Community-Mitglied ist die Teilnahme mit einem eigens aufgenommenen, beliebig alten Bild erlaubt, das in noch keinem vorherigen Fotowettbewerb eingereicht oder anderweitig im ComputerBase-Forum veröffentlicht wurde. Aufnahmen mit dem gleichen Motiv eines bereits veröffentlichten Bildes aus leicht abgeänderter Perspektive sind unerwünscht. Nicht gestattet sind überdies Zeichnungen, gemalte oder per KI generierte Bilder sowie Renderings. Einmal eingereichte Bilder können nicht mehr ausgetauscht werden.
Nach Einsendeschluss startet eine neuntägige Abstimmung zu allen, maximal aber den ersten 40 eingereichten Bildern, an der alle Leser mit Forum-Nutzerkonto teilnehmen dürfen. Um die Anonymität der Fotografen zu wahren, werden die Fotos auf maximal 3.840 Pixel in Höhe und Breite verkleinert und die EXIF-Daten gegebenenfalls entfernt. Der zum Ende des Monats feststehende Gewinner darf erneut über das Monatsthema der nächsten Runde entscheiden. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg!
ComputerBase Forum Foto Challenge
Ergänzend zum monatlichen Fotowettbewerb soll in Zukunft die „ComputerBase Forum Foto Challenge“ laufen. Im Laufe des Novembers sind alle Community-Mitglieder eingeladen, Themenvorschläge einzureichen, über die dann im Dezember gemeinsam abgestimmt wird. Das Format richtet sich nicht nur an professionelle oder ambitionierte Hobbyfotografen mit Vollformatkamera und Wechselobjektiven, sondern explizit auch an Amateure und Gelegenheitsknipser mit Smartphones.
Apps & Mobile Entwicklung
MSI Pro Shield M100P: Günstiges Kompaktgehäuse für den Office-Schreibtisch
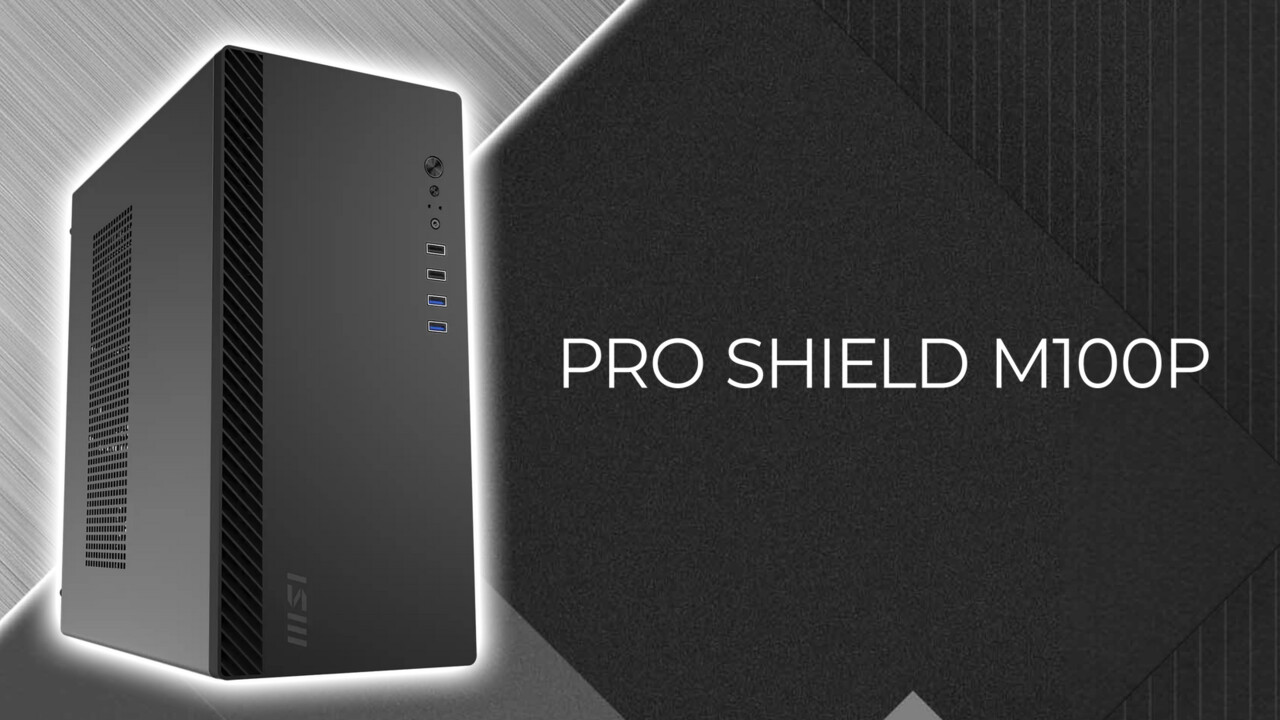
Mit dem Pro Shield M100P baut MSI ein günstiges Gehäuse für kompakte Workstations und Büro-PCs, das sich durch seine geringe Tiefe bequem neben dem Monitor auf den Schreibtisch stellen lässt. Kühlen müssen sich Komponenten allerdings überwiegend selbst.
Dank Abmessungen von 312 × 166 × 354 mm (L × B × H) kommt das Pro Shield M100P auf ein Volumen von nur 18,33 Litern. Das reicht, um ein Micro-ATX-Mainboard unterzubringen. Erweiterungskarten dürfen allerdings nicht weit über die Platine hinausragen: Maximal 275 Millimeter stehen ihnen zur Verfügung, was die Verwendung von Mittelklasse-GPUs ermöglicht.
Aufbau und Komponenten
Teilen müssen sie sich diesen Platz beim MSI-Gehäuse aber nicht mit Frontlüftern; es gibt schlicht keine. Hinter der Front kann allerdings eine 3,5″-HDD befestigt werden, die den entsprechenden Platz reduziert. Eine weitere 3,5″-Festplatte lässt sich am Boden des Towers montieren, alternativ können dort zwei 2,5″-Datenträger montiert werden. Halterungen gibt es jedoch nicht, sie werden direkt mit dem Chassis verschraubt.
Die Kühlung von Komponenten erfolgt deshalb überwiegend passiv, sie müssen Luft selbst von außen ins Gehäuse befördern. Über CPU und Grafikkarte sind deshalb Luftöffnungen, der Tower ist demnach mehr auf Top-Flow-Kühlung denn auf flache Tower-Modelle für den Prozessor ausgelegt.
Dafür spricht auch die relativ geringe Kühlerhöhe von 140 Millimetern, die für diesen Typ Kühler auch die Verwendung leistungsstarker Modelle ermöglicht. Um Luft aus dem Gehäuse zu entfernen wird das Netzteil einbezogen, das klassisch über dem Mainboard sitzt. Zusätzlich sitzt ein 80-mm-Lüfter im Heck des Pro Shield M100P. Klar ist damit aber auch: Für High-End-Komponenten mit extrem hoher TDP ist das Modell nicht ausgelegt.
Günstiger Preis schon in der Ausstattung
Im Handel kann das Gehäuse bereits für knapp unter 40 Euro bezogen werden. Den günstigen Preis verraten weitere Ausstattungsmerkmale schon auf dem Papier: Am IO-Panel befinden sich vier USB-Ports, aber nur zwei USB-3.0-Modelle, auf USB C verzichtet MSI. Darüber hinaus sind Slotblenden nicht gesteckt, sondern müssen herausgebrochen werden. Staubfilter gibt es ebenso wenig.
Apps & Mobile Entwicklung
Dieses Smartphone kostet keine 200 Euro – aber nur für kurze Zeit
Ein gutes Smartphone muss nicht teuer sein. Habt Ihr nicht den Anspruch auf höchstem Niveau zu zocken oder hochkomplexe Anwendungen auf Eurem Smartphone auszuführen, gibt es einige richtig spannende Geräte für weniger als 200 Euro. Dank eines Deals zählt jetzt auch dieses Motorola-Modell dazu.
Der Hersteller ist ein echtes Urgestein auf dem Mobiltelefonmarkt. Nachdem das erste Smartphone auf den Markt kam, versank Motorola jedoch immer weiter und verlor an Bedeutung. Mittlerweile ist das US-amerikanische Unternehmen vor allem auf dem Mittelklasse-Markt vertreten. Mit der Moto g-Serie erwarten Euch Smartphones, die vor allem im alltäglichen Gebrauch punkten können. Richtig spannend wird das aktuelle Motorola Moto g86 5G jedoch erst, wenn Ihr es Euch für 199 Euro bei Amazon und MediaMarkt schnappen könnt.
Das Smartphone bietet ein hochwertiges Design und ist dank eines Soft-Touch-Finish nicht so rutschig, wie andere Geräte. Zertifizierungen nach IP68 und IP69 bestätigen zudem einen Schutz gegen Wasser und hohen Temperaturen. Das pOLED-Display hingegen misst 6,67 Zoll und liefert eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Es wird bis zu 4.500 Nits hell, was in dieser Preisklasse eher eine Seltenheit darstellt und Euch selbst bei stärkerer Sonneneinstrahlung alles gut erkennen lässt. Auf der Rückseite findet sich das Kamera-Modul mit der 50-MP-Hauptkamera und 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Auch ein 3-in-1-Lichtsensor gesellt sich hier dazu.
Das Kamera-Setup ist nichts Weltbewegendes, aber bei einem Smartphone für 200 Euro muss man nun mal einige Abstriche machen. Gute Fotos bei Tageslicht könnt Ihr hiermit dennoch schießen. Für die nötige Leistung sorgt ein MediaTek Dimensity 7300. Den 5G-Prozessor findet man auch in Smartphones, die 400 Euro oder mehr kosten. Dieser liefert 8 GB RAM (die sich virtuell auf bis zu 24 GB steigern lassen) und 256 GB internen Speicher. Mit seiner Akkukapazität von 5.100 mAh ist das Motorola Moto g86 5G ebenfalls gut ausgestattet und hält somit, laut Hersteller, bis zu 41 Stunden durch. Auch KI-Funktionen sind hier dank „moto AI“ möglich.
Smartphone unter 200 Euro: Darum lohnt sich dieser Deal
Schauen wir also noch auf den Preis. Amazon verlangt jetzt nur noch 199 Euro für das Smartphone – welches übrigens als „Amazons Tipp“ gekennzeichnet wird – und liefert damit einen nie dagewesenen Bestpreis. Für das nächstbeste Angebot müsst Ihr aktuell mit knapp 220 Euro rechnen. Den genauen Preisverlauf könnt Ihr der folgenden Grafik entnehmen:
Könnt Ihr mit Amazon nichts anfangen (oder ist das Angebot vielleicht schon wieder vergriffen), hat auch MediaMarkt das Motorola Moto g86 5G für 199 Euro auf Lager. Hier ist es Teil einer Aktion und der Deal läuft noch bis zum 13.11. oder bis keine Geräte mehr verfügbar sind.
Möchtet Ihr ein Smartphone, das Euch zuverlässig durch den Alltag bringt, nicht viel kostet und zudem noch richtig gut aussieht, macht Ihr mit diesem Deal absolut nichts falsch.
Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Motorola Moto g86 interessant für Euch oder greift Ihr zu anderen Smartphones? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!
Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 3 Monaten
Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online




















