Digital Business & Startups
IAA Mobility: Zwischen Hoffnung und Selbstbetrug
Während China längst Batterien und Software beherrscht, inszeniert sich die deutsche Autoindustrie mit Scheinlösungen wie Plug-in-Hybriden und verliert die Kontrolle über ihre eigene Zukunft.

In dieser Woche verwandelt sich München wieder zur Bühne für die deutsche Autolobby. Die IAA Mobility verspricht eine Leistungsschau, die suggeriert, es sei längst alles im grünen Bereich. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn vor allem E-Autos werden im Zentrum der PR-Arbeit stehen. Doch wer genauer hinschaut, erkennt, dass zwischen der Show und der Realität ein tiefer Graben klafft.
Die deutsche Industrie klebt weiter am SUV und Verbrenner fest. Das hat viele Gründe: Milliardeninvestitionen in bestehende Produktionslinien, Mängel bei der Infrastruktur und Kunden, die die E‑Mobilität weiter skeptisch sehen. Der Verbrenner wird als Schutz der heimischen Arbeitsplätze verkauft, ist aber genau das Gegenteil: Er ist der Bremsklotz unter dem Rad der Transformation.
Die Plugin-Illusion
Es wundert daher auch nicht, dass Übergangstechnologien wie der Plugin-Hybrid und Range-Extender zurzeit massiv von der Industrie gefördert werden. Das Argument lautet weiterhin, dass vor allem Plugin-Hybride den Kunden den Sprung zur Elektromobilität erleichtern. Doch Plugins werden zu selten geladen. Der Verbrauch dieser Fahrzeuge liegt rund 3,5 Mal über den angegebenen Werten. Wer nicht konsequent lädt, fährt faktisch einen schweren Benziner mit E-Bonus fürs Prospekt.
Dass die deutsche Autoindustrie die Elektromobilität noch immer nicht verstanden hat, daran ändert auch die IAA nichts. Anders als in China, wo Hersteller wie BYD oder Xpeng ihre E‑Auto-Wertschöpfungskette von der Batterie über die Software bis hin zur Produktion kontrollieren, verlässt sich Deutschland auf Bewährtes.
Die deutschen Hersteller erlangten vor allem auch deswegen Weltruhm, weil sie sich eng mit den mittelständischen Zulieferern verzahnten, die viele Innovationen beisteuerten. Getriebe von ZF, Kolben von Mahle, Elektronik von Bosch, um drei Beispiele zu nennen. Doch beim E-Auto geht man genau den entgegengesetzten Weg. Die Batterien und Elektromotoren stammen aus China, die Software aus den USA. Man hat freiwillig die Kontrolle über die wichtigsten Komponenten abgegeben.
BMW und Daimler geben Hoffnung
Ein wenig Hoffnung gibt es aber auch. BMW nähert sich mit seiner „Neue Klasse“-Architektur softwaredefinierten Autos an, mit einer Hardware-Architektur, die 20-mal mehr Rechenpower liefert und die Fahrzeugfunktionen zentralisiert steuert.
Und Mercedes-Benz liefert mit dem eigenen MBOS-Infotainmentsystem eines der besten Systeme, die es auf dem Markt gibt. Dazu öffnet sich das Unternehmen für eine Partnerschaft mit Google – beim Sprachassistenten „AI Agent“, eingebunden in die Fahrzeugarchitektur, aber mit Mercedes-Erlebnis im Fokus.
Diese Teil-Erfolge ändern nichts daran, dass die Branche als Ganzes erst zaghaft das digitale Jahrzehnt erreicht, während Techkonzerne und chinesische Autohersteller längst voraus sind. Der digitale Sprung erfordert Mut zur Neugestaltung – und den haben viele deutsche Hersteller bislang nicht gezeigt. Es reicht nicht, innensitzend neue Softwaremuskeln aufzubauen oder auf Open-Source-Initiativen zu setzen. Die strukturelle Umkehr fehlt, sie wird zur Last im globalen Wettbewerb.
Mehr Digitales wagen
Dabei gibt es genug Kompetenz, sowohl in der Batterie-, als auch in der Softwareentwicklung in Deutschland. Startups wie Pulsetrain und NordSci entwickeln revolutionäre Batterietechnologie, die von den Herstellern nur schleppend unterstützt wird. Das gilt auch für das Münchner Startup DeepDrive, die revolutionäre E-Motoren entwickeln. Die Kompetenz und das Ingenieurswissen sind da, es wird nur nicht genutzt.
Die IAA verschleiert, was sichtbar sein müsste. Der Rückstand der deutschen Autoindustrie auf die Konkurrenz aus China wird größer. Wenn BMW und Mercedes Softwarekompetenz aufbauen können, ist das gut – nicht für die Show, sondern für die Zukunft dieser Industrie. Und auch für die Digital-Nation Deutschland wäre das ein kleiner Sieg. Nur leider bleibt der große Wurf aus: Die IAA wird zum Spiegelbild einer Branche, die lernen muss, dass Mobilität nicht nur Farbe und Form ist, sondern Intelligenz und Mut.
Digital Business & Startups
LEuLI, Bobsla, TannTastisch, Joy, Streuselade treten beim Weihnachts-Special vor die Löwen
#DHDL
Es geht wieder in die Löwen-Höhle! An diesem Montag flimmert bei Vox das Weihnachts-Special der erfolgreichen Gründer-Show “Die Höhle der Löwen” über den Bildschirm. In der Festtags-Folge pitchen LEuLI, Bobsla, TannTastisch Joy und Streuselade.

Auch in der mittlerweile achtzehnten Staffel der erfolgreichen Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen„ (DHDL) gibt es wieder ein Weihnachts-Special. Die Löwen-Jury bestehend aus dem Regal-Löwen Ralf Dümmel, der Venture-Capital-Löwin Janna Ensthaler, dem Sales-Löwen Carsten Maschmeyer, der Beauty-Löwin Judith Williams, der Familien-Löwin Dagmar Wöhrl und dem Startup-Löwen Frank Thelen ist in Festtagslaune! Denn Lichterglanz trifft auf Gründergeist und Plätzchenduft auf Pitch-Fieber. Und zwischen Tannenduft und Deal-Glocken warten noch viele weitere Überraschungen.
Die DHDL-Startups des Weihnachts-Specials
LEuLI aus Ingolstadt
Maria Mittermüller (34) aus Ingolstadt stellt ihr Herzensprojekt vor: LEuLI, ein multifunktionales, nachhaltiges und mitwachsendes Holzspielzeug für Kinder vom Babyalter bis zur Grundschule. Entwickelt aus eigener Eltern-Erfahrung, verbindet LEuLI pädagogischen Anspruch mit moderner Langlebigkeit – und soll eine Alternative zur schnelllebigen Wegwerf-Spielzeugwelt sein. Als zweifache Mutter weiß Maria genau, was Eltern suchen: ein Spielzeug, das fördert, kreativ macht, lange genutzt werden kann und nicht viel Platz braucht. Das Ergebnis ist ein wandelbarer Holzrahmen, der vom Spielbogen für die Kleinsten über Motorik-Elemente bis hin zum Puppentheater, zur Kreidetafel oder sogar zur Staffelei alles sein kann. Wie gut LEuLI ankommt, zeigen die knapp vierjährige Nayara und der einjährige Emil – beide sind während des Pitchs völlig vertieft in ihrem Spiel. Da lassen es sich Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler nicht nehmen, mit den Kleinen gemeinsam LEuLI zu testen. Die Investorinnen und Investoren sind beeindruckt von dem Konzept. „Rein vom Produkt her sieht das wirklich gut durchdacht aus“, lobt ein Löwe. Auch die Vielseitigkeit begeistert: ein Spielzeug für Geschwister, Kitas, Therapieeinrichtungen, Praxen, Familienhotels und natürlich für Familien zu Hause. Doch zugleich kommen kritische Fragen auf – vor allem zu Preis, Skalierung und Vertrieb. Erst seit sechs Monaten am Markt, hat die Gründerin zwar bereits positive Presse und Messefeedback gesammelt, doch die Verkaufszahlen bleiben bislang überschaubar. Ob es für Maria Mittermüller ein Weihnachtswunder gibt?
Bobsla aus Wattens (Österreich)
Es weihnachtet wieder in der „Höhle der Löwen“! Das Feuer knistert, alles erstrahlt im warmen Lichterglanz und die Löwen genießen die gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre. Doch die festliche Ruhe ist nur von kurzer Dauer – denn dieser Pitch endet in einem spektakulären Schreckmoment und einem Crash von Frank Thelen. Die Gründer Sergey Ignatyev (53) und Werner Kirchner-Höffer (52) präsentieren ihr elektrisch betriebenes Schneemobil „Bobsla“. Ein emissionsfreies Fun-Sportgerät, das dank zweier 48-Volt-Motoren und einer tiefen Sitzposition besonders wendig und nahezu „unkippbar“ sein soll. „Wir wollten ein Fahrzeug entwickeln, das Spaß macht, nachhaltig ist – und das klassische Schneemobil neu denkt“, erklärt Werner Kirchner-Höffer. Investor Frank Thelen lässt es sich nicht nehmen, den Bobsla außerhalb des Studios zu testen – auch wenn er sich auf dem glatten Studioboden natürlich anders verhält als auf Schnee. Doch plötzlich rauscht er ungebremst in ein Tor. „Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, das Gerät hat keinen Schaden genommen“, entschuldigt sich der Löwe bei den Gründern. So haben sich Sergey Ignatyev und Werner Kirchner-Höffer ihren Pitch des Elektro-Schneemobils Bobsla sicher nicht vorgestellt. Ist die weihnachtliche Stimmung jetzt dahin oder kann sie mit einem Deal gerettet werden?
TannTastisch aus Werder (Havel)
Dr. Christian Mai (38) bringt echten Weihnachtszauber in die „Höhle der Löwen“. Der frisch gebackene Vater stammt aus einem traditionsreichen Weihnachtsbaum-Betrieb – und hat dort eine überraschende Entdeckung gemacht: Junge Tannentriebe schmecken zitronig-frisch und sind reich an Vitamin C. Für den 38-Jährigen der Startschuss zu einer ungewöhnlichen Idee: TannTastisch. Mit seiner Marke präsentiert der Gründer den Löwinnen und Löwen eine außergewöhnliche Produktwelt aus der Nordmanntanne. Insgesamt 41 Food- und Beauty-Produkte hat er bereits entwickelt – von Tannen-Orangenmarmelade über Senf und Pesto bis hin zu Eierlikör, Gin und Wellnessartikeln. „In unseren Tannen steckt viel mehr als man denkt“, erklärt Christian Mai. „Ich möchte zeigen, wie vielseitig dieses Naturprodukt sein kann.“ Im Studio dürfen die Investorinnen und Investoren probieren und reagieren überrascht: Einige Produkte überzeugen geschmacklich sofort, andere sorgen für Diskussionen. Besonders die Frage, ob Tanne auch außerhalb der Weihnachtszeit funktioniert und wie ein so breites Sortiment skalierbar ist. Ob die mutige Idee von Christian Mai bei den Löwen Wurzeln schlägt?
Joy aus Berlin
Titus Hüsken (32) und Franz Koller (29) betreten die Bühne in der „Höhle der Löwen“ mit einer klaren Mission: Schluss mit unpersönlichen oder unflexiblen Gutscheinen, die in Schubladen verstauben. Joy ist ein flexibler, personalisierbarer Universal-Gutschein, der für jedes online erhältliche Produkt, von A wie AirPods bis Z wie Zitronenpresse, einlösbar ist. Die Beschenkten wählen einfach ihr Wunschprodukt, fügen die URL ein – fertig. Die Gutscheine können mit persönlichen Nachrichten, Fotos oder Videobotschaften versehen werden – sogar als Weinflaschen-Label für die festliche Geschenkübergabe. Neben Privatkunden setzt Joy vor allem auf Firmenkunden, die hunderte Gutscheine gleichzeitig vergeben. Ein klarer Wachstumshebel, wie die Gründer betonen. Der Pitch kommt gut an: Die Löwen bescheinigen Joy ein cleveres Konzept in einem riesigen Markt. Doch als es um das Geschäftsmodell geht – konkret um Margen, UVPs und die hohe Gewinnspanne durch Einkaufsvorteile – beginnt eine intensive Debatte. Schließlich kommt es zu einer ungewöhnlich emotionalen Verhandlungsrunde: zwei konkurrierende Angebote und ein intensiver Schlagabtausch über Bewertung, Fairness und internationale Expansion. Die Löwen ringen miteinander, widersprechen sich gegenseitig, springen ab und wieder ein. Selten war die Entscheidung so dynamisch. Doch wem schenken die Gründer am Ende ihr Vertrauen?
Streuselade aus Wiesbaden
Was darf in der großen DHDL-Weihnachtsfolge nicht fehlen? Natürlich: Plätzchen backen – und dekorieren! Gründerin Jennifer Kraus (37) verwandelt die Höhle kurzerhand in eine fröhliche Weihnachtsbäckerei. Die Gründerin, die mit ihrem Startup „Meine Backbox“ seit mehreren Jahren kreative Rezepte samt Backzutaten in deutsche Haushalte bringt, stellt in der „Höhle der Löwen“ ihre neuste Entwicklung vor: Streuselade – bunte Schokostreusel, die aussehen wie Zuckerstreusel, aber zart schmelzen wie Schokolade. „Wisst ihr, was es noch nicht gibt? Schokoladenstreusel in allen Farben des Regenbogens – bis jetzt“, erklärt Jennifer Kraus. Mit ihren farbenfrohen Streuselmischungen und Maskottchen Streuselina begeistert sie die Löwen zunächst am Backtisch und anschließend bei der Verkostung. Doch die Firmenbewertung sorgt für Diskussionen unter den Investoren. Gibt es vielleicht am Ende doch noch ein Weihnachtswunder für die Gründerin?
Tipp: Alles über die Vox-Gründershow gibt es in unserer großen DHDL-Rubrik.
Startup-Jobs: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? In der unserer Jobbörse findet Ihr Stellenanzeigen von Startups und Unternehmen.
Foto (oben): RTL / Bernd-Michael Maurer
Digital Business & Startups
5 neue Startups: Motley, Darbots, PaxUp, FactFlow, fluado
#Brandneu
Erneut bereichern vielversprechende Neugründungen die Startup-Szene. Im Folgenden stellen wir diese junge Unternehmen vor: Motley, Darbots, PaxUp, FactFlow und fluado.
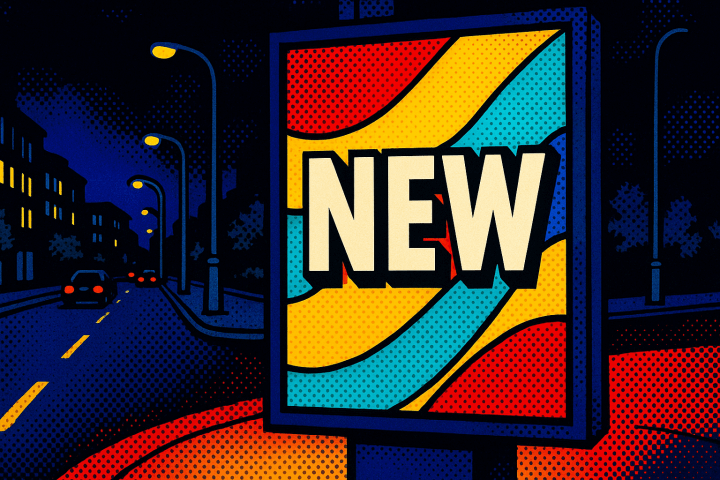
Frische Ideen, neue Firmen: deutsche-startups.de präsentiert heute wieder junge Startups, die kürzlich gegründet wurden oder gerade ihren Stealth-Mode beendet haben. Wer noch mehr Neugründungen entdecken möchte, sollte unseren Newsletter Startup-Radar abonnieren.
Motley
Die noch frische Firma Motley aus Zürich ermöglicht es, Customer-Success- und Business-Teams Unternehmensdaten automatisch in Reports zu verwandeln. „Manual reporting costs business teams 2.4 billion hours a year. So, we’re building Motley, the intelligent reporting platform for business teams“, erklärt das Team der Gründer Egor Kraev, Artemy Belousov und Yann Ranchere.
Darbots
Das Berliner GreenTech Darbots, von Hadi Yazdi und Qiguan Shuhat auf die Beine gestellt, hat vor, sich als eine Art digitaler Arzt für Stadtbäume zu etablieren. Zur Idee schreibt das Team: „Durch den Einsatz modernster Werkzeuge hat unser Team präzise Methoden entwickelt, um das Baumwachstum zu messen und deren Gesundheit in urbanen Umgebungen zu beurteilen.“
PaxUp
PaxUp aus Karlsruhe, von Matthias Hunger, Lena Renner und Hugo Lahr ins Leben gerufen, positioniert sich als Analyse- und Planungssoftware für Flughäfen. Zum Konzept teilt das Team mit: „PaxUp gives you everything you need to develop data-backed route cases. All the essentials – O&D demand, schedules, and fare data – are already built in.“
FactFlow
Beim Startup FactFlow, in Bonn von Alexa Leyens, Johannes Kopton, Jan Ellenberger und Katja Schiffers gegründet, geht es um „Ökobilanzierung für die Landwirtschaft“. Das Team nutzt dabei „GAP-Anträge und Daten aus bestehenden Berichtspflichten, um mit minimalem Aufwand vollständige Ökobilanzen zu erstellen“.
fluado
Hinter fluado, von Arbo von Monkiewitsch, Yves Van Goethem und Julian Engels auf die Beine gestellt, verbirgt sich ein AI-Vermietungsassistent. Die Plattform der Berliner Jungfirma übernimmt dabei zeitaufwändige Aufgaben wie Rechnungsbearbeitung, Zahlungsmanagement und Nebenkostenabrechnung.
Tipp: In unserem Newsletter Startup-Radar berichten wir einmal in der Woche über neue Startups. Alle Startups stellen wir in unserem kostenpflichtigen Newsletter kurz und knapp vor und bringen sie so auf den Radar der Startup-Szene. Jetzt unseren Newsletter Startup-Radar sofort abonnieren!
Startup-Jobs: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? In der unserer Jobbörse findet Ihr Stellenanzeigen von Startups und Unternehmen.
Foto (oben): Bing Image Creator – DALL·E 3
Digital Business & Startups
Die Höhle der Löwen: So feiern die Investoren privat Weihnachten
Ob Weihnachts-Bolognese, pommersche Basteleien oder gemeinsames Singen: Die sechs Investoren verraten im DHDL-Weihnachtsspecial, wie sie die Festtage verbringen und welche Traditionen sie pflegen. Dabei kommt es zu emotionalen Momenten.

Festliche Stimmung liegt beim Weihnachtsspecial von Die Höhle der Löwen (DHDL) in der Luft und die sechs Löwen Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen sind in Weihnachtslaune. Wie die Investoren privat feiern und welche Traditionen an den Festtagen nicht fehlen dürfen, verraten sie in der Show – und sorgen dabei für berührende Momente.
Judith Williams verrät, dass neben aufgehängten Strümpfen am Kamin für sie das gemeinsame Singen zum Weihnachtsfest dazu gehöre. „Wir singen so, dass auch die Nachbarn etwas davon haben.“ Gemeinsam mit Schauspieler und Sänger Alexander Klaus-Stecher, Judith Williams Ehemann, schmettern die sechs Löwen den Weihnachtsklassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Weihnachts-Bolognese bei Familie Maschmeyer
„Wir schreiben uns Briefe“, erzählt Carsten Maschmeyer. Das sei für ihn die schönste Familien-Tradition. Nicht selten fließen dabei Tränen vor Rührung. Am zweiten Weihnachtstag stehe er jedes Jahr ab 10 Uhr in der Küche und koche Bolognese – von seiner Familie wird Maschmeyer deshalb auch „Bolo-King“ genannt. Knapp drei Stunden brauche er dafür. Maschmeyers Tipp für die perfekte Bolo: Die Nudeln müssen noch al dente in die Sauce gegeben werden – so nehmen die Nudeln die Sauce und den Geschmack auf.
Pommersche Bastel-Traditionen im Hause Ensthaler
Janna Ensthaler erzählt von ihrem verstorbenen Großvater: Er habe für seine Enkel rote Weihnachtsrosen gebastelt und aufgestellt. Diese Tradition führe sie nun fort. Dabei handelt es sich um sogenannte pommersche Christrosen, denn ihr Großvater war dort aufgewachsen.
Nach pommerscher Sitte werden aus grünem oder rotem Seidenpapier die Blätter geformt, zu Blüten gerollt und an ein Glas geklebt. In das Glas wird eine kleine Kerze gestellt, die für eine heimelige adventliche Atmosphäre sorgt. Für eine Rose braucht Ensthaler bis zu 45 Minuten, verrät sie. Die Löwen überraschte sie mit dieser Bastelei.
Lest auch
Thelen besucht Weihnachtsgottesdienst
Frank Thelen erzählt, dass Weihnachten in seiner Kindheit ohne große Geschenke gefeiert wurde: „Bei uns wurde Weihnachten einfach nicht so gefeiert.“ Weihnachten habe nicht die Bedeutung gehabt, erklärt Thelen. „Und geldmäßig war es auch nicht so super.“

In der Familie seiner Frau Nathalie Thelen-Sattler habe Weihnachten jedoch eine große Rolle gespielt. Ihre Tradition habe er übernommen: Weihnachten ziehe er sich immer einen Anzug an und die Familie gehe gemeinsam in die Kirche.
Warum Dagmar Wöhrl Weihnachten im Tempel feiert
Für Dagmar Wöhrl ist die Weihnachtszeit keine einfache Zeit, sagt sie unter Tränen in der Show. 2001 verlor sie ihren 12-jährigen Sohn bei einem Unfall. „Für mich ist Weihnachten nicht mehr so schön, wie es früher einmal war.“ Weihnachten sei immer ein Fest gewesen, bei dem die Familie beisammen war. „Und wenn dann plötzlich ein Kind nicht mehr da ist, das kann man sich nicht vorstellen.“ Seither verbringe sie Weihnachten in Südasien, in Sri Lanka. „Ich konnte nicht mehr unter dem Christbaum sein.“
An Weihnachten besuche sie dort einen buddhistischen Tempel: „Das ist immer sehr emotional.“ Seit über 40 Jahren fühlt sie sich mit dem Land verbunden – bei einer zweijährigen Bullireise habe sie das Land kennen und lieben gelernt, erzählt sie.
Lest auch
Ralf Dümmel und weitere Löwen nutzen die Vorweihnachtszeit, um sich zu engagieren. Dümmel erzählt, dass er im vergangenen Jahr eine Essensausgabe besuchte und dort Spenden überreicht hat. „Ich bin so glücklich nach Hause gegangen – das sind die schönsten Geschenke, die man machen kann.“ Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Gebens, pflichten die anderen Löwen bei.
Das große DHDL-Weihnachtsspecial zeigt VOX am 8. Dezember um 20.15 Uhr.
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet
-

 Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten
Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle
-
Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten
Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac
-

 Social Mediavor 3 Monaten
Social Mediavor 3 MonatenSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?

















