Künstliche Intelligenz
Instinct MI350X/MI355X: AMD opfert Compute- für KI-Rechenleistung
AMD hat am 12. Juni 2025 auf seiner Hausveranstaltung Advancing AI im kalifornischen San José die kommenden Instinct-Beschleuniger MI350X und MI355X offiziell vorgestellt und einen Ausblick auf MI400 im nächsten Jahr gegeben. Die beiden MI35xer-Modelle kommen mit bis zu 288 GByte HBM3e-Stapelspeicher (High-Bandwidth Memory) und nehmen im Fall der MI355X mit direkter Flüssigkühlung 1,4 bis 1,5 Kilowatt Leistung auf. Laut AMD sollen Sie gegenüber den MI300X-Vorgängern beim KI-Inferencing rund 2,6 bis 4,2 Mal so schnell sein. Nvidias CPU-GPU-Kombi GB200 sollen sie beim KI-Training Paroli bieten oder im Vergleich zum B200-Beschleuniger bis zu 30 Prozent Vorsprung bieten.
Damit will AMD sich einen Anteil am riesigen KI-Geldtopf sichern, an dem sich Nvidia seit Jahren finanziell labt und in den Börsenberichten ein Rekordquartal nach dem anderen meldet. AMD wirbt mit einer bis zu 40 Prozent höheren Durchsatzrate pro Dollar (Tokens/$), die sich aus den maximal 30 Prozent höheren Durchsatz nur zum Teil speist – zusätzlich muss AMD die MI355X auch billiger anbieten als Nvidias B200-Systeme.
AMDs Instinct-Reihe sind massiv parallele Beschleuniger, die speziell für den Einsatz in Rechenzentren vorgesehen sind; die MI350X und MI355X verwenden mit CDNA4 die vierte Generation dieser Rechenbeschleuniger. Beide haben eine Speichertransferrate von bis zu 8 TByte/s und unterscheiden sich hauptsächlich in Sachen Taktrate und Leistungsaufnahme. Die MI350X ist mit 1 kW vergleichsweise zahm. Sie ist mit einem Durchsatz von 72 zu 79 Billionen Rechenschritten bei doppeltgenauen Gleitkommazahlen (FP64-TFLOPS) auf dem Papier aber nur knapp 9 Prozent langsamer als die wesentlich stromdurstigere MI355X. Letztere soll bis zu 1,4 kW, also 40 Prozent mehr als die kleinere Schwester aufnehmen. In einer Vorschau nannte ein AMD-Sprecher sogar bis zu 1,5 kW.
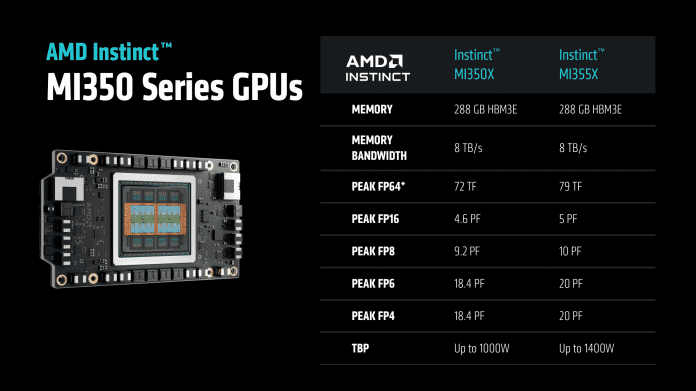
Übersicht AMD Instinct MI350X und MI355X.
(Bild: AMD)
AMD sieht die MI350X für den Einsatz in luftgekühlten Serverschränken mit bis zu 64 GPUs vor. Die MI355X soll in hochdichten Racks mit bis zu 128 GPUs unterkommen, benötigt dann aber direkte Flüssigkühlung (DLC), um nicht zu überhitzen.
Dass AMD weitere Schritte in Richtung KI-Optimierung geht, überrascht indes nicht. Einerseits liegt dort gerade das große Investorengeld, andererseits hatte AMDs Technikchef Mark Papermaster auf der ISC25 in Hamburg erst vor zwei Tagen die Wichtigkeit von Berechnungen mit gemischter Präzision hervorgehoben. Eine Version mit integrierten CPU-Chiplets analog zum MI300A hat AMD vom MI350 bisher nicht erwähnt.
Ein Schritt vor, ein Schritt zurück
Der Fokus lag bei den Vorgängern aus der MI300/325-Reihe noch auf der Verwendung in Supercomputern und Rechenzentren gleichermaßen. Das hat AMD bei der MI355X geändert. Die Rechenwerke sind für den Einsatz bei KI-Aufgaben weiter optimiert, müssen dafür aber Federn bei klassischen Aufgaben lassen. Pro Takt und Rechenwerk gibt es sogar Rückschritte.
Wie schon bei den älteren Instinct-MI-Modellen verwenden die AMD-Ingenieure bei der MI355X auch 3D-Chiplets. Als Basis kommen zwei IO-Dies zum Einsatz, die in bewährter 6-Nanometer-Technik gefertigt werden. Darin sind insgesamt 256 MByte Infinity-Cache enthalten, aufgeteilt in 2-MByte-Blöcke, sowie die sieben Infinity-Fabric-Links (IF) der vierten Generation, die pro Stück jetzt 153,6 GByte/s übertragen und mit insgesamt 1075 GByte pro Sekunde bis zu acht MI35xX verbinden. Auch die 5,5 TByte/s schnelle Verbindung der beiden IO-Dies hat AMD überarbeitet: Sie ist jetzt breiter, taktet dafür aber niedriger. Dadurch lässt sich die nötige Spannung als Haupttreiber der Leistungsaufnahme senken. AMD nennt diese Verbindung der beiden IO-Dies Infinity Fabric Advanced Package (IF-AP).
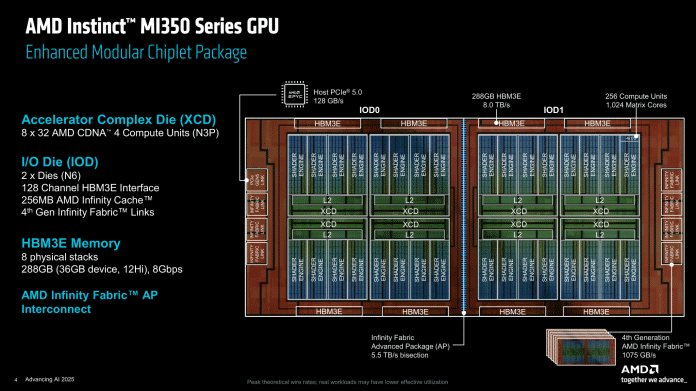
Chiplet-Technik mit 3D-Stacking: Zwei IO-Dies in 6- und acht XCDs in 3-nm-Technik.
(Bild: AMD)
Auf den beiden IO-Dies sitzen die acht Accelerator Compute Dies (XCDs), die TSMC im moderneren N3P-Prozess herstellt. In jedem davon sind 32 aktive Compute-Units enthalten – vier sind zur Verbesserung der Chipausbeute deaktiviert. Wer sich gut Zahlen merken kann, dem fällt auf, dass der Vorgänger mit 304 CUs noch 48 Einheiten mehr hatte. Auch dadurch ist die Versorgung mit Daten aus dem HBM3e-Speicher nun um Faktor 1,5 besser als zuvor: 16 Prozent weniger CUs, 30 Prozent mehr Transferrate.
Das geht laut AMD auf Erfahrungen aus der Praxis zurück, die den präferierten KI-Anwendungen einen hohen Bandbreitenhunger attestieren. Ein weiterer Eingriff an der Architektur ist ein größerer schneller Zwischenspeicher innerhalb der CUs (Local Data Share, LDS) auf 160 KByte. Mit dem größeren HBM-Speicher und der Überarbeitung der Speichervirtualisierung einher geht auch die Anpassung der sogenannten Universal Translation Caches, die ähnliche Aufgaben übernehmen wie die Translation Lookaside Buffer (TLBs) in Prozessoren. Der TLB enthält oft benutzte Zuordnungen von virtuellen zu physikalischen Adressen. Bei einem Speicherzugriff wird die Zuordnung zunächst im TLB gesucht, bevor Page Directory/Table konsultiert werden. Ist sie im Cache vorhanden, spricht man von einem „Hit“, ansonsten von einem „Miss“. Die Suche im TLB ist erheblich schneller als ein Zugriff auf die Page Table.
Der größte Unterschied ist aber der Aufbau der einzelnen Rechenwerke in den Compute Units. Denen hat AMD neue Datenformate spendiert, sodass die Matrixeinheiten jetzt außer FP8 (sowohl nach OCP-FP8- als auch OCP-MX-Spezifikation wie bei Nvidia) auch FP6 und FP4 beherrschen. Der Durchsatz der beiden neuen Formate ist dabei doppelt so hoch wie der des bekannten FP8 – bei Nvidias B200 erreicht FP6 nur FP8-Geschwindigkeit.
Dafür mussten speziell die dicken Multiplizierer der Matrixeinheiten bluten. Der Durchsatz mit FP64-Datenformaten, wie sie in KI-Anwendungen allerdings nicht vorkommen, wurde gegenüber den Vorgängerbeschleunigern halbiert. Damit folgt AMD auch hier Nvidias Marschrichtung, der FP64 schon länger bedeutend niedriger priorisiert. Die Vektoreinheiten, die den klassischen Shader-SIMDs in Grafikkarten ähneln, wurden beim MI350X/MI355X allerdings nicht angetastet.
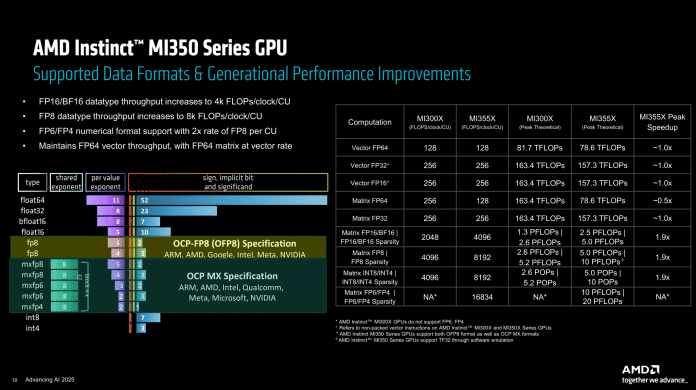
Durchsatz bei verschiedenen Datenformaten: Mit FP6 und FP4 läuft der MI350 zur Hochform auf.
(Bild: AMD)
Die kompletten Chips schaffen laut AMD daher nun einen Durchsatz von bis zu 20.000 TFLOPS bei dünn besetzten Matrizen („Sparsity“) mit FP6- oder FP4-Genauigkeit. Mit FP8 oder INT8 ist es noch die Hälfte, ebenso wie bei regulär besetzten Matrizen.
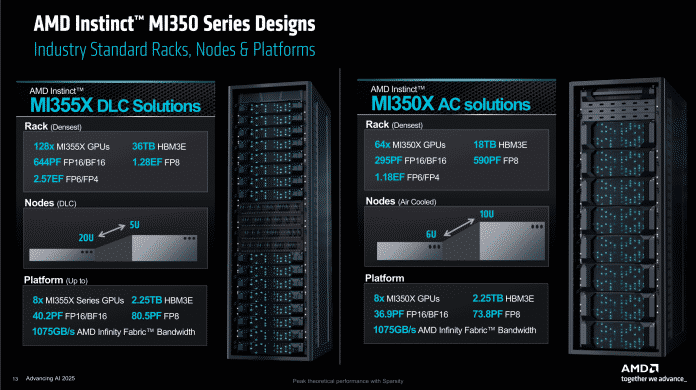
AMD will auch Racks mit MI350X anbieten.
(Bild: AMD)
„Helios“-KI-Racks und Ausblick auf MI400
AMD will mit MI355X und MI350X erstmals auch eigene KI-Racks spezifizieren. Die Basis bilden weiterhin UBB8-Formate, Universal Base Boards für acht Beschleunigermodule, die es von Partnern auch weiterhin geben wird. Neu sind die KI-Serverschränke mit bis zu 128 MI355X-Beschleunigern und Direct Liquid Cooling. Ein solcher Schrank soll dann 2,57 Exaflops an KI-Rechenleistung im FP6/FP4-Format schaffen und 36 TByte HBM3e-Speicher beherbergen. AMD betonte zudem erneut, dass die hauseigene Lösung komplett auf offene Standards wie OCP-UBBs oder Ethernet des Ultra-Ethernet-Consortiums setzt. Die Firma will sich damit von Nvidias proprietären Server-Racks mit NVLink differenzieren.
Der Nachfolger MI400 soll 2026 erscheinen und es mit dem dann erwarteten Vera Rubin von Nvidia aufnehmen, auch als Komplettlösung in neu entwickelten Helios-Racks analog zu Nvidias NVL72. AMD stellt für 72 MI400 rund 50 Prozent mehr HBM4-Speicherkapazität (31 TByte, addiert) und -Transferrate (1,4 PByte/s, addiert) sowie Scale-Out-Bandbreite (also der ins Netzwerk) in Aussicht. Einen Gleichstand erwartet die Firma bei FP4/FP8-Rechenleistung sowie bei der Scale-Up-Bandbreite der lokalen HBM-Kanäle.
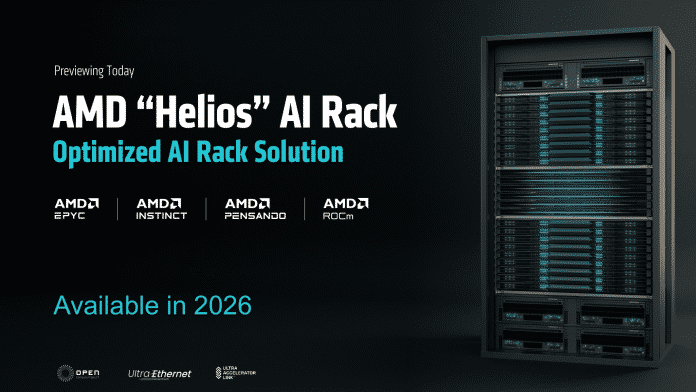
Helios heißen die Rack-Designs für die 2026 erwarteten Nvidia-Rubin-Konkurrenten MI400.
(Bild: AMD)
Ein einzelner MI400 soll die FP4-Leistung gegenüber MI355X auf 40 Petaflops (40.000 Teraflops, inkl. Sparsity) verdoppeln und 432 GByte HBM4-Stapelspeicher mit bis zu 19,6 TByte/s anbinden. Jede GPU wird mit 300 GByte nach außen doppelt so schnell kommunizieren können wie MI350X/355X. Wie hoch die Leistungsaufnahme dann sein wird, hat AMD nicht verraten, wohl aber in einem irreführenden Diagramm einen enormen Performancevorsprung suggeriert. Der wurde laut der Fußnoten offenbar auf Plattformbasis errechnet: 72 MI400 gegen acht MI355X, darum geben wir ihn hier auch nicht grafisch wieder.
(csp)
Künstliche Intelligenz
Maue Apple Intelligence: Apple will mit Milliarden das Steuer herumreißen
Milliardeninvestitionen, mögliche Übernahmen, mehr Fokus: Apple hat neue Details genannt, wie der Konzern bei Apple Intelligence und Siri aufholen will. KI sei eine der „tiefgreifendsten Technologien unserer Zeit“ und werde in alle Apple-Geräte, Plattformen sowie im ganzen Unternehmen integriert, betonte Apple-Chef Tim Cook in der Nacht auf Freitag gegenüber Finanzanalysten nach der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen.
Er stellte zugleich in Aussicht, dass der Konzern die Investitionen in diesem Bereich „signifikant“ steigern werde. Eine „beträchtliche Anzahl“ weiterer Mitarbeiter werde sich künftig obendrein auf KI-Funktionen konzentrieren, erläuterte Cook – „wir setzen unsere gesamte Energie dafür ein“.
Große KI-Aufkäufe eine Option
Für mögliche Übernahmen von KI-Firmen zeigte sich Apple zudem „sehr offen“. Das Unternehmen habe in diesem Jahr bereits mehrere kleine KI-Firmen gekauft, halte sich aber sämtliche Optionen offen. Größere Aufkäufe seien ebenfalls denkbar, wenn das letztlich „unsere Roadmap beschleunigt“, so Cook. Zugleich bekräftigte er, dass Apple in Hinblick auf die überfällige Weiterentwicklung des Sprachassistenzsystems Siri „gute Fortschritte“ mache. Die „persönlichere“ Version folge 2026. Apple hatte wichtige neue Siri-Funktionen ursprünglich schon für iOS 18 in Aussicht gestellt, musste die Einführung aber wegen Problemen aufschieben.
Apple hat bereits damit begonnen, seine Investitionsausgaben in eigene Rechenzentren für Private Cloud Compute – die Cloud-Komponente von Apple Intelligence – massiv hochzuschrauben. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres steckte Apple bereits knapp 9,5 Milliarden US-Dollar in eigene Infrastruktur – mehr als im gesamten vorausgehenden Geschäftsjahr. Von den riesigen „Capital Expenditures“ für KI, die Konkurrenten wie Microsoft und Google derzeit aufwenden, bleibt Apple damit aber noch meilenweit entfernt.
Die Investitionsausgaben des Konzerns werden sich „substanziell“ erhöhen, gab Apples Finanzchef dabei zu Protokoll. Er verwies zugleich nochmals darauf, dass Apple auf ein „Hybrid-Modell“ setzt und auch die Infrastruktur anderer Anbieter nutzt. Das ist etwa bei der Integration von ChatGPT der Fall.
Cook spielt KI-Hardware herunter
Apple Intelligence liefert inzwischen zwar eine Reihe an Basis-KI-Funktionen, hinkt der großen Konkurrenz aber deutlich hinterher – nicht zuletzt durch Apples vorsichtigeren und datensparsamen Ansatz. Für viel Unruhe unter Apple-Anlegern sorgte zuletzt die Ankündigung, dass ausgerechnet Apples Ex-Chefdesigner Jony Ive für OpenAI an neuer KI-Hardware feilt. Erste Produkte werden 2026 erwartet. Nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen versuchte der Apple-Chef nun, die Befürchtungen zu zerschlagen: Es sei schwierig, sich eine Welt ohne das – inzwischen drei Milliarden mal verkaufte – iPhone vorzustellen, so Cook. Neuartige KI-Geräte wären wohl ergänzend, aber „kein Ersatz“. Zudem denke auch Apple über solche „anderen Dinge“ nach.
(lbe)
Künstliche Intelligenz
Mastering Microservices 2025: Zukunftssichere Softwaresysteme
Der Architekturstil Microservices verspricht, Software modularer, schneller und leichter anpassbar zu machen – und ist daher aus der modernen Anwendungsentwicklung nicht mehr wegzudenken. Was sich im ersten Moment vorteilhaft anhört, hat in der praktischen Umsetzung jedoch auch seine Tücken. Die Herausforderungen von Microservices ergeben sich primär aus der höheren Komplexität verteilter Systeme. Genau an diesem Punkt setzt von iX und dpunkt.verlag am 16. Oktober 2025 organisierte Onlinekonferenz Mastering Microservices an.
Praxis-Know-how für moderne Microservices-Architekturen
Das Programm legt den Fokus auf zukunftssichere, polyglotte und nachhaltige Softwarearchitekturen. Erfahrene Experten teilen ihr Know-how dazu, wie sich die Herausforderungen verteilter Systeme in verschiedenen Programmiersprachen erfolgreich meistern lassen.
Das sind die Highlights des Programms:
- Project Leyden für Java-Performance: Moritz Halbritter (Broadcom) zeigt, wie Project Leyden die Problematik des langsamen Startups und hohen Ressourcenverbrauchs in Java-Anwendungen löst
- Jakarta EE für Cloud-native Microservices: Lars Röwekamp (Open Knowledge) demonstriert moderne Enterprise-Entwicklung mit Jakarta EE und MicroProfile
- KI-gesteuerte Orchestrierung: Martin Brandl und André Ratzenberger (white duck) stellen das innovative KI-Agenten-Framework Flock vor
- Vereinfachte Frontend-Entwicklung: Frederik Pietzko (IITS) erklärt, wie die Kombination von HTMX mit Kotlin hilft, der Komplexität von JavaScript entgegenzutreten
- Nachhaltige Microservices: Sascha Böhme (QAware) präsentiert Messtools und energieeffiziente Technologien
Moritz Halbritter (Broadcom)
In seinem Talk wirft Moritz Halbritter einen Blick auf die Details von Project Leyden: was steckt dahinter und wie funktioniert es . Er zeigt, wie sich JDK 24 und Spring Boot nutzen lassen, um den Speicherverbrauch zu reduzieren und die Startup-Zeit zu verbessern.
Lernen ohne Grenzen – Frühbucherrabatt sichern
Die Mastering Microservices ist das Online-Event für alle, die Verantwortung dafür übernehmen, dass Softwaresysteme effizienter, skalierbarer, sicherer und nachhaltig arbeiten. Teilnehmende profitieren neben den Experten-Talks auch von interaktiven Fragerunden per Chat und Video sowie dem Wissensaustausch mit anderen Teilnehmenden – und den im Nachgang verfügbaren Vortragsaufzeichnungen und Präsentationen.
Ab sofort sind Frühbuchertickets zum Preis von 249 Euro (alle Preise inkl. MwSt.) verfügbar. Teams ab drei Personen erhalten attraktive Gruppenrabatte. Alle Informationen und Tickets finden sich direkt im Shop auf der Konferenzwebsite.
Wer über den Fortgang der Konferenz Mastering Microservices auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der Website für den Newsletter registrieren oder den Veranstaltern auf LinkedIn folgen – der aktuelle Hashtag lautet #mms25.
(map)
Künstliche Intelligenz
Elektronische Fußfessel: Gesetzentwurf soll nach der Sommerpause kommen
Elektronische Fußfesseln nach „spanischem Modell“ für Gewalttäter könnten laut Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) schon im kommenden Jahr in ganz Deutschland eingeführt werden. Das erklärte sie gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Durch das „spanische Modell“ sollen insbesondere Femizide, Stalking, Gewalt und Bedrohungen etwa durch Ex-Partner verhindert werden. Die Innenministerinnen und Innenminister der Länder hatten die Einführung einer bundeseinheitlichen Regelung auf ihrer Frühjahrskonferenz im Juni gefordert.
Der konkrete Abstand zählt
Für das spanische Modell sind nicht feste Verbotszonen wie beim bisherigen Einsatz der Elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) für die Täter ausschlaggebend, sondern der Abstand zwischen Täter und Opfer ist maßgeblich. Feste Verbotszonen können beispielsweise den Wohnort oder den Arbeitsplatz von Opfern betreffen. Für das spanische Modell führt das Opfer eine GPS-Einheit mit sich und wird darüber informiert, wenn sich der Täter mit Fußfessel absichtlich oder auch unabsichtlich in seiner Nähe befindet. Sowohl das Opfer als auch die Polizei erhalten dann einen Warnhinweis. Hubig will dies Opfern aber nicht vorschreiben. Ihnen werde es „offengelassen, ob sie selbst ein Empfangsgerät bei sich führen wollen oder nicht.“
Hubig kündigte an, nach der Sommerpause einen Gesetzentwurf vorzulegen und skizzierte den weiteren zeitlichen Ablauf: „Realistisch ist, dass wir damit im Laufe des nächsten Jahres anfangen können. Das Gesetz muss nach seiner Verabschiedung noch durch die Länder in die Praxis umgesetzt werden. Die Länder arbeiten derzeit bereits mit Hochdruck an den Vorbereitungen der Umsetzung und dem Ausbau der notwendigen Kapazitäten. Es gibt schon die gemeinsame Überwachungsstelle der Bundesländer in Hessen.“
Nicht nur Fußfessel, auch Erhöhung des Strafrahmens
Nicht nur die Fußfesseln sollen Opfer besser schützen, auch sollen Gewaltschutzanordnungen im Kindschaftsrecht verankert werden, um auch Kinder „besser vor einem Gewalt ausübenden Elternteil zu schützen“. Und der Strafrahmen für Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz soll erhöht werden: „Von einer Geldstrafe oder höchstens zwei Jahren Freiheitsstrafe wie bislang auf eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe, damit die Anordnungen mehr Wirksamkeit bekommen.“ Zusätzlich soll „zum Beispiel die Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Training verpflichtend angeordnet werden können“, sagte Hubig der SZ.
Seit Anfang dieses Jahres wird eine Fußfessel nach spanischen Modell bereits in einem Fall in Deutschland angewandt. Das Justizministerium Hessen berichtete im Januar, dass die Ex-Frau eines Täters, der bereits eine Haftstrafe verbüßt hat, in Sachsen auf diese Weise geschützt wird. Dem hessischen Justizminister Christian Heinz (CDU) und der sächsischen Justizministerin Constanze Geiert (CDU) zufolge, „[sprechen] die Erfolge in Spanien für sich“. Hessen hat Fußfesseln der neuen Generation, mit der das spanische Modell umsetzbar ist, 2024 eingeführt. In dem westdeutschen Bundesland ist auch die Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL) angesiedelt. Ihre Aufgabe ist die Überwachung der Fußfesselträger. Sie nimmt die Ereignismeldungen rund um die Uhr entgegen und bewertet sie im Hinblick auf möglicherweise notwendige Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder der Führungsaufsicht. Die GÜL soll zukünftig mehr Mittel erhalten, um für die geplanten Gesetzesänderungen gewappnet zu sein. Auch das erklärten die Innenministerinnen und Minister im Juni in Bremerhaven auf ihrer Frühjahrskonferenz.
(kbe)
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 Online Marketing & SEOvor 2 Monaten
Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat
Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen
-

 Digital Business & Startupsvor 1 Monat
Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten















