Künstliche Intelligenz
Jurassic World: Wiedergeburt? Was soll schon schiefgehen
„Was soll schon schiefgehen“ steht am Anfang zahlloser Monster- und Katastrophenfilme. Menschliche Hybris und die Missachtung mahnender Stimmen sind die Zutaten, aus denen Desaster entstehen. Das gilt insbesondere für Jurassic Park und zieht sich durch die inzwischen sieben Filme mit wechselnder menschlicher Besetzung, die das Franchise hervorgebracht hat.
Den ersten Auftritt der Dinosaurier in Steven Spielbergs Blockbuster von 1993 hatte ein schrulliger Milliardär zu verantworten, der es für eine gute Idee hielt, die glücklicherweise inzwischen ausgestorbenen Riesenmonster zu klonen und in einem Freizeitpark auszustellen. Auf den Skeptiker will niemand hören. Wir alle wissen, wie das ausgegangen ist.
Mehr als dreißig Jahre und sechs Filme weiter können wir festhalten: Die menschliche Spezies hat nur eine begrenzte Kapazität, aus ihren Fehlern zu lernen. Sonst würden die Protagonisten, die dieses Franchise in wechselnder Besetzung bevölkern, nicht immer wieder dieselben dummen Fehler machen. Was soll schon schiefgehen?
Nun also die Wiedergeburt. Die gab es schon mal bei einem anderen sehr populären Horror-Franchise – und ist bei den Fans nicht besonders gut angekommen. Tatsächlich hat „Jurassic World Rebirth“ stellenweise mehr mit „Alien: Resurrection“ gemeinsam als nur den deutschen Verleihtitel. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kompliment.
„Jurassic World – Die Wiedergeburt“ nimmt die Geschichte fünf Jahre nach „Jurassic World: Dominion“ wieder auf. Dinosaurier leben auf der Erde nur noch in einer Zone um den Äquator, vereinzelte Exemplare auch noch in menschlichen Siedlungsräumen. Doch den Dinos geht’s nicht gut – wer hätte auch ahnen können, dass das heutige Erdklima für die Raubriesen der Kreidezeit vielleicht etwas zu kalt ist.
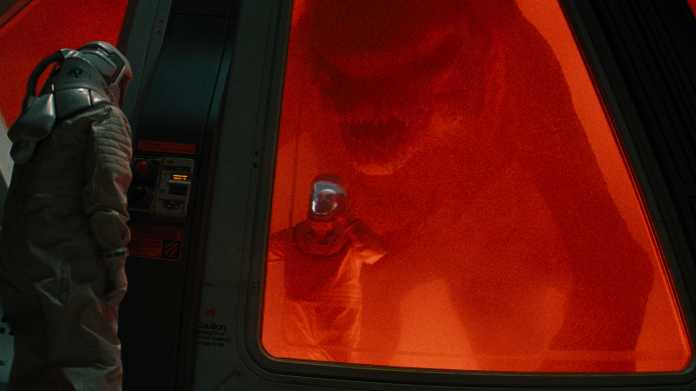
Genetische Experimente an Dinosauriern? Was soll schon schiefgehen.
(Bild: Universal Studios)
Ein paar Exemplare leben noch auf einer kleinen Insel im Pazifik. Darunter solche, die es eigentlich nicht geben dürfte: Sie sind das Ergebnis genetischer Experimente, mit denen skrupellose Wissenschaftler immer neue Attraktionen für den Freizeitpark züchten wollten. Zurückgeblieben sind die, die „zu hässlich oder zu gefährlich“ sind. Was soll schon schiefgehen.
Und so nimmt die Wiedergeburt ihren Lauf: Irgendein Pharma-Konzern hält es für eine prima Idee, aus der DNA einiger Dinosaurier wertvolles Genmaterial zu gewinnen, um Krebs zu heilen oder sowas. Leider funktioniert das nur, wenn man die Proben vom lebenden Exemplar nimmt.
Also heuert der natürlich völlig skrupellose Pharmamanager (Rupert Friend) einen Wissenschaftler (Jonathan Bailey) und ein paar Söldner (Scarlett Johansson, Mahershala Ali) an, die auf die verbotene Insel fahren, um die Proben zu nehmen. Was soll schon groß schiefgehen.
Schief geht erstmal der Segeltörn eines verantwortungslosen Vaters (Manuel Garcia-Rulfo) mit seinen Töchtern, von denen eine noch ihren kiffenden Freund im Schlepptau hat. Von den Söldnern aus der Seenot gerettet, landen alle zusammen auf der Insel mit den Dino-Mutanten. Ab da geht dann noch so einiges schief.
Jurassic Park ist ein Franchise, das alle paar Jahre dieselbe Geschichte erzählt – und damit sehr erfolgreich ist: Die letzten drei Filme der Reihe haben weltweit jeweils über eine Milliarde Dollar eingespielt. Die Dinos ziehen alte und neue Fans in Scharen ins Kino. Und auch „Jurassic World – Die Wiedergeburt“ liefert im Dino-Department verlässlich ab.
Dass sich alle Protagonisten meistens ziemlich idiotisch benehmen und deshalb auf dem Speiseplan der Inselbewohner landen, gehört dazu. Dennoch wirkt dieser siebte Aufguss ziemlich lustlos: Mehr als ein paar alte Klischees sind Drehbuchautor David Koepp (der auch die ersten zwei Teile geschrieben hat) für seine Geschichte und ihre Figuren nicht eingefallen.

Der Wissenschaftler und Scarlett Johansson im Dschungel.
(Bild: Universal Studios)
Und dann ist da noch Scarlett Johansson. Wir sehen, wie sie als „tough cookie“ entschlossen durch den Dschungel stapft und den Tag rettet. Irgendwie bleibt sie dabei immer Scarlett Johansson im Dschungel und schafft es nicht, hinter ihre Rolle zurückzutreten. Man muss ihr zugestehen, dass das Drehbuch ihr nicht viel Raum zur Entfaltung lässt, aber ihre schauspielerische Bandbreite ist nun mal begrenzt.
Jurassic World – Die Wiedergeburt bleibt mit 130 Minuten zeitlich im Rahmen für so einen Blockbuster – und ist trotzdem stellenweise langatmig. Das liegt vor allem an der gestrandeten Seglerfamilie, deren einzige Funktion zu sein scheint, nervige Kids und trotzige Teenies in die Geschichte einzuführen. Das ist die kalte Verwertungslogik Hollywoods: Jede Zielgruppe muss sich angesprochen fühlen. Das Millarden-Boxoffice gibt ihnen Recht.
Das alles ist ein bisschen schade, denn irgendwo unter dieser hochglanzpolierten Blockbuster-Oberfläche steckt ein gradliniger kleiner Monsterfilm – etwa einer ganz ohne nervige Teenies. Regisseur Gareth Edwards hat mit „Monsters“ schon einen eigenwilligen Genrebeitrag sowie einen soliden „Godzilla“ abgeliefert. Vielleicht hätte er mit einem besseren Drehbuch und weniger wirtschaftlichem Druck mehr zu diesem Franchise beitragen können.
Am Ende bleibt die Erkenntnis: Manchmal sollte man sie einfach ruhen lassen. Das gilt für ausgestorbene Riesenraubtiere ebenso wie für überalterte Hollywood-Franchises.
„Jurassic World – Die Wiedergeburt“ ist ab dem 2. Juli im Kino.
(mack)
Künstliche Intelligenz
US-Regierung nimmt Chinas Technologiesektor ins Visier
Die Vereinigten Staaten verschärfen den Handelskrieg gegen China. Die US-Regierung von Donald Trump kündigte an, gegen Unternehmen vorzugehen, die sie als Risiko für die nationale Sicherheit einstuft. Hunderte chinesische Unternehmen sind demnach von Sanktionen bedroht. Denn nach einer neuen Regelung unterliegen künftig auch Tochterfirmen von Unternehmen, die auf einer als „Entity List“ bekannten schwarzen Liste des US-Handelsministeriums stehen, Handelsbeschränkungen. Das berichtete am Montag die US-Tageszeitung Wall Street Journal.
Dem Bericht zufolge soll auf diese Weise eine Lücke geschlossen werden, die es Unternehmen nach Ansicht Washingtons ermöglicht, Tochtergesellschaften zu gründen, um die Sanktionen der Entity List zu umgehen. Unternehmen, deren Mehrheitseigentümer auf der Liste stehen, unterliegen künftig ebenfalls den gleichen Beschränkungen.
Die neue Vorschrift schließe eine „erhebliche Lücke“ und stärke „damit das Exportkontrollsystem insgesamt“, schreibt das zuständige Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums auf seiner Webseite. Jeffrey I. Kessler, Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit im US-Handelsministerium, erklärte: „Zu lange haben Schlupflöcher Exporte ermöglicht, die die nationale Sicherheit und die außenpolitischen Interessen der USA untergraben. Unter dieser Regierung schließt das BIS diese Schlupflöcher und stellt sicher, dass die Exportkontrollen wie vorgesehen funktionieren.“ Die Regelung soll am Dienstag offiziell im Federal Register veröffentlicht werden und am selben Tag in Kraft treten.
Maßnahmen gegen Chinas Technologiesektor
Die Änderung ist laut Wall Street Journal eine weitreichende Maßnahme, die potenziell Tausende Unternehmen weltweit betrifft; Hauptziel aber dürfte Chinas Technologiesektor sein. Chinesische Unternehmen wie Huawei hätten zahlreiche Tochterunternehmen, was es für die USA schwierig mache, sie vollständig von US-amerikanischer Technologie abzuschneiden. Die nun vorgenommenen Ergänzungen der Entity List aber könnten US-Unternehmen belasten, die für Rohstoffe oder Komponenten auf chinesische Firmen angewiesen sind, und Lieferketten stören, so die Zeitung weiter. Viele US-amerikanische Unternehmen werden nun gezwungen sein, ihre Geschäftspartner genauer unter die Lupe zu nehmen, um sicherzustellen, dass sie die neue Regelung einhalten. Das werde voraussichtlich zu einem Anstieg der Compliance-Kosten führen, schreibt das Blatt. Geschäfte mit Unternehmen auf der Entity List sind unter Bedingungen weiter möglich. Dafür müssen Unternehmen Lizenzen beantragen und genehmigen lassen, wobei einige allgemeine Lizenzen für 60 Tage genehmigt würden, um den Unternehmen Zeit für Anpassungen zu geben, so die US-Regierung.
In der Vergangenheit hat Washington bereits weitreichende Exportbeschränkungen für besonders schnelle KI-Chips von US-Chipherstellern wie Nvidia nach China erlassen. Vor einigen Wochen erteilte Washington zwar erste Genehmigungen für den Export von Nvidias H20-Beschleunigern nach China, aber gerade der Halbleitersektor steht wegen Trumps Zollpolitik weiter unter Druck. Die US-Regierung versucht, China im Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) von US-Technologie abzuschneiden.
Die Ausweitung der Sanktionsliste kommt nur wenige Tage, nachdem Washington und Peking eine Vereinbarung im Streit um ein drohendes TikTok-Verbot in den USA erzielt haben und könnte die laufenden Handelsgespräche zwischen beiden Seiten erschweren. Die Trump-Regierung hat bereits Dutzende chinesische Unternehmen auf die Entity List gesetzt. Überdies hat sie Anfang des Jahres US-Unternehmen aufgefordert, keine Chips von Huawei zu verwenden. China wiederum hat kürzlich mehrere US-Firmen sanktioniert und die Ausfuhr seltener Erden eingeschränkt.
(akn)
Künstliche Intelligenz
Elektronische Patientenakte: So funktioniert die ePA für Versicherte
Seit spätestens Mitte Februar verfügt jeder gesetzlich Versicherte, der nicht widersprochen hat, über eine elektronische Patientenakte. Gesetzliche Krankenkassen sind bereits seit 2021 dazu verpflichtet, ihren Kunden eine elektronische Patientenakte anzubieten. Weil sie jedoch kaum genutzt wurde, haben sie jetzt fast alle automatisch erhalten.
Daten- und Verbraucherschützer fordern zum Pflichtstart für Ärzte und Apotheker erneut, dass Versicherte wieder einstellen können, wer welche Daten sieht. Kassenärzte und Verbraucherschützer drängen zudem auch darauf, dass Abrechnungsdaten nicht automatisch für alle, sondern nur für die Versicherten selbst einsehbar sind.
Um selbst zu sehen, welche Daten in der ePA-Akte hinterlegt und für alle sichtbar sind und auch, um selbst Daten zu speichern oder zu löschen, benötigen Versicherte die ePA-App ihrer Krankenkasse. Wir haben erste Funktionen der App getestet, die sich noch im Aufbau befindet.
Privat Versicherte müssen sich aktiv für eine ePA-App entscheiden, sofern es bei ihrer Krankenkasse die Möglichkeit gibt. Bis Ende des Jahres wollen auch die meisten privaten Versicherungen diese Möglichkeit anbieten.
Hinweis: Dieser Ratgeber wird bei neuen Erkenntnissen aktualisiert. Es kann sein, dass Ihre App manche hier aufgeführten Funktionen nicht bereitstellt. Immer wieder gibt es auch Einschränkungen im Betrieb und teilweise unfertige Funktionen innerhalb der Apps.
Was benötige ich, um die elektronische Patientenakte zu nutzen?
Um die elektronische Patientenakte zu nutzen, benötigen Sie entweder Ihren Personalausweis samt sechsstelliger PIN oder die Gesundheitskarte samt PIN. Auch mit dem Reisepass ist eine Anmeldung möglich. Ferner benötigen Sie ein NFC-fähiges Smartphone samt der ePA-App, die von Ihrer Krankenkasse angeboten wird. In der Regel funktioniert die App ab Android-Version 8.1 oder iOS 15, das hängt aber von der Software Ihrer jeweiligen Krankenkasse ab. Patientenakten von Personen unter 15 Jahren müssen von deren Erziehungsberechtigten verwaltet werden. Wichtig ist auch aus Sicherheitsgründen, die richtige App der Krankenkasse herunterzuladen, die auf der Website der Gematik, aber auch auf den meisten Websites der jeweiligen Krankenkassen zu finden ist.
Fast alle Krankenkassen bieten die elektronische Patientenakte als eigene App an, die Techniker Krankenkasse hat die Patientenakte in ihre allgemeine Service-App integriert. Nach dem Download müssen sie sich eine GesundheitsID erstellen. Bei manchen Krankenkassen wie Die Techniker oder bei der App der 11 AOKen ist eine weitere Ident-App zur Nutzung der GesundheitID nötig. Für den Anmeldeprozess können Sie wählen, ob sie diesen mit dem elektronischen Personalausweis samt PIN oder der Gesundheitskarte samt PIN durchlaufen wollen. Die jeweilige Karte müssen Sie für die Anmeldung an die NFC-Schnittstelle Ihres Smartphones halten. Wird die Karte erkannt, ist das in der Regel in der App sichtbar, dann müssen Sie einen Moment warten.
Die GesundheitsID muss in der Regel nach sechs Monaten erneuert werden. Für den erneuten Login nach der Erstanmeldung können Sie zwischen Biometrie, beispielsweise Ihrem Fingerabdruck, dem Personalausweis mit PIN oder der Gesundheitskarte samt PIN wählen.
Kann ich Daten aus der Vergangenheit in die ePA laden?
Krankenkassen sind verpflichtet, einen Teil der Dokumente in Ihre App zu laden. Falls Sie die Krankenkasse gewechselt haben, können Sie die Daten aus Ihrer bisherigen Patientenakte exportieren, dazu fragen Sie aber am besten bei Ihrer Krankenkasse nach.
Kann ich die E-Rezepte in der ePA-App speichern?
Ja, Krankenkassen wie die AOK oder Die Techniker erlauben das direkte Speichern von E-Rezepten in der elektronischen Patientenakte, allerdings können Versicherte Dokumente auch selbst in der App hochladen, zulässig sind PDF, JPEG, PNG und TIFF, die anschließend in PDF-Dateien umgewandelt werden.
Wie lade ich Daten in die ePA?
Sobald Sie in Ihrer Patientenakte eingeloggt sind, können Sie beispielsweise über ein „+“-Symbol ein Foto aus einer Galerie oder ein PDF-Dokument hochladen oder ein Foto schießen und hinzufügen. Das kann je nach Krankenkasse variieren. Die Dateigröße darf 25 MByte nicht überschreiten, davon können Sie aber so viele Dateien hochladen, bis Sie von Ihrer Krankenkasse kontaktiert werden. Dann können Sie das Dokument um weitere Angaben ergänzen, etwa den Dateinamen ändern oder eintragen, wer das Dokument erstellt hat – dazu kann neben dem Namen auch das jeweilige Fachgebiet, die Rolle, E-Mail-Adresse und Ähnliches angegeben werden. Zudem lassen sich Angaben zur behandelnden medizinischen Einrichtung ergänzen.
Kann ich die Daten aus meiner digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) importieren?
Das sollte funktionieren. Dazu können Sie in Ihrer ePA-App eine DiGA auswählen, mit der Sie Ihre ePA verbinden wollen. Anschließend können Sie die Verbindung auch wieder auflösen.
Gelangen die Abrechnungsdaten automatisch in meine ePA?
Ja, allerdings können Sie das in Ihrer App auch abstellen und jederzeit wieder einstellen.
Welche Daten werden von mir erfasst?
In der ePA können verschiedene Gesundheitsdaten erfasst werden, darunter Diagnosen, Befunde und weitere medizinische Informationen. Manche Ärzte können auch Eintragungen im Zahnbonusheft vornehmen, das hängt von der Software des Arztes ab. Auch der Mutterpass und das U-Untersuchungsheft für Kinder sollen befüllt werden. Welche konkreten Daten erfasst werden, hängt auch davon ab, welche Informationen die behandelnden Ärzte eintragen. Bei besonders heiklen Daten, etwa zur psychischen Gesundheit, soll der Arzt vorher eine Einwilligung einholen, andere Daten sollen automatisch befüllt werden. Notfalldaten lassen sich ebenfalls hinterlegen, allerdings ist das beispielsweise auch über die elektronische Gesundheitskarte möglich. Darüber hinaus können Versicherte selbst Daten hochladen und sie ihren Ärzten zur Verfügung stellen.
Welche Vertraulichkeitsstufen kann ich bei der ePA einstellen?
Sie können mit der neuen ePA nur noch zwischen „Zugriff erlauben“ und „Zugriff verbieten“ wählen – bei letzterem ist das Dokument nur für einen selbst sichtbar. Sie können aber auch einzelne Ärzte von Ihrer ePA ausschließen oder Dokumente löschen.
Sind meine Abrechnungsdaten automatisch für alle sichtbar?
Ja. Sie können aber auch einstellen, dass Ihre Abrechnungsdaten nicht in die ePA eingestellt werden. Dennoch können standardmäßig alle Zugriffsberechtigten diese Daten sehen.
Erhält der Arzt automatisch die Erlaubnis zum Speichern von Daten in der ePA?
Der Arzt erhält automatisch mit dem Stecken der elektronischen Gesundheitskarte eine Erlaubnis, Daten in der ePA zu sehen und zu speichern. Aktuell können Ärzte die ePA freiwillig nutzen, ab Oktober sind sie verpflichtet. Sobald die technischen Voraussetzungen stimmen, müssen sie Daten in die ePA speichern. Nur bei besonders heiklen Daten sollen Ärzte nachfragen, bevor diese zentral gespeichert werden.
Perspektivisch sollen die Daten automatisch aus den Praxisverwaltungssystemen in die ePA und künftig auch an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit gelangen, wo Pharmaunternehmen und Forscher – je nach Zweck – Zugang zu einem Teil der Daten aus der ePA erhalten. Speziell, wenn es sich um besonders sensible Daten handelt, muss der Arzt aber immer nachfragen. Bereits jetzt werden viele Daten ohne Zustimmung der Patienten an Dritte weitergegeben. Die Abrechnungsdaten der Krankenkassen werden beispielsweise pseudonymisiert an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit übermittelt, das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelt ist.
Weiterhin bestehen Meldepflichten, etwa beim Krebsregister – einem von mehr als 400 medizinischen Registern. In Zukunft sollen möglichst viele Daten an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit gehen und perspektivisch auch in einem europäischen Gesundheitsdatenraum auf Anfrage zur Verfügung stehen.
Wie lange können Ärzte und Apotheker auf die ePA zugreifen?
Standardmäßig können Ärzte 90 Tage lang auf die ePA zugreifen, allerdings können Versicherte den Zugriff auch beliebig einstellen. Apotheker haben standardmäßig drei Tage lang Zugriff und auch das lässt sich beliebig einstellen.
Daten können nur diejenigen sehen, die auch berechtigt sind. Die Berechtigung wird in der Regel durch das Stecken der elektronischen Gesundheitskarte erteilt. Alternativ können Sie zum Beispiel selbst eine Praxis oder eine Apotheke für den Zugriff berechtigen. Wer einen detaillierten Überblick über die Zugriffsberechtigungen erhalten möchte, findet diese bei der für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständigen Gematik. Die meisten Rechte haben in der Regel Ärzte.
Kann ich sehen, wer auf die ePA zugegriffen hat?
Ja, in der ePA-App können Sie sehen, welche Einrichtung auf die Daten zugegriffen hat. Dazu können Sie etwa unter Zugriffen verschiedene Protokollarten einsehen. So können Sie nicht nur sehen, welche Praxis zugegriffen hat, sondern auch, wann Anmeldungen in Ihrer Akte erfolgten und wann Daten exportiert oder weitergeleitet wurden. Da auch Ihre eigenen Aktivitäten protokolliert werden, kann das Ganze etwas unübersichtlich werden. Ab 2030 soll zudem auch protokolliert werden, welche Person Ihre Daten gelesen hat.
Werden meine Daten automatisch für die Forschung freigegeben?
Bisher nicht. Die Pläne zur Datenweitergabe an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit wurden weiter verschoben. In Zukunft sollen Patienten dann beispielsweise in ihrer ePA-App darüber informiert werden, dass ihre Daten der Forschung zur Verfügung stehen – sofern sie dem nicht widersprechen.
Kann jemand anders die ePA für mich verwalten?
Versicherte können bei den Ombudsstellen ihrer Krankenkassen einen Vertreter auswählen, diesem dort aber auch wieder die Rechte entziehen. Bei Jugendlichen bis 15 Jahren ist es ohnehin so, dass diese ihre ePA nicht selbst verwalten können. Das müssen die Erziehungsberechtigten übernehmen. Auch über die ePA-App ist es möglich, Daten für andere, beispielsweise für Kinder, zu verwalten.
Wie kann ich die Vertreterregelung einrichten?
Falls die Person, die Sie vertreten wollen, bereits über eine ePA-App verfügt, können Sie in Ihrer Krankenkassen-App etwa unter „Weitere Dienste“ die „Vertretung für Angehörige“ auswählen und sich als Vertretung in einer anderen Akte anmelden. Dafür müssen Sie eine Person hinzufügen und den Namen, die Versichertennummer und bei welcher Krankenkasse die Person versichert ist, angeben. Die zu vertretende Person muss Sie in Ihrer App als Vertreter hinterlegen. Das ist bei manchen Krankenkassen in der elektronischen Patientenakte direkt unter „Zugriffe“ möglich. Dann muss die Person bestätigen, dass Sie eine Vertretung anlegen möchte und den Namen, die Versichertennummer und eine E-Mail-Adresse des Vertreters eingeben. Für jede Person können bis zu fünf Vertreter hinterlegt werden. Aktuell gibt es jedoch bei manchen Krankenkassen eine Störung, wodurch die Vertreterfunktion für einen Teil der Krankenkassen nicht funktioniert.
Falls die Person keine ePA-App nutzt, können Sie zum Beispiel unter „Weitere Dienste“ eine „Vertretung für Angehörige“ einrichten. Falls das funktioniert, benötigen Sie allerdings die Gesundheitskarte samt PIN der zu vertretenden Person und müssen sich so anmelden, wie Sie es möglicherweise zu Beginn bei Ihrer eigenen Akte getan haben. Zuerst geben Sie die Zugangsnummer der Karte ein und dann die PIN der Gesundheitskarte. Dazu benötigen Sie die Versichertennummer, die Postleitzahl und die sechsstellige Kartenzugangsnummer (Card Access Number, CAN). Danach müssen Sie auch die Daten des Vertreters eintragen.
Digital Health abonnieren
Alle 14 Tage bieten wir Ihnen eine Übersicht der neuesten Entwicklungen in der Digitalisierung des Gesundheitswesens und beleuchten deren Auswirkungen.
E-Mail-Adresse
Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kann ich die elektronische Patientenakte auch in der Desktop-Version nutzen?
Inzwischen sollte das bei allen gesetzlichen Krankenkassen wieder möglich sein. Der Funktionsumfang ist allerdings eingeschränkt.
Kann ich die elektronische Patientenakte auch ohne Smartphone nutzen?
Ja, sofern Sie über ein Kartenlesegerät verfügen.
Was mache ich, wenn ich mich in meiner ePA nicht anmelden kann?
Meistens hilft es abzuwarten, die App neu zu starten oder den Cache zu löschen. Falls Sie den Verdacht haben, dass jemand Unbefugter auf Ihre ePA zugreift, können Sie bei Ihrer Krankenkasse um die Sperrung Ihres Zugangs bitten. Vereinzelt haben Krankenkassen dafür extra Hotlines eingerichtet. Allerdings kann das Gefühl, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, auch bei der Anmeldung in manchen Krankenkassen-Apps auftreten.
Wenn Sie sich über Störungen der Telematikinfrastruktur informieren möchten, können Sie das über den WhatsApp-Kanal der Gematik machen. Dort wird angezeigt, ob die ePA Ihrer Versicherung gestört ist – etwa aufgrund von Wartungsarbeiten.
Spart mir die ePA den Gang zu verschiedenen Ärzten?
Die ePA ersetzt nicht den Arztbesuch, aber sie kann dazu beitragen, dass Informationen schneller übermittelt werden, was eventuell einige unnötige Besuche oder Untersuchungen vermeiden kann. Zudem müssen Versicherte bisher noch alle drei Monate zum Arzt, um ihre Gesundheitskarte einlesen zu lassen. Das soll sich in Zukunft ändern. Für Folgerezepte kann die E-Rezept-Funktion in der ePA, sofern vorhanden, allerdings praktisch sein.
Welche Vorteile soll die elektronische Patientenakte bieten?
Alle für die Behandlung relevanten medizinischen Informationen wie Befunde, Diagnosen, Impfungen und das Zahnbonusheft können zentral gespeichert werden, was die Koordination zwischen verschiedenen Ärzten erleichtern kann. Ärzte sollen schneller und einfacher auf wichtige Informationen zugreifen können, was die Behandlung effizienter und sicherer macht. Die Medikationsliste soll beispielsweise helfen, die Arzneimitteltherapiesicherheit zu erhöhen.
Welche Funktionen hat die elektronische Patientenakte noch?
Es gibt noch weitere Funktionen in der ePA-App, beziehungsweise den Apps, in denen auch der Zugang zur ePA möglich ist. Versicherte können etwa mit Ihrer ePA-App eine Erklärung zur Organspende im Online-Portal abgeben. Zudem können auch Einträge zu Impfungen vorgenommen werden. Ebenso ist beispielsweise das Informationsportal des Gesundheitsministeriums „gesund.bund.de“ verknüpft. Zusätzlich können Sie in vielen ePA-Apps der Krankenkassen den TI-Messenger TIM nutzen. Künftig werden noch weitere Angebote hinzukommen, auch KI-Agenten wurden bereits angekündigt.
Kann ich der ePA widersprechen?
Ja, Sie können der ePA widersprechen. Sie können aber beispielsweise auch dagegen widersprechen, dass die elektronische Medikationsliste automatisch erstellt wird. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie jederzeit wieder zustimmen.
Woher weiß ich, ob mein Widerspruch gegen die elektronische Patientenakte funktioniert hat?
Sie können bei Ihrer Krankenkasse oder deren eigens für solche Zwecke eingerichtete Ombudsstelle nachfragen, ob Sie eine ePA haben. Alternativ können Sie sich auch die ePA-App der Krankenkasse herunterladen, wofür Sie jedoch ebenfalls eine GesundheitsID erstellen müssen. Dafür benötigen Sie die Gesundheitskarte samt PIN oder den Personalausweis samt PIN.
Kann ich die ePA einfach löschen?
Ja, Sie können die ePA jederzeit löschen, allerdings werden die Akten nicht bei jeder Krankenkasse unverzüglich gelöscht.
Update
29.09.2025,
20:22
Uhr
(mack)
Künstliche Intelligenz
Top 10: Der beste Offroad-E-Scooter – Segway Ninebot Max G3 D ist Testsieger
Epowerfun EPF-Pulse
Der Epowerfun EPF-Pulse ist ein vollgefederter E-Scooter mit starkem Motor, großem Akku, Blinker vorn und hinten sowie toller Verarbeitung. Wir testen, ob er hält, was das Datenblatt verspricht und für wen sich der Kauf lohnt.
- Vollfederung, Motor, Bremse
- Blinker vorn und hinten, 140 kg Zuladung, Diebstahlschutz
- variable Akkukapazität bis zu 960 Wh
- Aufhängung des Frontlichts wirkt zerbrechlich
- Display bei Sonne schwer ablesbar
Epowerfun EPF-Pulse im Test
Der Epowerfun EPF-Pulse ist ein vollgefederter E-Scooter mit starkem Motor, großem Akku, Blinker vorn und hinten sowie toller Verarbeitung. Wir testen, ob er hält, was das Datenblatt verspricht und für wen sich der Kauf lohnt.
Bei über 65 getesteten E-Scootern haben wir festgestellt, dass die elektrischen Tretroller immer besser werden. Immer mehr Modelle kommen mit Federung vorn und hinten, starken Motoren, guten Lichtanlagen, Blinkern, hochwertiger Verarbeitung und leistungsfähigen Bremsen daher. Auch der Epowerfun EPF-Pulse mit Straßenzulassung bildet hier keine Ausnahme. Bereits in der Vergangenheit konnten uns E-Scooter des Herstellers überzeugen.
Dazu zählt etwa der Epowerfun EPF-1 Pro (Testbericht), der mit seinem starken Motor und der hohen Reichweite punktet, allerdings ohne Luftreifen auskommen muss. Der Epowerfun EPF-2 XT (Testbericht) bessert an vielen Stellen nach. Auch er überzeugt mit kräftigem Antrieb und großem Akku, bietet darüber hinaus aber Luftbereifung und einen Blinker am Lenker. Ebenfalls hervorragend gefiel uns der Epowerfun EPF-2 City (Testbericht), dessen größter Nachteil das Fehlen einer Federung an Vorder- und Hinterrad war.
Hier setzt der Epowerfun EPF-Pulse an, den wir in diesem Testbericht genauer unter die Lupe nehmen. Er verfügt nämlich über eine Vollfederung und bietet darüber hinaus viele weitere sinnvolle Features. Dabei kommt er in drei Varianten, welche sich lediglich in der Akkukapazität und damit einhergehend, im Gewicht und Preis unterscheiden. Folgende Varianten zeigt Epowerfun:
Ob er die hohen Erwartungen erfüllen kann, die das vielversprechende Datenblatt weckt, soll dieser Test klären.
Versicherung
Für E-Scooter gibt es eine Haftpflicht-Versicherungspflicht, aber auch andere Versicherungen können wichtig sein. Selbst die vorsichtigsten Fahrer können die Gefahr eines Unfalls nie zu 100 Prozent ausschließen. Wir empfehlen deshalb Zusatzversicherungen, um die möglichen negativen Konsequenzen abzumildern.
Bei vielen Versicherungen lohnt sich das Vergleichen wirklich. Denn wer regelmäßig vergleicht, spart gut und gerne mehrere hundert Euro im Jahr. Wo man am meisten spart, zeigen die Tarifrechner von heise online.
Highlights am Epowerfun EPF-Pulse
- Federung vorn und hinten
- starker Motor
- Akku mit bis zu 960 Wh
- helle Lichtanlage mit Blinker vorn und hinten
- hochwertige Verarbeitung
- Scheibenbremsen an beiden Rädern
- selbstheilende, schlauchlose 10-Zoll-Reifen
- hohe Zuladung von 140 kg
- NFC-Wegfahrsperre
Aufbau: Kaum Kunststoff bei der Verpackung
Schon beim Auspacken punktet Epowerfun mit dem Verzicht auf unnötiges Plastik. Der EPF-Pulse ist fast komplett in Pappe und Papier gewickelt – vorbildlich, da deutlich umweltverträglicher als die sonst üblichen Kunststoffe. Nach dem Auspacken muss nur noch der Lenker mit wenigen Schrauben befestigt werden. Ein abschließender Rundum-Check, bei dem alle Schrauben auf festen Sitz und die Reifen auf den korrekten Luftdruck geprüft werden, ist wie bei allen E-Scootern ratsam. Dann steht der ersten Fahrt nichts mehr im Wege – am Besten mit Helm. Smarte Empfehlungen dazu finden sich in unserer Bestenliste Top 7: Der beste smarte Fahrradhelm.
Epowerfun EPF-Pulse Bilder
Optik: Wie gut schaut der Epowerfun EPF-Pulse aus?
Optisch zeigt sich der Epowerfun EPF-Pulse im dezenten Matt-Grau mit blauen Akzenten an Vorderradaufhängung und Lenkerlager. Die filigran, aber robust wirkende Vorderradfederung sticht optisch positiv ins Auge. Auch der Aufbau am Heck mit erhöhtem Trittbrett zum Schutz des Schutzblechs vor versehentlichen Tritten wirkt durchdacht und bietet bei Bedarf einen komfortablen Abstellplatz für den hinteren Fuß. Auffällig unauffällig verläuft die Kabelführung – es sind lediglich die beiden Bremszüge sichtbar, die von den Bremsgriffen in die Lenkstange führen.
Qualität: Ist der Epowerfun EPF-Pulse robust?
Qualitativ macht der E-Scooter einen hochwertigen Eindruck. Die Lenkstange sitzt bombenfest und wackelt nicht, die massiven Schutzbleche sollten auch einen versehentlichen Tritt problemlos wegstecken. Einzig die Befestigung des Frontlichts wirkt ein wenig fragil, dafür sind die Blinker am Heck vorbildlich stabil angebracht. Mit einer Zuladung von bis zu 140 kg ist der EPF-Pulse auch für schwerere Fahrer oder viel Gepäck geeignet.
Klappmechanismus: Wie klappt’s beim Epowerfun EPF-Pulse?
Der EPF-Pulse verfügt über einen klassischen Klappmechanismus am unteren Ende der Lenkstange. Ein Sicherungshebel hält die Stange aufrecht. Öffnet man ihn, klappt die Lenkstange nach hinten und rastet an einem Haken ein, sodass der Roller an der Stange getragen werden kann. Bei einem Gewicht von rund 23,5 kg bis 25 kg je nach Akkuversion macht das auf Dauer aber nur bedingt Spaß. Aufgeklappt misst der EPF-Pulse 129 cm in der Länge, 65 cm in der Breite und 130 cm in der Höhe. Zusammengeklappt reduziert sich die Höhe auf 62 cm, sodass er in die meisten Kofferräume passen sollte. Als zusammengeklappter E-Scooter benötigt der EPF-Pulse in öffentlichen Verkehrsmitteln kein extra Ticket.
Lenker: extra-breit, extra-bequem
Der üppig dimensionierte Lenker misst satte 65 cm in der Breite, was zusammen mit den ergonomisch geformten Griffen auch bei längeren Fahrten für entspanntes und sicheres Handling sorgt. Rechts befinden sich der Ein-/Aus-Taster, der Lichtschalter sowie der etwas straffe Daumengas-Hebel, der bei ausgedehnten Touren eventuell für einen müden Daumen sorgen könnte. Links sitzen die Taster für den Blinker, eine kleine Glocke und der Hebel für die elektrische Bremse.
Display: Minimalistisch mit Leuchtschwäche
Das mittig platzierte LED-Display fügt sich nahtlos in den Lenker ein und informiert über Geschwindigkeit ohne Nachkommastelle, gewählte Unterstützungsstufe und Akkukapazität in fünf Balken. Die Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung könnte besser sein.
Wegfahrsperre mit NFC-Karte
Als praktischer Diebstahlschutz erweist sich die NFC-Wegfahrsperre: Nach dem Einschalten lässt sich der Roller erst mit einer der drei beiliegenden NFC-Karten (Lesepunkt unterhalb des Displays) entsperren. Im gesperrten Zustand aktiviert jeder Bewegungsversuch die Motorbremse und löst ein akustisches Warnsignal aus. Ein Wegtragen des Rollers verhindert das natürlich nicht – wer auf Nummer sicher gehen will, sollte ein gutes Schloss verwenden. Auf Wunsch lässt sich diese automatische Wegfahrsperre deaktivieren. Hier geht es zu unseren Ratgeber Fahrradschloss für E-Bike & E-Scooter: Smart, mit App, Alarm & GPS.
Licht & Blinker: Wie gut ist die Lichtanlage am Epowerfun EPF-Pulse?
Die Beleuchtungsanlage des EPF-Pulse weiß zu gefallen: Neben den gut platzierten Blinkern an den Lenkerenden und am Heck verfügt er über ein mit 80 Lux angenehm helles Frontlicht mit gutem Lichtkegel, das sich in der Höhe verstellen lässt. Auch das Rücklicht ist hell genug, um rechtzeitig gesehen zu werden und leuchtet beim Bremsen zusätzlich auf – ein weiteres Plus für die Sicherheit. Beim Aktivieren ertönt ein akustisches Signal, das sich über die App deaktivieren lässt. Der Blinker schaltet sich nicht automatisch aus, sondern erfordert eine manuelle Deaktivierung durch den Fahrer.
App: Was kann die App des Epowerfun EPF-Pulse?
Der E-Scooter kommt außerdem mit einer App. Die App benötigt keine Registrierung und findet in unserem Fall den E-Scooter auf Anhieb. Dort kann unter anderem die maximale Geschwindigkeit gedrosselt, Tageskilometer eingesehen und der Blinkerton ausgeschaltet werden. Außerdem sieht man die Gesamtkilometer und einige weitere Metriken. Nett, dass es eine App gibt. Wirklich wichtig ist sie jedoch nicht.
Epowerfun EPF-Pulse Screenshots
Fahren: So fährt sich der Epowerfun EPF-Pulse?
Mit dem EPF-Pulse steht einer bequemen und sicheren Fahrt nichts im Wege. Er reagiert direkt auf Lenkeingaben und meistert dank großzügiger Bodenfreiheit auch höhere Bordsteinkanten problemlos. Die Federung wirkt auf den ersten Blick eher straff, entpuppt sich beim Fahren aber als gut abgestimmt. Kleinere Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster oder kürzere Feldwege bügelt sie souverän aus. Auf längeren, unebenen Passagen ist man als Fahrer aber dennoch gefordert.
Für viel Fahrspaß sorgt der leistungsstarke Heckmotor mit 500 Watt Nennleistung und 1200 Watt Peak-Power – einer der stärksten bisher von uns getesteten legalen Antriebe. Er beschleunigt den Roller in Windeseile auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h plus Toleranz, die wir per GPS-Messung mit sehr guten 21 bis 22 km/h bestätigen können. Hier könnten sich viele andere, zögerlicher ausgelegte E-Scooter etwa von Xiaomi oder Segway Ninebot eine Scheibe abschneiden.
Sicher unterwegs ist man auch dank der vorbildlichen Bremsanlage mit Scheibenbremsen an beiden Rädern, die über Bremshebel am Lenker verzögern. Zusätzlich sorgt die über einen Daumengriff ansteuerbare Motorbremse für verlustfreie Verzögerung. Diese Kombination macht sowohl beim sanften Abbremsen als auch bei einer Vollbremsung eine gute Figur.
Zum guten Gesamteindruck tragen auch die 10 Zoll großen, schlauchlosen Luftreifen mit selbstheilender Spezialbeschichtung bei, die kleinere Einstiche etwa durch Dornen selbstständig abdichten können.
Akku: Wie ist die Reichweite des Epowerfun EPF-Pulse?
Käufer haben beim EPF-Pulse die Wahl zwischen drei Akkuvarianten: 480 Wh, 720 Wh oder üppige 960 Wh Kapazität, für die der Hersteller Reichweiten von 52, 78 oder 104 km angibt – gemessen unter optimalen Bedingungen.
In der Praxis liegen die erzielbaren Reichweiten erfahrungsgemäß darunter. Faktoren wie Fahrergewicht, Außentemperatur, Topografie, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil (etwa viel Stop-and-Go im Stadtverkehr) haben großen Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Wir haben die 960-Wh-Variante getestet und kamen bei 80 kg Fahrergewicht im sommerlichen Stadtverkehr mit vielen Ampelstopps auf gute 60 km Reichweite. Pauschale Angaben zur Reichweite sind aber schwierig, da die individuellen Einflussfaktoren stark variieren.
Preis: Was kostet der Epowerfun EPF-Pulse?
In der 480 Wh-Version kostet der Epowerfun EPF-Pulse 989 Euro, mit 720-Wh-Akku werden 1199 Euro fällig und die große 960-Wh-Variante schlägt mit 1349 Euro zu Buche. Dafür bekommt der Käufer einen leistungsstarken, komfortablen und hochwertigen E-Scooter mit Straßenzulassung, der auch für Ausflüge abseits befestigter Wege geeignet ist.
Fazit: Wie gut ist der Epowerfun EPF-Pulse?
Mit dem EPF-Pulse hat Epowerfun einen rundum gelungenen E-Scooter im Programm, der dank seiner hervorragenden Vollfederung, dem kraftvollen Antrieb und der guten Ausstattung kaum Wünsche offen lässt. Die hochwertige Verarbeitung und die üppige Zuladungskapazität prädestinieren ihn auch für große und schwere Fahrer, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Begleiter für Stadt und Gelände sind.
Erfreulich ist die Auswahl zwischen drei Akkugrößen. In Kombination mit der hellen Lichtanlage und der praktischen NFC-Diebstahlsicherung bietet der EPF-Pulse ein stimmiges Gesamtpaket, das die meisten Konkurrenten alt aussehen lässt.
Kleinere Kritikpunkte wie die in der Höhe nicht verstellbare Lenkstange, ein nur mit Werkzeug wechselbarer Akku, die fragil wirkende Befestigung des Frontlichts und der bei Sonne schwer ablesbaren Geschwindigkeitsanzeige fallen da nur wenig ins Gewicht. Unter dem Strich ist der Epowerfun EPF-Pulse einer der besten E-Scooter, der die Messlatte für Komfort, Sicherheit und Fahrleistungen ein gutes Stück nach oben verschiebt – und damit trotz des stolzen Preises eine klare Kaufempfehlung verdient.
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 1 Monat
Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 1 Monat
Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 4 Wochen
Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 3 Monaten
Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen















