Digital Business & Startups
Peter Thiel über KI, Superintelligenz, Unsterblichkeit und Pessimismus
Fortschritt stagniert, KI enttäuscht, Trump war Disruption. Peter Thiel ist zu Gast im New-York-Times-Podcast. Seine Kernthesen haben wir für euch zusammengefasst.

Kolumnist Ross Douthat von der New York Times hatte Peter Thiel in seinem Podcast „Interesting Times“ zu Gast. Im Netz reagieren viele Zuhörerinnen und Zuhörer fassungslos. Einige nennen Thiel verrückt, drastisch oder paranoid.
Duthats Kollege beispielsweise, der amerikanische Journalist und politische Kommentator Ezra Klein, schrieb auf Reddit: „Peter Thiel ist viel verrückter als ich dachte“. Stephanie von Behr, Vice President bei ACE Alternatives, sagt: „Er schweift völlig ab … es ist beängstigend.“ Guillerme Flor, Investor bei GoHub Ventures, weiß nicht, was er von dem Interview halten soll. „Peter Thiel hat gerade das umwerfendste und verrückteste Interview gegeben, das ich je gehört habe. Es ist so drastisch, dass ich immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll, außer dass es sich jeder anhören sollte“, schreibt er auf Linkedin.
Wir haben die sieben zentralen Punkte aus dem Gespräch zusammengefasst.
1. Stagnationsthese
Peter Thiel hält weiter an seiner These fest, dass der technologische Fortschritt massiv an Fahrt verloren habe. Vor 14 Jahren hat er in der konservativen Zeitschrift „National Review“ einen Essay mit dem Namen „The End of the Future“ veröffentlicht.
Darin heißt es: Zwar sei die Welt nicht vollkommen „stecken geblieben“, aber die Beschleunigung der vergangenen Jahrhunderte sei vorbei. Zwischen 1750 und 1970 habe es enorme Sprünge in Transport, Energie und Raumfahrt gegeben.
Heute, sagt er, gebe es Fortschritt fast nur noch in der digitalen Welt, etwa bei Software, Internet oder KI. Schuld daran seien kulturelle Entwicklungen wie Umweltbedenken, innovationsfeindliche Institutionen und vor allem ein gesellschaftlicher Mangel an Ambition.
2. Trump Unterstützung
Thiel unterstützte Donald Trump im Wahlkampf 2016 weniger aus inhaltlicher Überzeugung, sondern weil er hoffte, damit einen gesellschaftlichen Diskurs über den Niedergang der USA anzustoßen. Für ihn war Trump vor allem eines: radikale Disruption.
Heute wirkt er jedoch ernüchtert. „Rückblickend war das eine absurde Fantasie“, so Thiel. Politisches Engagement bezeichnet er als toxisch und wenig effektiv, er schwanke zwischen Rückzug und Einflussnahme.
Lest auch
3. Mehr Risiko und Innovation
Thiel fordert eine weit größere Risikobereitschaft in Forschung und Gesellschaft. Besonders in der Biotechnologie müsse man alte, gescheiterte Theorien hinter sich lassen – etwa in der Alzheimerforschung, die seit Jahrzehnten stagniere.
Er spricht sich für die Freigabe experimenteller Therapien aus. Generell brauche es weniger Regulierung und mehr Experimentierfreude, wie sie in der Frühmoderne selbstverständlich war.
4. Künstliche Intelligenz
Für Thiel ist Künstliche Intelligenz kein Allheilmittel. Sie sei größer als nichts, aber kleiner als eine totale Transformation der Gesellschaft – vergleichbar mit dem Internetboom der 1990er, der einige Prozent Wachstum brachte, aber keine fundamentale Wende.
Er kritisiert die Fixierung des Silicon Valley auf IQ. Fortschritt scheitere nicht an fehlender Intelligenz, sondern an kulturellen und gesellschaftlichen Blockaden. Zudem sieht er das Risiko, dass KI nur zu einer neuen Form stagnativer, konformer Intelligenz führt.
„Wir denken nicht darüber nach, was KI für die Geopolitik bedeutet, wir denken nicht darüber nach, was sie für die Makroökonomie bedeutet“, kritisiert Thiel.
5. Transhumanismus
Thiel hält heutige Transhumanisten für nicht ehrgeizig genug. Körperliche Transformationen wie Geschlechtsumwandlungen seien winzig im Vergleich zu radikaler Lebensverlängerung oder Unsterblichkeit.
Lest auch
Sowohl Christentum als auch Transhumanismus strebten danach, Natur und Tod zu überwinden – bisher seien die technischen Versuche jedoch geradezu lächerlich klein. „Die Kritik ist nicht, dass es seltsam oder unnatürlich ist, sondern: Mann, es ist so erbärmlich wenig“, sagt er.
6. Antichrist
Thiel warnt vor einer globalen, stagnierenden „Welt-Regierung“ als moderner Antichrist. Viele würden zur Abwehr von Risiken wie Nuklearwaffen, KI oder Klimawandel globale Regulierungen fordern, die Fortschritt und Freiheit langfristig ersticken könnten.
Er fürchtet weniger den „bösen Tech-Genius“, sondern eher autoritäre Umwelt- und Sicherheitsbewegungen, die mit Angst Politik machen und Innovation verhindern. „Der Weg, wie der Antichrist die Welt übernehmen würde, ist, ununterbrochen von Armageddon zu sprechen. Ununterbrochen von existenziellen Risiken zu sprechen“, so der Paypal-Gründer.
7. Glaube
Thiel glaubt, dass Menschen Freiheit und Handlungsspielräume haben. Es ist nicht alles von Gott vorbestimmt. Fortschritt braucht menschliche Initiative, nicht bloß göttliches Eingreifen.
„Es ist immer problematisch, Gott zu viel Verursachung zuzuschreiben. Wenn man sagt, Gott sei die Ursache für alles, macht man Gott zum Sündenbock“, so Thiel. Trotzdem hält er an christlicher Hoffnung fest, dass es nicht im ewigen Stagnationszustand endet.
Digital Business & Startups
Coby’s, Sheers, little Biker, Whacky, KassenKompass, Touchprint treten vor die Löwen
#DHDL
Es geht wieder in die Löwen-Höhle! An diesem Montag flimmert bei Vox erneut “Die Höhle der Löwen” über den Bildschirm. In der aktuellen Folge pitchen Coby’s, Sheers, little Biker, Whacky, KassenKompass und Touchprint.

In der mittlerweile achtzehnten Staffel der erfolgreichen Vox-Gründershow “Die Höhle der Löwen“ (DHDL) wittert das mehrköpfige Löwenrudel wieder fette Beute. Die Jury besteht in dieser Herbststaffel aus dem Regal-Löwen Ralf Dümmel, der Venture-Capital-Löwin Janna Ensthaler, dem Sales-Löwen Carsten Maschmeyer, der Beauty-Löwin Judith Williams, der Familien-Löwin Dagmar Wöhrl und dem Startup-Löwen Frank Thelen.
Die DHDL-Startups der Woche
Battle-Pitch
Zwei Startups, ein großer Traum: ein Deal mit den Investorinnen und Investoren! In der neuen Battle-Rubrik von “Die Höhle der Löwen” zählt jede Sekunde, denn die Startups haben im Duell nur je 60 Sekunden Zeit, das Löwenrudel zu überzeugen. Dem nervenaufreibenden Kurz-Pitch stellen sich heute zwei Getränke-Startups: das Health Boost Kaffeekonzentrat Coby’s trifft auf Sheers, den rosa Rum für Frauen. Nur wer Idee, Vision und Business in kurzer Zeit auf den Punkt bringt, bekommt die Chance, den Löwen sein Produkt in voller Länge zu präsentieren.
Coby’s aus Dresden
Bruno Stein (23) und Martin Emmrich (23)
Angebot: 80.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile
Sheers aus Köln
Laura Walter (31) und Tatjana Peters (30)
Angebot: 100.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile
little Biker aus Siegen
Es wird besonders herzlich, denn kleine Pedalhelden erobern “Die Höhle der Löwen”: Die Familienväter Jan Hass (37) und Steffen Gross (41) stellen gemeinsam mit ihren Kindern Aaron, Amelie, Clara und Caspar ihr Startup little Biker vor. Mit viel Charme und kindlicher Unterstützung präsentieren sie eine clevere Erfindung, die Kindern das Radfahren lernen erleichtern soll – und den Eltern dabei Sicherheit gibt. “Das sind die süßesten Prozente, die wir je angeboten bekommen haben”, schwärmt Carsten Maschmeyer, als die Nachwuchs-Unterstützer das Deal-Angebot über 150.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile verkünden. Die innovative Fahrrad-Lernweste verfügt über einen stabilen Haltegriff am Rücken, mit dem Eltern ihre Kinder beim Üben sicher führen, bremsen oder auch mal anschieben können – ohne am Pullover zerren zu müssen. Dank verstellbarer Gurte wächst die Weste mit und lässt sich sogar über die Winterjacke ziehen. So soll Kindern ein angstfreier Start auf zwei Rädern, Rollschuhen oder dem Skateboard ermöglicht werden. “Ich kenne genau diesen Jackengriff – immer rennt man hinterher”, weiß Janna Ensthaler aus ihrer eigenen Erfahrung mit ihren drei Kindern. Von den kleinen Besuchern in der Höhle sind die Löwen begeistert, aber überzeugt sie auch der Business-Case?
Whacky aus Ingolstadt
Wenn drei Gründer mit der “Salami-Taktik” in die Höhle ziehen, dann ist klar: Heute geht’s um die Wurst! Daniel Stadtmann (44), Dr. Peter Stiller (46) und Gregor Schleicher (46) wollen die Löwen mit Whacky – hochwertigen Bio-Rindfleischsticks ohne Zusatzstoffe – überzeugen. Ihr Versprechen: ein proteinreicher, gesunder Snack für alle, die genug von süßen Riegeln haben und beim kleinen Hunger bewusst genießen wollen. Mit einem Vize-Weltmeister als Markenbotschafter und bereits beachtlichen Umsatzzahlen im Rücken wittern die Gründer ihre große Chance. Doch in der Höhle zählt nicht nur der Geschmack, sondern auch Struktur und Branding. Die Beteiligung des Produzenten als Gesellschafter stößt sauer auf. Für Frank Thelen ist die Gesellschafter-Struktur eine “Red Flag”. Als die Gründer zudem bei der Frage nach ihrer Investoren-Erwartung eher zurückhaltend antworten, verlässt Carsten Maschmeyer mitten im Pitch die Höhle: Der Löwe zweifelt am authentischen Interesse der Gründer, einen Deal zu machen. Möchte das Trio wirklich nur Werbezeit für ihre Bio Beef Sticks mitnehmen? Oder reißen die drei Gründer das Ruder noch rum?
KassenKompass aus Hamburg
“Wir bringen heute Ihre Versicherungswahl voll auf Kurs!” Mit diesen Worten starten Fiona Jasmut (27) und Ole Walkenhorst (27) ihren Pitch in der “Höhle der Löwen”. Ihr Startup KassenKompass will Ordnung in den Krankenkassen-Dschungel bringen. Denn 90 Prozent der Deutschen sind gesetzlich versichert – und zahlen oft zu viel. “In Deutschland gibt es 95 Krankenkassen mit unterschiedlichen Beiträgen, Bonusprogrammen und Zusatzleistungen. Da verliert selbst ein Versicherungsberater den Überblick”, erklärt Ole Walkenhorst. Ein Wechsel lohnt sich: Bis zu 800 Euro pro Jahr lassen sich sparen. Über die digitale Plattform KassenKompass finden Nutzer in wenigen Klicks die passende Krankenkasse – und können direkt wechseln. Das Geschäftsmodell basiert auf einer festen Wechselprovision sowie Kooperationen mit Beratern und Unternehmen. “Wir wollen, dass sich Menschen überhaupt mit ihrer Krankenkasse beschäftigen – und vom Wettbewerb profitieren”, sagt Fiona Jasmut. Die Löwen sind beeindruckt, sehen aber auch Risiken: “Das ist leicht kopierbar, das kann jeder große Player nachbauen”, warnt Frank Thelen. Doch bekommen sie den Deal? Für 300.000 Euro bieten die Gründer zehn Prozent ihrer Firma an.
Touchprint aus Berlin
Wenn Momente wichtig sind, halten wir sie mit Fotos fest. Doch was, wenn man blind ist? Die Gründer Linus Walden (24), Max Winkler und Dyveke Walden (29) von Staytours haben eine Lösung entwickelt: Mithilfe von KI werden Fotos in ertastbare 3D-Reliefs verwandelt. So können Erinnerungen über Tastsinn wieder erlebt werden. Nursen Draeger (55) kam mit ihrem Problem auf die Gründer zu – sie hat ihr Augenlicht verloren und konnte sich keine Fotos ihrer Familienmitglieder mehr anschauen, wenn sie diese vermisst. So entstanden die ersten Prototypen des Touchprints. “Meine beiden erwachsenen Söhne wohnen nicht mehr bei mir. Jetzt kann ich sie und meine Enkelin auf eine besondere Art wiedersehen – das bedeutet mir unendlich viel”, freut sich Nursen Draeger. Ob Einschulung, Hochzeit oder Haustier – alles lässt sich als taktiles Kunstwerk erfahrbar machen. Zudem arbeitet das Team mit Museen, um auch Kunstwerke zugänglich zu machen. Erfahrung im 3D-Druck bringt das Trio bereits mit: Ihr erstes Produkt Bodyprint – detailgetreue Skulpturen vom eigenen Körper – ist vor allem bei Schwangeren beliebt. Der Pitch sorgt für Gänsehaut und feuchte Augen bei allen Beteiligten. Doch führt die berührende Idee auch zu einem Deal?
Tipp: Alles über die Vox-Gründershow gibt es in unserer großen DHDL-Rubrik.
Startup-Jobs: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? In der unserer Jobbörse findet Ihr Stellenanzeigen von Startups und Unternehmen.
Foto (oben): RTL / Bernd-Michael Maurer
Digital Business & Startups
Zalando-CEO Robert Gentz live: Wie baut man ein Milliarden-Unternehmen?
„Gründerszene x The Delta Campus“ startet in Berlin: Jeden Monat treffen sich 200 Gründer, VCs und Startup-People zu Talks, Networking und Drinks. Jetzt anmelden!

Kann man aus Berlin heraus ein globales Milliardenunternehmen bauen? Robert Gentz hat es vorgemacht. Als Co-Gründer & CEO von Zalando – einer der prägendsten Tech-Erfolgsgeschichten Europas – zeigt er, dass deutsche Gründer weltweit mitspielen können.
Genau er eröffnet das Auftakt-Event von „Gründerszene x The Delta Campus“, unserer neuen Flagship-Reihe in Partnerschaft mit The Delta.
200 Gründer und Startup-People an einem Ort – jeden Monat
Denn ab jetzt bringen Gründerszene und The Delta Campus jeden Monat 200 Köpfe der Startup-Szene in Berlin zusammen. Jedes Event bietet ein Interview mit einer der prägendsten Stimmen der Szene – diesmal mit dem Zalando-Gründer.
Es wird der neue Pflichttermin, bei dem Gründer, VCs und Unternehmer Wissen teilen, Allianzen schmieden und sich von starken Gründer-Stories inspirieren lassen.
Schnell hier bewerben – die Plätze sind limitiert
19:00 – 19:30 | Ankunft, Welcome Drinks & Finger Food
19:30 – 19:35 | Begrüßung durch The Delta, Gründerszene & AWS
19:35 – 19:50 | Impulsvortrag
20:00 – 21:00 | Fireside Chat: Robert Gentz x Leo Ginsburg
21:00 – 21:15 | Publikum Q&A
21:15 – 00:00 | Networking, Drinks, Finger Food & Musik
Sei dabei! Die Plätze sind limitiert: Hier schnell bewerben.

Fotografie: Ole Witt
Digital Business & Startups
Konvo sammelt 3,5 Millionen ein – Scalehouse Capital investiert in Paul’s Job – MoveAgain übernimmt Movu
#DealMonitor
+++ #DealMonitor +++ Berliner Startup Konvo sammelt 3,5 Millionen ein +++ Scalehouse Capital investiert in Paul’s Job +++ Umzugsdienst MoveAgain übernimmt Movu +++
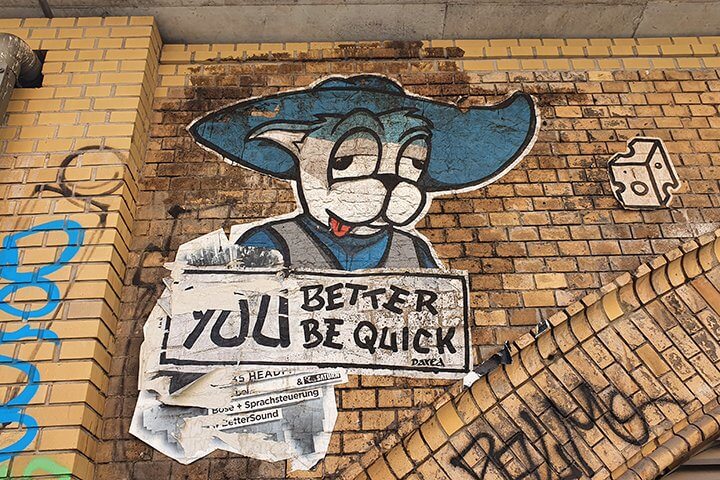
Im #DealMonitor für den 29. September werfen wir einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der Vortage gibt es im großen und übersichtlichen #DealMonitor-Archiv.
STARTUPLAND

SAVE THE DATE: Am 5. November findet unsere zweite STARTUPLAND statt. Es erwartet Euch wieder eine faszinierende Reise in die Startup-Szene – mit Vorträgen von erfolgreichen Gründer:innen, lehrreichen Interviews und Pitches, die begeistern. Mehr über Startupland
INVESTMENTS
Konvo
+++ Der spanische Frühphasen-Investor Samaipata, Abac Nest Ventures, JME Ventures, Itnig und Combination Ventures, investieren 3,5 Millionen Euro in Konvo. Das Startup aus Berlin, 2024 von Guillem Oliva und Scott Kapelewski (die beide zuvor bei Charles gearbeitet haben) gegründet, bringt sich als “Conversational AI platform” für E-Commerce-Marken in Stellung. “Konvo helps eCommerce brands turn customer conversations into conversions, with AI Agents that automate support, boost sales, and drive retention”, heißt es zum Konzept. Insgesamt flossen nun schon 4,3 Millionen in die Jungfirma. Investor Samaipata investierte hierzulande bereits in Synthavo und retraced. Mehr über Konvo
Paul’s Job
+++ Scalehouse Capital und Business Angels wie Alexander Bruehl, Rainer Hofmann, Andreas Junck, Carsten Reetz sowie Michael May investieren 1,4 Millionen Euro in Paul’s Job. Das Startup aus Berlin, das vom softgarden-Gründer Dominik Faber, Yannick Evans und Putu Adi gegründet wurde, kümmert sich um die Automatisierung des Bewerbermanagements. “Wir entwickeln Paul’s Job zum ATS, das Bewerber weitgehend autonom bis zum Interview, perspektivisch bis zum Vertrag, führt”, teilt das Team mit. Zum Hintergrund: Paul’s Job wurde ursprünglich 2023 von Dominik Faber und Benjamin Weller gegründet. Das Unternehmen positionierte sich dabei als “HR-System mit agentischer KI”. Im Sommer schlitterte das Unternehmen in die Insolvenz. Nun erfolgt der Neustart. Mehr über Paul’s Job
MERGERS & ACQUISITIONS
MoveAgain – Movu
+++ Der Schweizer Umzugsdienst MoveAgain übernimmt seinen Wettbewerber Movu, der zuletzt zum Schweizer Versicherer Baloise gehörte. “Mit der Transaktion integriert MoveAgain den grössten Mitbewerber im SchweizerOnline-Umzugsmarkt und verstärkt damit seine Position als klare Nummer 1”, teilt das Unternehmen zum Zukauf mit. MoveAgain übernahm zuletzt auch den einst gehypten Umzugsvermittler Movinga. Mehr über MoveAgain
Startup-Jobs: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? In der unserer Jobbörse findet Ihr Stellenanzeigen von Startups und Unternehmen.
Foto (oben): azrael74
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 1 Monat
Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 1 Monat
Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 4 Wochen
Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Digital Business & Startupsvor 3 Monaten
Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

















