Apps & Mobile Entwicklung
Strahlungsresistenter Speicher: Micron will nun den Weltraum erobern
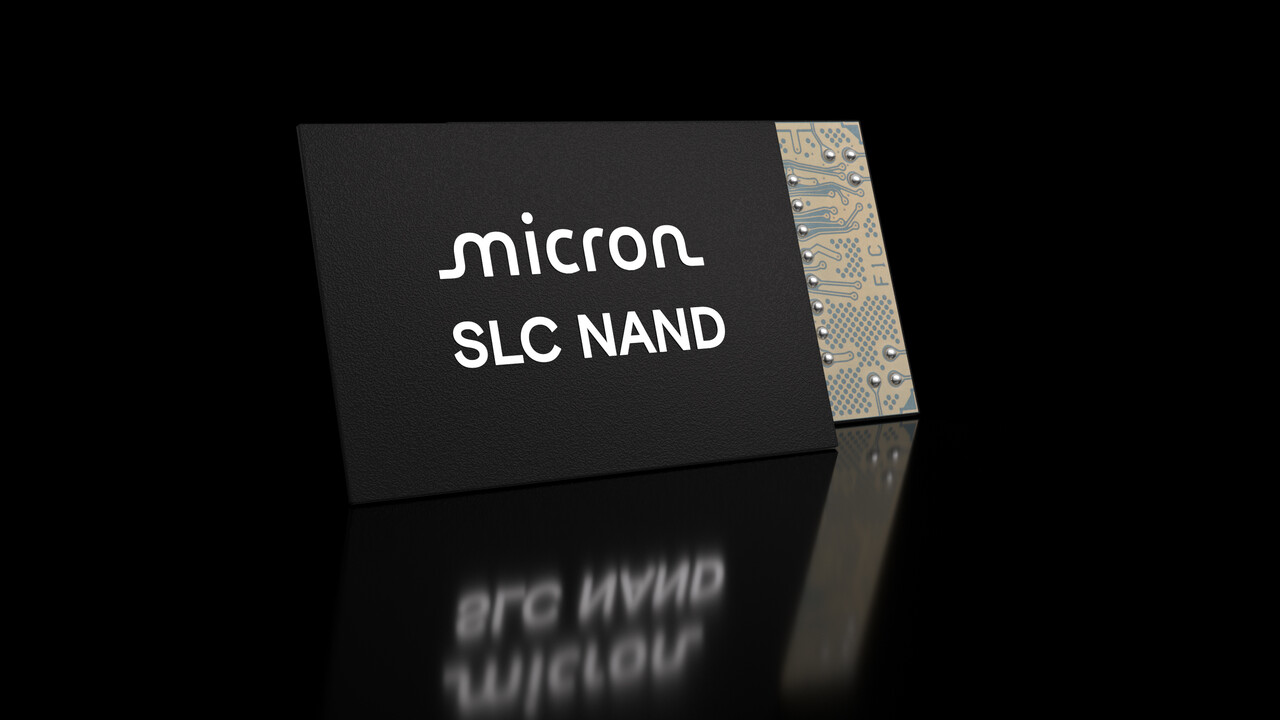
Micron eröffnet einen neuen Markt für Speicherchips und zwar einen jenseits dieses Planeten, nämlich den Weltraum. Das aus Sicht des Herstellers erste weltraumtaugliche Portfolio startet mit SLC-NAND-Flash. Die Speicherchips seien strahlenresistent und somit für die unwirtliche Umgebung bestens geeignet.
Micron entwickelt nun Speicher für den Weltraum
Nach Ansicht von Micron erlebt das Wirtschaftsfeld Raumfahrt einen regelrechten Boom, getrieben sowohl von kommerziellen als auch staatlichen Missionen. Das ist Grund genug für den US-amerikanischen Speicherhersteller, eigens dafür eine Produktpalette aufzulegen. Geplant sind „weltraumtaugliche“ NAND-Flash-, NOR-Flash- und DRAM-Lösungen. Den Anfang macht der „strahlungsresistente SLC-NAND-Flash“.
Weltraumtauglicher SLC-NAND mit 256 Gbit
Das erste Produkt des neuen Raumfahrt-Portfolios von Micron ist ein SLC-NAND-Flash mit einer Speicherkapazität von 256 Gigabit (32 GByte) pro Die. Das ist angesichts der inzwischen gängigen 1-Tbit-TLC-Chips oder gar 2-Tbit-QLC-Chips vergleichsweise wenig. Allerdings speichert SLC auch nur 1 Bit pro Zelle (Single Level Cell), während TLC (Triple Level Cell) bei 3 Bit und QLC (Quadruple Level Cell) bei 4 Bit liegen.
Die SLC-Speicherform wird kaum noch eingesetzt, da die Speicherdichte bei TLC und QLC viel höher ist und die Kosten pro Bit damit viel geringer ausfallen. Doch bietet SLC-NAND den Vorteil, dass Daten durch den weniger komplexen Speichervorgang schneller geschrieben werden können. Die geringe Komplexität sorgt auch für weniger Interferenzen und so für eine viel höhere Haltbarkeit.
Der letzte Punkt ist für den Einsatz im Weltall der wichtigste, denn dort muss nicht nur die erhöhte Strahlung überstanden werden, sondern es kommen auch extreme Temperaturen, Vakuumdruck sowie Stöße und Vibrationen beim Start des Raumschiffes ins Spiel.
Dafür muss der Speicher eine Reihe bestimmter Tests überstehen, die ihm eben die „Weltraumtauglichkeit“ bescheinigen. Diese beschreibt Micron wie folgt:
- Extended quality and performance testing, aligned with NASA’s PEM-INST-001 Level 2 flow, which subjects components to a yearlong screening, including extreme temperature cycling, defect inspections and 590 hours of dynamic burn-in to enable spaceflight reliability.
- Radiation characterization for total ionizing dose (TID) testing, aligned with U.S. military standard MIL-STD-883 TM1019 condition D, which measures the cumulative amount of gamma radiation that a product can absorb in a standard operating environment in orbit and remain functional, a measurement that is critical in determining mission life cycle.
- Radiation characterization for single event effects (SEE) testing, aligned with the American Society for Testing Materials flow ASTM F1192 and the Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) standard JESD57. SEE testing evaluates the impact of high-energy particles on semiconductors and verifies that components can operate safely and reliably in harsh radiation environments, reducing the risk of mission failure. This profiling information enables space engineers and architects to design in a way that mitigates the risk and disruption to the mission.
Micron
Micron gibt an, dass sich bereits Speicherchips des Herstellers auf Missionen im Weltall befinden, die aber noch nicht das Siegel „space-qualified“ tragen.
Auch wenn sich Micron nun damit rühmt, der erste führende Speicherhersteller mit einem solchen Portfolio zu sein, darf erwähnt werden, dass der SSD-Controller-Hersteller Phison schon vor einigen Jahren eine SSD mit einer NASA-Zertifizierung für eine kommende Mondmission bewarb. Das taiwanische Unternehmen arbeitet mit Lonestar Data Holdings zusammen, um ein Rechenzentrum auf dem Mond zu errichten. Über eigene Speicherchips verfügt Phison aber nicht.
Apps & Mobile Entwicklung
MediaMarkt lockt mit unschlagbarem Angebot für das Samsung Galaxy S25
Wer schon lange mit dem Samsung Galaxy S25 liebäugelt, darf sich jetzt freuen: Bei MediaMarkt gibt’s das Top-Smartphone so günstig wie noch nie. Und zwar ohne Tarif oder sonstigen Haken. Doch lange, wird es das Angebot so wohl nicht mehr geben.
Oft berichten wir von starken Angebots-Bundles, die aus Smartphone und Tarif bestehen. Diese Kombinationen sind teilweise sogar günstiger als ein Einzelkauf. Das Samsung Galaxy S25 fällt bei MediaMarkt jetzt aber so deutlich im Preis, dass wir einen neuen Tiefstpreis erreichen, ohne einen Vertrag dazubuchen zu müssen. Wer also nur an einem neuen Handy und nicht an einem neuen Tarif interessiert ist, sollte jetzt weiterlesen.
Galaxy S25: So gut ist der Preis
Im Fokus steht das Galaxy S25 in der 256-GB-Speichervariante. MediaMarkt stellt das Smartphone für 599 Euro ins virtuelle Schaufenster.* Versandkosten fallen keine an. Ein ziemlich guter Preis, vor allem mit Blick auf die 128 GB-Version, die im Netz* derzeit nur rund 20 Euro günstiger ist. Sonst zahlt man für ein Speicher-Upgrade bei Smartphones deutlich mehr.
Im Vergleich mit anderen Händlern beim 256-GB-Modell steht MediaMarkt ebenfalls ziemlich gut da. Nur Versandriese Amazon zieht gleich und verkauft das Smartphone für den gleichen Preis. Allerdings stehen hier bis zu drei Monate Lieferzeit auf der Uhr. Auch MediaMarkt gibt an, dass das Smartphone so gut wie ausverkauft ist. Der Preis und das S25 sind, wie es aussieht, also heiß begehrt.

Bei den Farben habt Ihr die Qual der Wahl, MediaMarkt verkauft sie alle zum gleichen Preis. Wer sein altes Handy loswerden möchte, kassiert aktuell ebenfalls noch 75 Euro Ankaufsprämie zusätzlich zum Restwert – das drückt die Kosten noch mal.
Ein Blick unter die Haube
Ausgestattet mit 12 GB RAM und einem 4.000-mAh-Akku inklusive Schnell- und Wireless-Charging, ist das Galaxy S25 technisch auf einem Top-Stand. Die Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptsensor, 12-MP-Ultraweitwinkel und 10-MP-Teleobjektiv bietet 3-fach Zoom und Videos in bis zu 8K, perfekt für Instagram und Co.
Der Snapdragon 8 Elite bringt genug Leistung für jede Menge Apps, Spiele und KI-Anwendungen. Das kompakte 6,2-Zoll-AMOLED-Display überzeugt wie von Samsung gewohnt mit einer starken 120-Hz-Wiederholrate, HDR10+ und einer Spitzenhelligkeit von 2.600 Nits. Serien und Filme streamt Ihr hiermit ruckelfrei und in starker Qualität. Wenn Ihr Euch unsicher seid, welches S25-Modell das richtige für Euch ist, solltet Ihr mal in unserem Vergleich vorbeischauen.
Der aktuelle Preis von nur 599 Euro ist für das Galaxy S25 mit 256 GB Speicherplatz wirklich ziemlich stark. So günstig wie jetzt war das Modell sogar noch nie! Da hier anscheinend wirklich akute Ausverkaufs-Gefahr herrscht, solltet ihr besser nicht allzu lange warten.
Was haltet Ihr vom Galaxy S25? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
Apps & Mobile Entwicklung
Gefahren für Kinder in VR: Meta soll eigene Untersuchungen unterbunden haben
Meta soll Untersuchungen und Erkenntnisse über die Gefahren von Virtual Reality bei Kindern und Jugendlichen unterdrückt haben. Diese Vorwürfe erheben zwei ehemalige Mitarbeiter gegen ihren früheren Arbeitgeber vor einem Unterausschuss des US-Senats und gaben an, die Forschung sei bewusst eingeschränkt worden.
Das Social-Media-Unternehmen soll einem Bericht der Washington Post nach laut Jason Sattizahn, einem früheren Sicherheitsforscher für virtuelle Realität, und Cayce Savage, einem ehemaligen Jugendforscher, kritische Ergebnisse über die Risiken unterdrückt haben, denen Kinder bei der Nutzung der Virtual-Reality-Geräte und -Apps des Konzerns ausgesetzt seien. Beide erklärten im Ausschuss, dass Meta zwar intern Gefahren untersuchte, diese Ergebnisse jedoch regelmäßig überprüfte, redigierte und teilweise sogar mit einem Veto belegte.
Die beiden ehemaligen Mitarbeiter sowie noch bei Meta tätige Forscher übergaben dem Kongress dafür Tausende von Seiten interner Nachrichten, Memos und Präsentationen aus dem vergangenen Jahrzehnt zu Metas Virtual-Reality-Dienst, um die Versäumnisse des Unternehmens im Umgang mit Risiken zu dokumentieren.
Forschungsarbeit massiv kontrolliert
Dabei soll Meta seine Forschungsarbeit stark kontrolliert haben. Savage berichtete, ihm sei ein juristischer Mitarbeiter zugeteilt worden, der detailliert vorgab, welche Forschung er betreiben dürfe und welche nicht. Dadurch sollte seiner Aussage nach sichergestellt werden, dass seine Berichte bei einer Veröffentlichung kein Risiko für Meta darstellten würden. Ebenso sei festgelegt worden, welche Arten von Schäden bei Kindern in der virtuellen Realität er nicht untersuchen solle. „Man gab mir das Gefühl, dass ich meinen Job riskieren würde, wenn ich die Angelegenheit vorantrieb“, erklärte Savage vor dem Kongress.
Als Grund für die Unterbindung der Forschung nannten Sattizahn und Savage die Angst Metas vor negativer Berichterstattung, Gerichtsverfahren oder behördlichen Maßnahmen. Aus Unterlagen gehe zudem hervor, wie Meta auf gemeldete Risiken reagierte: Schon 2017 hätten Mitarbeiter davor gewarnt, dass Kinder unter 13 Jahren die Altersbeschränkungen bequem umgehen könnten, um die Virtual-Reality-Dienste zu nutzen. Eine zusätzliche Sicherung sei erst eingeführt worden, als die Federal Trade Commission prüfte, ob Meta den „Children’s Online Privacy Protection Act“ einhalte, ein Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern. Bei einem Verstoß hätten erhebliche Probleme für das Unternehmen gedroht. „Das ist die Art von Dingen, die irgendwann Schlagzeilen machen – und zwar auf eine wirklich schlimme Art und Weise“, schrieb ein Mitarbeiter damals.
Mit „Project Salsa“ startete Meta zwar eine Initiative, die spezielle „Tween“-VR-Headset-Konten für Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren mit elterlicher Kontrolle vorsah. Doch schon damals äußerten Mitarbeiter Zweifel daran, ob die Maßnahmen ausreichend seien.
Sattizahn erklärte, Metas unmittelbare Reaktion auf die Bedenken des Kongresses habe nicht darin bestanden, das Richtige zu tun, sondern Prozesse und Richtlinien einzuführen, um Daten zu manipulieren, zu kontrollieren und zu löschen. „Wir Forscher wurden angewiesen, wie wir Berichte schreiben sollten, um das Risiko für Meta zu begrenzen“, so der ehemalige Mitarbeiter vor dem Ausschuss.
VR-Nutzer in vielen Räumen überwiegend Kinder
Im selben Jahr äußerten Mitarbeiter laut einem Dokument weitere Bedenken, nachdem sie beobachtet hätten, dass viele Nutzer, die wie Kinder aussahen, gegen die Regeln des Unternehmens verstießen, um Zugang zu den VR-Produkten zu erhalten. Ein Beitrag auf einem internen Nachrichtenbrett wies darauf hin: „Wir haben ein Kinderproblem und es ist wahrscheinlich an der Zeit, darüber zu sprechen“. Der Verfasser schätzte, dass in manchen virtuellen Räumen 80 bis 90 Prozent der Nutzer minderjährig gewesen seien.
Forscher gewarnt, Daten gelöscht
Die Dokumente sollen zudem zeigen, dass Mitarbeiter auch in den folgenden Jahren wiederholt in internen Memos auf die Problematik hingewiesen haben sollen. Laut Sattizahn und Savage habe sich Metas Haltung erst 2021 und nicht freiwillig geändert, sondern nachdem die frühere Produktmanagerin Frances Haugen interne Studien und Unterlagen an Medien weitergegeben hatte. Interne Anwälte warnten Forscher der VR-Abteilung Reality Labs daraufhin davor, „sensible“ Themen zu untersuchen. Um dies zu umgehen, sollten Untersuchungen entweder unter Anwaltsgeheimnis erfolgen oder es sollte besonders darauf geachtet werden, wie Studien gestaltet und Ergebnisse präsentiert würden.
Den Aussagen zufolge habe Meta auch nicht davor zurückgeschreckt, brisante Aufzeichnungen und Daten zu löschen. Selbst Befragungen seien während laufender Gespräche unterbunden worden, weil die Ergebnisse dem Unternehmen nicht gefallen hätten. Meta erklärte, dass ein Löschen von Daten nur im Einklang mit Datenschutzbestimmungen erfolgt sei, die das Sammeln persönlicher Daten ohne Zustimmung untersagen. In einem dokumentierten Fall, bei dem es um die Erfahrungen eines Teenagers aus Deutschland ging, habe jedoch die anwesende Mutter ausdrücklich eingewilligt, dass über die Erlebnisse ihres Sohnes gesprochen werde. Auch diese Daten sollen laut dem Artikel gelöscht worden sein.
Meta spricht von falscher Darstellung
Meta widersprach den Vorwürfen und ließ durch Unternehmenssprecherin Dani Lever mitteilen, dass die Anschuldigungen „auf selektiv durchgesickerten internen Dokumenten beruhen, die speziell ausgewählt wurden, um eine falsche Darstellung zu erwecken“. Laut Lever habe es nie ein generelles Verbot gegeben, mit jungen Menschen zu forschen. Meta führe weiterhin Untersuchungen zur Sicherheit und zum Wohlbefinden von Jugendlichen durch. Zudem erklärte sie, dass die Virtual-Reality-Geräte des Unternehmens seit langem über Sicherheitsfunktionen verfügten, darunter das Blockieren problematischer Nutzer, und dass Meta die Forschung genutzt habe, um im Laufe der Zeit zusätzliche Schutzmaßnahmen für junge Menschen zu entwickeln.
Apps & Mobile Entwicklung
QuietComfort Ultra 2 Kopfhörer von Bose: Der AirPods Max-Killer?
Bose brachte seine Ultra-Serie 2023 auf den Markt und positionierte sie als Flaggschiff über der klassischen QuietComfort-Serie. Jetzt stellt das Unternehmen mit dem Bose QuietComfort Ultra 2, der auf der IFA 2025 vorgestellt wurde, die nächste Generation seiner Over-Ear-Kopfhörer vor. Das neue Modell bietet ein verfeinertes Design und deutliche Verbesserungen bei der Klangqualität und der Akkulaufzeit, ohne jedoch den Preis zu erhöhen.
Bose QC Ultra 2 bekommt ein schickeres Design
Der QuietComfort Ultra 2 sieht ähnlich aus wie der ursprüngliche QC Ultra Over-Ear-Kopfhörer (Testbericht) von vor ein paar Jahren. Er hat einen dicken, mit Kunstleder gepolsterten Kopfbügel und große Ohrmuscheln, die die Ohren vollständig umschließen. Neu sind die glänzenden Metallbügel, die die Ohrmuscheln mit dem Kopfbügel verbinden und den Kopfhörern ein hochwertigeres Finish verleihen.
Bose passt die Bügel jetzt farblich an die Kopfhörer an, allerdings in einem etwas anderen Farbton. Zwei neue Farben, Driftwood Sand und Midnight Violet, ergänzen die klassischen Farben Schwarz und Weiß. Das restliche Design, einschließlich der Tasten und des Schnittstellenlayouts, bleibt unverändert. Mit 250 Gramm haben die QC Ultra 2 immer noch einen Gewichtsvorteil gegenüber den AirPods Max, die 385 Gramm wiegen.

Lossless Audio und Spatial Audio
Die aufregendsten Neuerungen gibt es in den Bereichen Sound und ANC. Bose unterstützt jetzt verlustfreies Audio über eine kabelgebundene USB-C-Verbindung und bietet eine 16-Bit-Wiedergabe mit einer Abtastrate von 44,1 kHz oder 48 kHz. Bose verspricht hier außerdem eine geringere Latenzzeit mit USB-C. Und ja, die 3,5-mm-Audiobuchse ist immer noch dabei.
Bose führt darüber hinaus einen neuen Kinomodus ein, der räumliches bzw. 360-Grad-Audio ermöglicht, ohne dass spezielle Inhalte erforderlich sind. Durch das Lokalisieren und Ausbalancieren des Klangs verbessert dieser Modus die Klarheit der Dialoge, was ideal für Podcasts und Hörbücher sowie für Filme und Fernsehsendungen ist.
Besserer Klang und längere Akkulaufzeit
Die Audioausgabe wurde für tiefere Bässe, klarere Höhen bei höherer Lautstärke und natürlichere Höhen optimiert. Der Kopfhörer unterstützt außerdem Bluetooth 5.4 für eine stabilere und effizientere kabellose Verbindung.
Auch die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) wurde dank eines neuen Algorithmus verbessert, der das Erlebnis in leiseren Umgebungen natürlicher macht. Das gilt auch für den Aware- oder Transparenzmodus, der jetzt eine sanftere Aussteuerung bietet. Du kannst ANC manuell einstellen oder ganz deaktivieren.
Die Akkulaufzeit hat sich durchweg verbessert. Mit aktiviertem ANC bietet der QC Ultra 2 eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden (vorher 24 Stunden). Ohne ANC sind es sogar 45 Stunden. Sogar mit aktiviertem Immersive Mode beträgt die Akkulaufzeit 23 Stunden, was eine Steigerung gegenüber den vorherigen 18 Stunden bedeutet.
Vorbestellungen für den Bose QC Ultra 2 sind ab sofort für 499,95 Euro möglich, die Auslieferung beginnt in vielen Ländern am 9. September. I
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 3 Wochen
Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings
-

 Entwicklung & Codevor 3 Wochen
Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 1 Woche
Entwicklung & Codevor 1 WocheEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events


















