Künstliche Intelligenz
GitLab 18.3 startet Transformation zur umfassenden KI-Integration
Das GitLab-Team hat zum Release von Version 18.3 bekannt gegeben, dass sich die Entwicklungsplattform auf dem Weg zur „weltweit ersten KI-nativen Plattform für Software Engineering“ befinde. Dazu sollen Neuerungen auf mehreren Ebenen stattfinden. Im neuen Release finden sich nicht nur erweiterte KI-Features, sondern auch Updates für die Web-IDE und für die Projektmigration mithilfe der Funktion Direct Transfer. Insgesamt sind 38 Änderungen im Release enthalten.
Ein dedizierter Blogeintrag beschreibt GitLabs Transformation zur KI-gestützten Orchestrierung im Rahmen der GitLab Duo Agent Platform. Demnach erhält die vereinheitlichte Datenplattform einen Knowledge Graph, der – auf eine für agentischen Zugang optimierte Weise – Code indizieren und mit allen weiteren verfügbaren unstrukturierten Daten verbinden soll. Dadurch sollen sich Reasoning und Inferenz verbessern. Zudem kommt eine Orchestrationsschicht in der Kontrollebene hinzu, die unter anderem dazu dienen soll, GitLab-Tools, -Agenten und -Flows via Model Context Protocol (MCP) bereitzustellen. Darüber hinaus arbeitet das GitLab-Team an erweiterten Funktionen für KI-Agenten und agentische Flows.
KI-Beta-Features: Visual-Studio-Anbindung und hybride Modellauswahl
Die Duo Agent Platform in Visual Studio hat den Beta-Status erreicht und ist für alle GitLab-User verfügbar. Sie erlaubt den Zugriff auf die KI-gestützten Funktionen der Plattform direkt aus Visual Studio heraus: den agentischen Chat – etwa zum Erstellen und Editieren von Dateien oder dem Durchsuchen der Codebasis – und agentische Flows, die auf komplexere Aufgaben wie die umfassende Planung ausgelegt sind und die Fähigkeit besitzen, Ideen in Architektur und Code umzusetzen.
Zahlende Kunden, die eine selbstverwaltete GitLab-Instanz nutzen, können nun außerdem in GitLab Duo Self-Hosted ihr eigenes Sprachmodell verwenden – ebenfalls ein Beta-Feature. Die gleiche Nutzergruppe erhält Zugriff auf ein weiteres Beta-Feature, nämlich die Möglichkeit, eine Mischung aus Modellen von GitLab-KI-Anbietern und privat konfigurierten, selbst gehosteten Modellen in GitLab Duo Self-Hosted einzusetzen. Diese hybride Modellauswahl soll Admins dabei helfen, Sicherheit und Skalierungsanforderungen unter einen Hut zu bringen.

Die hybride Modellauswahl ist als Beta-Feature in GitLab Duo Self-Hosted verfügbar.
(Bild: GitLab)
Migration per Direct Transfer und Web-IDE-Updates
Abseits der KI-Neuerungen ist für alle GitLab-Anwenderinnen und -Anwender nun die Migration via Direct Transfer allgemein verfügbar. Damit lassen sich GitLab-Gruppen und -Projekte zwischen GitLab-Instanzen transferieren, entweder mittels GitLab-UI oder per REST-API. Im Gegensatz zur Migration mittels Exportdatei soll Direct Transfer einige Vorteile bieten: Es soll bei großen Projekten zuverlässiger funktionieren, Migrationen mit größeren Versionslücken zwischen Quell- und Zielinstanz unterstützen und bessere Einblicke in den Migrationsprozess und dessen Ergebnisse liefern.
In der Web-IDE stehen unterdessen zusätzliche Funktionen im Source Control-Panel bereit. Dort lassen sich nun unter anderem Branches erstellen und löschen sowie Änderungen direkt aus dem Interface heraus erzwingen (Force Push).

Neue Befehle im Panel „Source Control“ innerhalb der Web-IDE
(Bild: GitLab)
Der GitLab-Blog hebt diese und weitere Highlights hervor, darunter feingranulare Befugnisse für CI/CD-Job-Token, eine benutzerdefinierte Admin-Rolle und Support für den AWS Secrets Manager für GitLab CI/CD.
(mai)
Künstliche Intelligenz
Ikea-Schreibtisch Bekant mit verbesserter Steuerung bauen
Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch Bekant von Ikea ist grundsätzlich günstig und alltagstauglich. Jahrelang habe ich ihn genutzt, ohne mir über seine Funktionalität viele Gedanken zu machen. Als sich meine Frau und ich in der Pandemie jedoch den einzelnen Arbeitsplatz im Haus teilen mussten, zeigte sich: Das tägliche Anpassen der Arbeitshöhe bei wechselnden Nutzern kann lästig werden, wenn sich die Positionen nicht speichern lassen. So kam ich auf die Idee, mir die verbaute Technik einmal genauer anzusehen: Das müsste doch smårter gehen?!
Mein Wunsch war es, eine Steuerung zu haben, die zumindest verschiedene Positionen speichern kann und idealerweise die aktuelle Höhe anzeigt. Darüber hinaus würde eine Selbstfahrfunktion für mehr Komfort sorgen und akustische Signale würden mich über die erreichte Endposition informieren, ohne dass ich die Steuereinheit ständig im Blick haben müsste.
- Vier individuelle Positionen speicherbar
- Mit komfortabler Selbstfahrfunktion
- Anzeige der aktuellen Tischhöhe in Zentimetern oder Zoll
Wie ich das Projekt umgesetzt habe, könnt ihr in diesem Artikel lesen. Weitere Informationen, den Code sowie die benötigten Platinen-Layouts und Materialstücklisten finden Sie in der folgenden Checkliste.
Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Ikea-Schreibtisch Bekant mit verbesserter Steuerung bauen“.
Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.
Künstliche Intelligenz
Freitag: Festnahmen nach Kryptofonds-Aus, Android kompatibel mit Apples AirDrop
Zwei Männer wurden festgenommen, während die britische Betrugsbehörde wegen Betrugs und Geldwäsche gegen ein millionenschweres Kryptowährungsschema ermittelt. „Basis Markets“ hatte 2021 mehr als 24 Millionen Euro für einen Krypto-Hedgefonds eingesammelt, doch im Jahr darauf das Projekt eingestellt, ohne Anleger auszuzahlen. Erfreulich ist dagegen, dass Googles Quick Share und Apples AirDrop jetzt zusammenarbeiten für die kabellose Übertragung von iPhones und Android-Handys. Damit lassen sich Bilder und Videos unkompliziert zu Freunden in der Nähe transferieren, egal ob sie iPhone oder Android nutzen, zunächst aber nur für Pixel 10. Derweil ist die Bundesnetzagentur im Streit um die Vergabe von 5G-Lizenzen vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Denn das Verfahren der ersten Frequenzauktion der Bundesrepublik ist nicht sauber verlaufen. Ein jahrelanger juristischer Disput endet damit. Über die Folgen darf die Bundesnetzagentur nun selbst entscheiden – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.
Weiterlesen nach der Anzeige
Die britische Strafverfolgungsbehörde Serious Fraud Office (SFO) untersucht im Zusammenhang mit einem gescheiterten Krypto-Investmentprogramm namens „Basis Markets“ mutmaßliche Straftaten wie Betrug und Geldwäsche. Das Unternehmen hatte umgerechnet 24,3 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Es ist die erste große Untersuchung zu Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen durch die Behörde. Im Rahmen der Untersuchung führten die Ermittler Razzien in Räumlichkeiten in West Yorkshire und London durch und verhafteten zwei Männer. Diese wurden wegen des Verdachts auf mehrfachen Betrug und Geldwäsche festgenommen. Welche Funktion sie innerhalb des Kryptowährungsschemas innehatten, wurde nicht mitgeteilt zu „Basis Markets“: Britische Behörde untersucht Zusammenbruch eines Kryptofonds.
Nutzer von Android-Smartphones greifen üblicherweise auf Messaging-Apps zurück, wenn sie etwa Bilder oder Videos an iPhone-Besitzer senden wollen, selbst wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden. Bei anderen Android-Handys ist dies mit „Quick Share“ möglich, vergleichbar mit Apples AirDrop. Doch jetzt erweitert Google diese Android-Systemfunktion um die Zusammenarbeit mit Apples Ökosystem, sodass Dateien nun auch vom Android-Handy direkt und kabellos zum iPhone geschickt werden können – und umgekehrt. Zunächst ist das erweiterte Quick Share für Smartphones der Pixel-10-Serie verfügbar. Wann diese Funktion auf weitere Android-Geräte ausgedehnt wird und ob der Datentransfer auch für macOS kommt, erwähnt Google bislang nicht: Google erlaubt den direkten Datenaustauch von iPhone und Android-Smartphones.
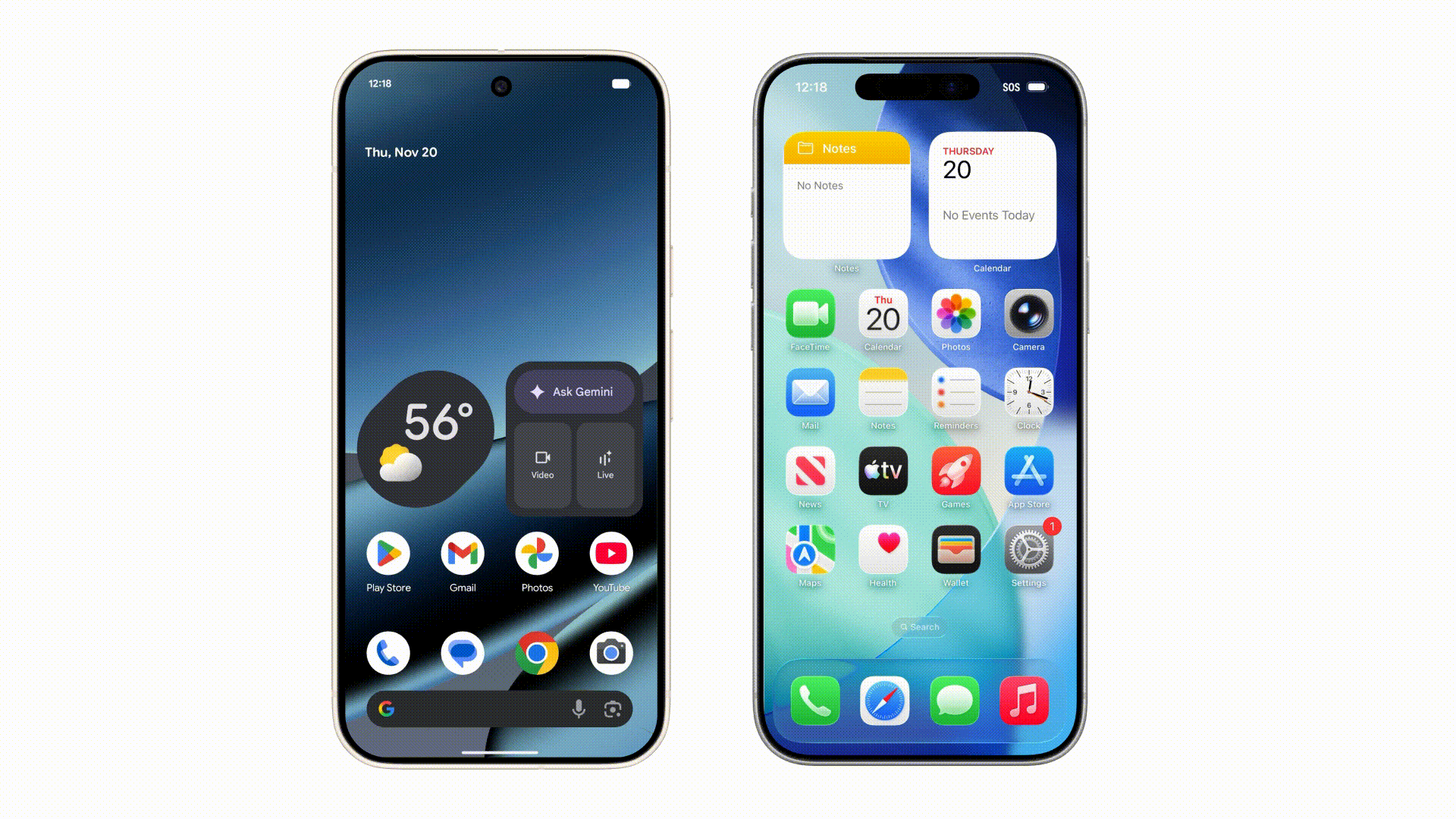
Quick Share auf Android-Handy mit AirDrop auf iPhone
(Bild: Google)
Die Bundesnetzagentur ist mit einer Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Damit ist ein jahrelanger Streit juristisch entschieden. Es war die erste Frequenzauktion der Bundesrepublik, bei der ausdrücklich auch 5G-Lizenzen vergeben wurden: Zwischen März und Juni 2019 wurden durch die Bundesnetzagentur an vier Mobilfunknetzbetreiber Blöcke im Bereich von 2 und 3,6 Gigahertz vergeben. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und erstmals auch 1&1 Drillisch lieferten sich dabei ein Bietergefecht, an dessen Ende 6,55 Milliarden Euro gezahlt wurden. Doch das Verfahren dazu war nicht sauber, wie das Verwaltungsgericht Köln im vergangenen Jahr festgestellt hat. Es war nicht unabhängig genug von politischer Einflussnahme. Das ist jetzt bestätigt: 5G-Auktion 2019 endgültig rechtswidrig.
Mona TeleICU von Clinomic soll für eine bessere Datenverfügbarkeit in der Telemedizin sorgen und die teleintensivmedizinische Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg ermöglichen. Die Plattform ist als zugelassenes Medizinprodukt der Risikoklasse IIa zertifiziert. Sie nutzt Ende-zu-Ende-verschlüsselte Peer-to-Peer-Verbindungen für den sicheren Datenaustausch in Echtzeit. Anders als herkömmliche Video- oder Konferenzsysteme überträgt Mona dabei nicht nur Audio und Video, sondern auch medizinische Daten direkt aus angeschlossenen Systemen. So entsteht eine vollständige Sicht auf alle relevanten Patienteninformationen, unabhängig vom Standort: Aachener Projekt Mona stellt Teleintensivmedizin für Europa bereit.
Ein Klick zu schnell, ein gespeicherter Account, ein Umzug, schon ist es passiert: Die Online-Bestellung geht an die falsche Adresse. Meist gibt es zwar eine Karenzzeit, in der man selbst Änderungen oder Stornierungen vornehmen kann. Noch besser kontrolliert man aber direkt vor dem Klick auf den Kaufen-Button noch einmal die Lieferadresse. Wer eine falsche Adresse bemerkt, sollte sofort handeln und am besten den Händler anrufen und parallel versuchen, die Adresse online zu ändern. Solange der Händler das Paket noch nicht an den Versanddienstleister übergeben hat, ist ihm eine Adressänderung zumutbar, sodass dieser weiterhin in der Pflicht steht. Wie Kunden ihr Recht auf bestehende Verträge am besten einfordern, klären wir im c‘t-Podcast Vorsicht Kunde: Vertragskonditionen gelten nach Fehllieferung weiter.
Weiterlesen nach der Anzeige
Auch noch wichtig:
(fds)
Künstliche Intelligenz
Google erlaubt den direkten Datenaustauch von iPhone und Android-Smartphones
Nutzer von Android-Smartphones greifen üblicherweise auf Messaging-Apps zurück, wenn sie etwa Bilder oder Videos an iPhone-Besitzer senden wollen, selbst wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden. Bei anderen Android-Handys ist dies mit „Quick Share“ möglich, vergleichbar mit Apples AirDrop. Doch jetzt erweitert Google diese Android-Systemfunktion um die Zusammenarbeit mit Apples Ökosystem, sodass Dateien nun auch vom Android-Handy direkt und kabellos zum iPhone geschickt werden können – und umgekehrt. Zunächst ist das erweiterte Quick Share für Smartphones der Pixel-10-Serie verfügbar.
Weiterlesen nach der Anzeige
Das kommt nicht überraschend. Schon Ende August wurde bekannt, dass Google mit Quick Share für iPhones und Macs experimentiert, nachdem entsprechende Hinweise im Code einer Beta-Version von Googles Play-Services-App gefunden wurden. Das deutete darauf hin, dass der Konzern daran arbeitet, Android besser mit iOS und macOS zu verzahnen. Damals ging man allerdings noch davon aus, dass iPhone- oder Mac-Nutzer eine entsprechende App für Quick Share auf ihren Geräten installieren müssten.
Quick Share mit Apple zunächst nur mit Pixel 10
Das erspart Google den Apple-Anwendern, indem Quick Share direkt mit Apples AirDrop kombiniert wird. Das ist bislang allerdings auf Pixel-10-Handys beschränkt. Wird Quick Share auf einem solchen Android-Smartphone aktiviert und eine oder mehrere Dateien zum Versand ausgewählt, findet das System nun auch iPhones in der näheren Umgebung. Wenn der Datentransfer gestartet wird, zeigt das Apple-Gerät eine entsprechende AirDrop-Benachrichtigung und fragt, ob die Datei(en) akzeptiert werden soll(en).

Quick Share auf Android-Handy mit AirDrop auf iPhone
(Bild: Google)
Umgekehrt können iPhone-Nutzer jetzt auch per AirDrop Dateien zu Android-Smartphones der Pixel-10-Serie schicken. Dafür ist es allerdings notwendig, auf dem Pixel 10 zunächst den Empfang zu aktivieren. Ansonsten wird das Android-Gerät nicht von Apples AirDrop gefunden.
Google betont Sicherheit, Macs und weitere Handys unklar
Google betont im eigenen Blog-Beitrag, dass diese Funktion „mit höchstem Sicherheitsanspruch entwickelt“ wurde und die Daten „von unabhängigen Sicherheitsexperten geprüften Sicherheitsvorkehrungen geschützt“ sind. Die Erweiterung von Quick Share ist demnach der nächste Schritt zu der „von Nutzern gewünschten besseren Kompatibilität zwischen Betriebssystemen“. Wann diese Funktion auf weitere Android-Geräte neben der Pixel-10-Serie ausgedehnt wird, erwähnt Google dabei allerdings nicht.
Weiterlesen nach der Anzeige
Diese Systemfunktion Androids war früher als „Nearby Share“ bekannt und hieß dann „Quick Share from Google“. Anfang dieses Jahres wurde Googles AirDrop-Alternative erneut umbenannt – in Quick Share. Ob und wann Quick Share künftig auch mit weiteren Apple-Geräten wie MacBooks funktionieren wird, ist ebenfalls noch unklar.
(fds)
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 Monaten„Buongiorno Brad“: Warum Brad Pitt für seinen Werbejob bei De’Longhi Italienisch büffeln muss
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenCreator und Communities: Das plant der neue Threads-Chef
-

 Entwicklung & Codevor 3 Monaten
Entwicklung & Codevor 3 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events















