Apps & Mobile Entwicklung
Pixel 10 Pro im ersten Test: Google-Flaggschiff in zwei Größen
Mit dem Pixel 10 Pro präsentiert Google seine Vorstellung eines Flaggschiff-Smartphones für das Jahr 2025 – und setzt dabei erneut konsequent auf Softwarekompetenz und KI-Integration. Wir haben das neue Topmodell ausführlich getestet und klären, ob sich der Kauf lohnt.
Google Pixel 10 Pro: Alle Angebote
Google Pixel 10 Pro: Preis und Verfügbarkeit
Das Pixel 10 Pro erscheint in zwei Displayvarianten: Die Standardversion mit 6,3 Zoll wirkt im Vergleich zu aktuellen Geräten angenehm kompakt und überzeugt durch ein hochwertiges Gehäuse mit kantigem Aluminiumrahmen und exzellenter Haptik. Die XL-Variante ist bis auf die Displaygröße baugleich. Hier bekommt Ihr satte 6,8 Zoll – also definitiv etwas für alle, die ein größeres Display bevorzugen. Beide Modelle bieten identische technische Spezifikationen, und selbst bei der Akkukapazität zeigen sich in unserem Test nur marginale Unterschiede.
Interessiert Ihr Euch für das neue Pixel-Smartphone, bekommt Ihr es bei MediaMarkt zum Launch im Bundle mit der Pixel Watch 3 geboten. In Verbindung mit einem der beiden Geräte zahlt Ihr für die Smartwatch in der 41-mm-Ausführung nur 199 Euro Aufpreis (UVP 399 Euro), während die größere 45-mm-Version mit 249 Euro zu Buche schlägt. Die Bundles findet Ihr auf der jeweiligen MediaMarkt-Produktseite unter „Unsere Top-Empfehlung“.
Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Diese Zusammenarbeit hatte keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.
Google Pixel 10 Pro: Design und Verarbeitung
| Design und Verarbeitung | |
|---|---|
| Bildschirm |
|
| Abmessungen und Gewicht |
|
| Widerstandsfähigkeit |
|
Mit seiner matten Glasrückseite und einem glänzend polierten Rahmen setzt das Pixel 10 Pro visuelle Akzente, die sich deutlich vom Mainstream abheben und das Smartphone klar als Pixel-Handy erkennbar machen. Der Rahmen erinnert optisch an Edelstahl, besteht jedoch aus poliertem Aluminium. Farblich stehen vier Varianten zur Auswahl: Obsidian (klassisches Schwarz), Moonstone (ein zurückhaltendes Blau-Grau), Porcelain (helles Silber-Weiß) sowie Jade – eine Kombination aus pastellgrüner Rückseite und goldenem Rahmen.
Die matten Rückseiten sind resistent gegenüber Fingerabdrücken, während der glänzende Rahmen hier weniger nachsichtig ist. In puncto Materialwahl könnte Google sich an Apple oder Samsung orientieren und künftig auf eine mattere Rahmenbeschichtung setzen.

Die Verarbeitungsqualität ist insgesamt exzellent. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Unter dem Display befindet sich ein Fingerabdrucksensor, der nun auf Ultraschalltechnologie setzt. Dieser entsperrt das Gerät zuverlässig, blitzschnell – und sogar bei feuchten Fingern. Auch die Audiokomponenten wurden überarbeitet: Die neuen Stereo-Lautsprecher liefern nicht nur mehr Lautstärke, sondern auch spürbar verbesserten Bass und ein ausgewogeneres Klangbild.
Ein technisches Alleinstellungsmerkmal ist die Unterstützung von Qi2 inklusive integrierter Magneten – sowohl mit als auch ohne Schutzhülle. Damit ist Google der erste große Hersteller, der vollständige Kompatibilität mit Apples MagSafe-Ökosystem bietet. Die Magneten halten stabil und ermöglichen den Einsatz von Zubehör wie magnetischen Powerbanks, Wallets oder Halterungen – ein klarer Pluspunkt für Nutzerinnen und Nutzer, die auf modulare Erweiterbarkeit setzen.
Google Pixel 10 Pro: Software
| Software | |
|---|---|
| Betriebssystem |
|
Längst ist das Betriebssystem auf Googles Pixel-Smartphones kein „pures Android“ mehr. Stattdessen setzt Google auf eine stark individualisierte Version mit zahlreichen exklusiven Funktionen, die auf anderen Geräten nicht verfügbar sind. Hier gibt es über die Pixeldrops regelmäßig Nachschub. Außerdem bekommen die Pixel-Smartphones neue Android-Versionen ohne Wartezeit immer zuerst ausgeliefert. Google garantiert mindestens 7 Jahre Update-Support ab Marktstart.
Mit der Pixel-10-Serie bringt Google erneut exklusive Funktionen auf den Markt – allen voran den neuen Live-Übersetzer. Zwar bieten auch Samsung und bald Apple ähnliche Features, doch im Test überzeugt das Pixel 10 Pro mit deutlich besserer Umsetzung. Die Funktion ist simpel, aber revolutionär: Während eines Telefonats kann der Live-Übersetzer aktiviert werden, der das Gespräch in Echtzeit lokal auf dem Gerät übersetzt – ganz ohne Internetverbindung. Besonders praktisch: Nur einer der Gesprächsteilnehmer muss ein Pixel 10 besitzen. Der andere kann jedes beliebige Telefon nutzen.
Was beeindruckt, ist die Geschwindigkeit und Natürlichkeit der Übersetzung. Noch während der Gesprächspartner spricht, wird die Übersetzung in der eigenen Stimme überlagert wiedergegeben – mit deutlich geringeren Verzögerungen als bei der Konkurrenz. Zwar ist die Übersetzung nicht immer perfekt, doch erstmals lässt sich ein echtes Gespräch mit simultaner KI-Übersetzung führen.

Google Pixel 10 Pro: Performance
| Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | |
| Speicher |
|
| Konnektivität |
|
Im Google Pixel 10 Pro (XL) kommt der hauseigene Tensor G5-Prozessor zum Einsatz. Rein auf dem Datenblatt betrachtet liegt der Tensor G5 in puncto CPU- und GPU-Leistung deutlich hinter der Konkurrenz von Snapdragon, MediaTek und Co. – teils mit nur etwa der Hälfte der theoretischen Performance. Dennoch zeigt sich im Alltag ein anderes Bild: Die Benutzeroberfläche reagiert flüssig, App-Starts erfolgen ohne Verzögerung, und auch Multitasking läuft stabil. Für die meisten Nutzerinnen und Nutzer dürfte die geringere Rohleistung daher kaum ins Gewicht fallen.
Allerdings bleibt festzuhalten, dass das Pixel 10 Pro weniger Leistungsreserven für anspruchsvolle Szenarien bietet – etwa bei intensiver Bildbearbeitung oder mobilen Games mit hohen Grafikansprüchen. Zudem zeigte sich bei früheren Pixel-Generationen, dass die Performance nach zwei bis drei Jahren spürbar nachlassen kann.
Wo der Tensor G5 hingegen klar punktet, ist im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Chip ist in der Lage, komplexe KI-Modelle direkt auf dem Gerät auszuführen – zum Teil gar ohne Cloud-Anbindung. Das ermöglicht eine Reihe innovativer Softwarefunktionen, etwa bei der Bildbearbeitung, Sprachverarbeitung oder Assistenzdiensten.
| Galaxy S25 Ultra (Snapdragon 8 Elite) |
Google Pixel 10 Pro (Tensor G5) |
Xiaomi 14T Pro (Dimensity 9300) |
|
|---|---|---|---|
| AnTuTu | 2.341.216 | 2.695.676 | 2.013.101 |
| 3DMark Wild Life Extreme Stresstest |
Bester Durchlauf: 6986 Schlechtester Durchlauf: 3253 Stabilität: 46,6 % |
Bester Durchlauf: 6986 Schlechtester Durchlauf: 3253 Stabilität: 46,6 % |
Bester Durchlauf: 6986 Schlechtester Durchlauf: 3253 Stabilität: 46,6 % |
| Geekbench 6 | Single-Core Score: 3187 Multi-Core Score: 9947 |
Single-Core Score: 3187 Multi-Core Score: 9947 |
Single-Core Score: 3187 Multi-Core Score: 9947 |
Google Pixel 10 Pro: Akku
| Batterie (Pixel 10 Pro) | Batterie (Pixel 10 Pro XL) | |
|---|---|---|
| Batteriekapazität |
4.870 mAh |
5.200 mAh |
| Ladegeschwindigkeit (per Kabel) |
30 W |
45 W |
| Ladegeschwindigkeit (kabellos) |
15 W |
25 W |
Im Test überraschte die Akkulaufzeit beider Pixel-10-Modelle: Trotz unterschiedlicher Akkugrößen – 4.870 mAh im Pixel 10 Pro und 5.200 mAh im XL-Modell – fällt die Laufzeit im Alltag nahezu identisch aus. Grund dafür ist das größere Display des XL-Modells, das den zusätzlichen Energiebedarf erklärt. Wer also auf längere Laufzeiten hofft, wird enttäuscht – beide Modelle liefern solide, aber keine überragende Ausdauer.
Beim Laden zeigt sich ein kleiner Vorteil für das XL-Modell: Es benötigt rund 1 Stunde und 20 Minuten für eine vollständige Ladung, während das reguläre Pixel 10 Pro 1 Stunde und 32 Minuten braucht. Schnellladen sieht allerdings anders aus – hier bleibt Google hinter der Konkurrenz aus China zurück.
Weniger erfreulich ist ein bekanntes Problem, das auch das Pixel 10 Pro betrifft: Die Software sieht eine Drosselung der Akkuleistung nach lediglich 200 Ladezyklen vor – ein Wert, der bei täglicher Nutzung bereits nach etwa einem Jahr erreicht wird. Danach kann die Akkulaufzeit spürbar sinken.
Zum Vergleich: Apple drosselt erst, wenn die Akkukapazität unter 80 Prozent fällt. Das ist meist erst nach 3 bis 4 Jahren der Fall. Zudem lässt sich die Funktion bei iPhones deaktivieren. Bei Google hingegen fehlt diese Möglichkeit. Das bedeutet: Nutzerinnen und Nutzer müssen sich unter Umständen bereits nach kurzer Zeit mit deutlich reduzierter Akkuleistung arrangieren.
Abschließendes Urteil
Das Pixel 10 Pro (XL) präsentiert sich als gelungene Weiterentwicklung seines Vorgängers. Google bleibt seiner Linie treu und setzt erneut auf starke Software-Features, die exklusiv auf Pixel-Geräten verfügbar sind. Der Live-Übersetzer und der neue Kamera-Coach sind nur zwei Beispiele für neue, exklusive Software-Features, welche die bereits vorhandenen Funktionen ergänzen.
Auch die Hardware überzeugt: Die Verarbeitung ist hochwertig, das Display hell und gestochen scharf, und die Lautsprecher liefern einen beeindruckenden Klang. Die Software punktet mit schnellen Updates und einem aufgeräumten Look – lediglich die eingeschränkten Möglichkeiten zur Personalisierung könnten manche Nutzer vermissen.
Ein Wermutstropfen bleibt die langfristige Haltbarkeit. Frühere Pixel-Modelle fielen nach ein bis zwei Jahren durch Performanceprobleme auf, und auch die frühzeitige Akkudrosselung nach rund 200 Ladezyklen wirft Fragen auf. Zwar zeigt sich im Test davon noch nichts, doch die Sorge bleibt.
Preise und Verfügbarkeit
Preislich startet das Pixel 10 Pro bei 1.099 Euro mit 16 GB RAM und 128 GB Speicher. Das XL-Modell beginnt bei 1.299 Euro und bietet bereits 256 GB in der Basisversion. Speicher-Upgrades sind wie gewohnt kostspielig, und nicht alle Farbvarianten sind für jede Konfiguration verfügbar. Immerhin: Erstmals sind beide Modelle mit bis zu einem Terabyte Speicher erhältlich.
-> Pixel 10 Pro bei MediaMarkt kaufen

Google Pixel 10 Pro
Zur Geräte-Datenbank
Apps & Mobile Entwicklung
Multiplayer-Benchmarks von Battlefield 6 – ComputerBase
Wie gut läuft der Multiplayer von Battlefield 6? ComputerBase hat 21 Grafikkarten von Nvidia, AMD und Intel im Test. Im Vergleich zur Kampagne (Benchmarks) zeigt der Multiplayer auch auf größeren Karten eine höhere Performance, zugleich verschieben sich die Verhältnisse zwischen den Grafikkarten etwas.
Multiplayer-Benchmarks von Battlefield 6 mit 21 Grafikkarten
Battlefield 6 (Kampagnen-Benchmarks) ist da und der Start ist nach einem enttäuschenden Vorgänger endlich wieder gelungen. Die Pressekritiken sind gut, der erste Eindruck der Spieler ist gut und die Spielerzahlen sind hoch. Auch die PC-Version hat im Test auf ComputerBase einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, Probleme zum Launch gab es, wurden aber behoben. Auch die Grafik hat ihre Probleme, kann aber spektakulär sein, die Performance ist hoch, das Frame Pacing passt und größere technische Probleme haben sich nicht gezeigt.
Jetzt folgen Multiplayer-Benchmarks
Für das Launch-Review hat die Redaktion die Einzelspieler-Kampagne für die Benchmarks genutzt, denn der Mehrspieler-Modus war zu diesem Zeitpunkt nicht reproduzierbar zu testen und darüber hinaus zu 90 Prozent mit Bots gefüllt. Nach dem Start des Spiels ist das natürlich anders und da in Battlefield 6 den Fokus auf den Multiplayer legt, hat die Redaktion entsprechende Tests nun nachgeholt.
Der Artikel dreht sich rein um eben jene Multiplayer-Benchmarks, weitere Aspekte werden an dieser Stelle nicht untersucht. Für weitere Analysen kann ein Blick in das Launch-Review von Battlefield 6 (Test) geworfen werden.
Das Testsystem und die Benchmark-Szene
Alle Benchmarks werden auf einem AMD Ryzen 7 9800X3D (Test) durchgeführt, der mit den Standardeinstellungen betrieben wird. Als Mainboard ist das Asus ROG Crosshair X670E Hero (BIOS 2506) verbaut.

Die CPU wird von einem Noctua NH-D15S mit zentral installiertem 140-mm-Lüfter gekühlt. 48 GB Speicher (G.Skill TridentZ Neo, 2 × 24 GB, DDR5-6000, CL30-38-38-96) stehen dem Prozessor zur Verfügung. Windows 11 24H2 mit sämtlichen Updates und aktiviertem HVCI ist auf einer NVMe-M.2-SSD mit PCIe 4.0 installiert. Dasselbe gilt für das Spiel. Resizable BAR wird auf unterstützten Grafikkarten sowohl bei AMD als auch bei Nvidia sowie Intel genutzt.
Die 20 Sekunden lange Testsequenz findet im All-Out-Warfare-Modus mit 64 Spielern auf der großen Karte „Mirak-Tal“ statt. Bei großer Sichtweite sind einige Gebäude sowie viel Vegetation zu sehen. Die Performance ist verhältnismäßig niedrig, andere Multiplayer-Karten laufen etwas besser. In Gefechten kann die Framerate jedoch auch unter das Niveau der Benchmarks fallen.
Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass die Tests aufgrund der Natur des Multiplayers nicht völlig reproduzierbar sind. Entsprechend kann es zwischen einzelnen Läufen kleinere Schwankungen geben, jedoch sind diese ziemlich klein und haben keinen größeren Einfluss auf die Ergebnisse.
Wichtig: Unterschiede beim Upsampling-Ansatz!
DLSS 4, FSR 4, FSR 3 und XeSS im gleichen Preset in einen Topf zu werfen, ist inzwischen immer seltener ein fairer Vergleich. Denn auf Systemen, die DLSS 4 (alle GeForce RTX) oder FSR 4 (RX 9000) unterstützen, fällt die Bildqualität um Längen besser aus als mit FSR 3, das sogar schneller läuft – aber eben bei sichtbar schlechterer Bildqualität. Und es erscheinen immer mehr Spiele, die exklusiv mit DLSS 4 ausgestattet sind und auch FSR 4 unterstützen. Daher hat ComputerBase eine – im Podcast schon wiederholt besprochene – weitreichende Entscheidung getroffen:
Wenn DLSS 4 und FSR 4 unterstützt werden, dann …
Unterstützt ein Spiel DLSS 4 sowie FSR 4, wird auf älteren Radeons kein FSR 3.1 mit der gleichen Renderauflösung mehr genutzt, sondern stattdessen ein besseres Upsampling mit einer höheren Auflösung oder alternativ die native Auflösung mitsamt dem spieleigenen TAA – das ist davon abhängig, in welchem Leistungs-Modus mit DLSS 4 und FSR 4 getestet wird. So ist die Bildqualität eher vergleichbar und der unfaire Performance-Vorteil nicht mehr vorhanden.
Im Falle von Battlefield 6 bedeutet dies: DLSS 4 sowie FSR 4 laufen auf entsprechenden Grafikkarten im Quality-Modus (Skalierungsfaktor 1.5×), während ältere Radeons sowie Intel Arc mit XeSS Ultra Quality Plus laufen (Skalierungsfaktor 1.3×).
Benchmarks in WQHD, UWQHD und Ultra HD
- Die Performance ist auch auf großen Multiplayer-Karten deutlich besser als in der Kampagne
- Es verschieben sich die Verhältnisse im Multiplayer: AMD Radeon legt dabei mehr zu als Nvidia GeForce
- Der VRAM-bedarf ist höher als in der Kampagne, 8 GB in Verbindung mit PCIe ×8 sind zu wenig für maximale Texturdetails
- RDNA 4 ist stärker als in der Kampagne, in niedrigen Auflösungen etwas hinter GeForce, in hohen gleich auf
- Nvidia Blackwell ist etwas besser unterwegs als Nvidia Lovelace
- Die Intel Arc A770 ist leicht schneller als die Arc B580 – das ist selten
Und was ist mit dem Prozessor?
Auch im Multiplayer hat in Battlefield 6 die Grafikkarte das Kommando über die Performance, der Prozessor spielt nur eine untergeordnete Rolle. Bei einem ausgeglichenen System limitiert zuerst die GPU und dann erst die CPU, was in früheren Battlefield-Teilen durchaus auch schon einmal anders herum gewesen ist.
Der Prozessor ist nur in zwei verschiedenen Szenarien wichtig: Wenn das System unausgeglichen ist, also eine verhältnismäßig starke GPU mit einer verhältnismäßig schwachen CPU genutzt wird. Und wenn sehr hohe Frameraten erzielt werden sollen. Für 200 Bilder pro Sekunde benötigt es dann auch einen sehr schnellen Prozessor, dann hat auch ein Ryzen 7 9800X3D einiges zu tun.
8 GB VRAM ist zu wenig
Fazit
Battlefield 6 verhält sich im Multiplayer etwas anders als im Einzelspieler-Modus. Alle Grafikkarten laufen auch auf großen Maps mit durchweg höheren Frameraten als in der Kampagne, zumindest wenn der Grafikkartenspeicher ausreicht. Die Anforderungen an diesen sind auf den großen Karten etwas höher als in den kleineren Streaming-Abschnitten, 8 GB VRAM sind für maximale Grafikdetails nun definitiv zu wenig.
In den Benchmarks zeigt sich dann, dass Radeon-Grafikkarten im Multiplayer zulegen, sodass nun die aktuelle RX-9000-Riege in niedrigen Auflösungen zwar noch etwas langsamer als die RTX-5000-Produkte agiert, in höheren dagegen gleich schnell. Bei den Nvidia-Karten untereinander schneidet Blackwell dann leicht besser ab als Ada Lovelace, bei den Intel-Karten ist derweil die Arc A770 überraschenderweise geringfügig schneller als die Arc B580 – das passiert nicht häufig.
Der Prozessor ist (meistens) nicht so wichtig
Was nicht nur für die Kampagne, sondern auch für den Mehrspieler-Modus gilt ist, dass der Prozessor in Battlefield 6 keine sonderlich große Rolle spielt. Einzig bei unausgeglichenen Systemen oder wenn hohe Frameraten von um die 200 FPS erreicht werden sollen, bestimmt der Prozessor die Performance. Ansonsten ist es durchweg die Grafikkarte.
Die Technik von Battlefield 6 läuft auf dem PC im Multiplayer-Modus genauso gut wie in der Kampagne. Abstürze hat es während des Tests keine gegeben, Traversal-Stotterer zeigen sich anders als in der Kampagne ebenso wenig. Auch die Server halten der Belastung stand, auch wenn es manchmal eine kürzere Warteschlange gibt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
Apps & Mobile Entwicklung
Hier bekommt Ihr sie jetzt am günstigsten
Die Apple Watch ist so beliebt, wie kaum eine andere Smartwatch. Vor allem im Ökosystem des Herstellers pflegt sich das Wearable perfekt ein. Der Onlineshop Gomibo verkauft mit der Apple Watch 10 jetzt das Vorjahresmodell in einer besonderen Variante so günstig wie nie zuvor. Wir haben uns den Deal näher für Euch angeschaut.
Im September hat Apple die 11. Generation seiner beliebten Smartwatch veröffentlicht. Dementsprechend sollten die Preise vergangener Modelle sinken. Allerdings kostet die Apple Watch 10 noch immer zwischen 370 und 400 Euro. Ein aktueller Deal bei Gomibo* haut die beliebte Smartwatch jetzt allerdings zum deutlich günstigeren Kurs raus.
Das günstigste Angebot zur Apple Watch 10?
Der niederländische Online-Händler ist für seine spannende Preispolitik bekannt. Während Ihr hier unter anderem eine Vielzahl von OnePlus-Produkten geboten bekommt, gibt es auch hin und wieder Geräte von Apple zu spannenden Preisen. Bestes Beispiel ist der aktuelle Deal zur Apple Watch 10, die Ihr jetzt für 356,95 Euro ergattern könnt*. Günstiger gibt’s die Apple-Smartwatch derzeit nicht.
Angeboten wird die GPS-Variante der Smartwatch. Bei der Farbe handelt es sich um Roségold und ein blassrosa-farbenes Sportarmband in der Größe S/M. Für dieses Modell gab es tatsächlich sogar noch kein besseres Angebot im Netz, wie ein Preisvergleich zeigt. Der aktuell nächstbeste Deal liegt mit 383,99 Euro ebenfalls etwas höher. Interessiert Ihr Euch also für die gebotene 42-mm-Variante der Apple Watch 10, bekommt Ihr bei Gomibo tatsächlich das bisher günstigste Angebot*.
Apple Watch 10: Darum ist die Smartwatch so begehrt
Das Display der Apple Watch 10 ist eines der Highlights der Smartwatch. Mit bis zu 2.000 Nits Helligkeit und einem verbesserten Blickwinkel lässt es sich in den meisten Situationen klar ablesen. Hinzu kommt der leistungsstarke S10-Chip, der schneller arbeitet, als alle anderen Vorgängermodelle. Neben zahlreichen Sensoren zum Tracking Eurer Körperfunktionen, wie etwa einer Herzfrequenzmessung oder Bewegungssensoren, hat die Apple Watch 10 erstmals die Möglichkeit, Unregelmäßigkeiten in Eurem Schlaf zu erkennen.

Ich leide beispielsweise an Schlafapnoe. Mit der Apple-Smartwatch erhalte ich detaillierte Informationen zu möglichen Atemaussetzern und kann diese mit meinem Arzt durchgehen. Natürlich sind auch zahlreiche Sportfunktionen vorhanden – selbst Wassersport-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Ist das angebotene Sportarmband nicht nach Eurem Geschmack, könnt Ihr zudem auch alte Armbänder nutzen. Etwas schade ist lediglich die schwächelnde Akkulaufzeit, die auch für einen Punktabzug in unserem Test zur Apple Watch 10 führte.
Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Apple Watch 10 interessant für Euch oder habt Ihr bereits ein Auge auf das Nachfolgemodell geworfen? Lasst es uns wissen!
Apps & Mobile Entwicklung
12-Platter-Technik: Toshiba packt noch eine Scheibe in seine Festplatten
Wie viele Scheiben passen in eine herkömmliche 3,5-Zoll-HDD? Bei Toshiba lautet die Antwort fortan: 12. Der Hersteller macht also das Dutzend voll und will damit bis 2027 auf eine Speicherkapazität von 40 TB kommen.
Noch ist es allerdings Zukunftsmusik, denn ein marktreifes Produkt gibt es mit der 12-Platter-Technik noch nicht. Toshiba verkündet aber, dass das 12-Disk-Design erfolgreich für den späteren Einsatz verifiziert wurde. Damit wäre Toshiba dem Konkurrenten Western Digital, der bisher bis zu 11 Scheiben einsetzt, eine Scheibe voraus. Seagate setzt weiterhin auf maximal 10 Disks, kombiniert diese aber schon mit HAMR-Technik für höhere Bitdichten pro Scheibe.
- WD Red Pro 26 TB im Test: Elf Magnetscheiben gegen die Laser-Technik HAMR
Den Einsatz der HAMR-Technik kann Toshiba wiederum dank des 12-Disk-Designs noch einmal weiter nach hinten schieben. Auf der letzten öffentlichen Roadmap hatte Toshiba seine ersten HAMR-Festplatten bereits auf das Jahr 2025 datiert, doch daraus wird nichts. Jetzt will Toshiba nämlich das 12-Disk-Design zunächst weiterhin mit seiner MAMR-Technik kombinieren und damit im Jahr 2027 auf 40 TB Speicherkapazität kommen. Erst irgendwann danach wird auch eine Kombination aus HAMR und 12-Platter-Design erwogen.
Seagate ist bisher der einzige Hersteller, der bereits HAMR-Festplatten auf dem Markt hat. Mit nur 10 Scheiben kann Seagate dank der hohen Flächendichte auf 36 TB kommen.
Glas statt Aluminium
Die Erhöhung auf 12 Platter wurde laut Toshiba unter anderem dadurch möglich, dass nun statt der in diesem Formfaktor üblichen Aluminium-Platter auf Glasplatter gewechselt wurde. Diese können nämlich dünner ausfallen. Außerdem wurden nicht näher spezifizierte „dedizierte Teile im Stapel“ erneuert.
Der Einsatz von Glasplattern ist eigentlich keine technische Neuerung, schließlich werden diese seit Jahren bereits bei 2,5-Zoll-HDDs für Notebooks eingesetzt. Allerdings sind diese teurer als Aluminium-Scheiben, weshalb möglichst auf diese verzichtet wurde.
Der japanische Hersteller Hoya hatte schon vor acht Jahren neue Glassubstrate für 0,381 mm dünne Platter entwickelt, die eben 12 Platter in einem 3,5-Zoll-HDD-Gehäuse mit üblicher Bauhöhe von rund einem Zoll (25,4 mm) ermöglichen.
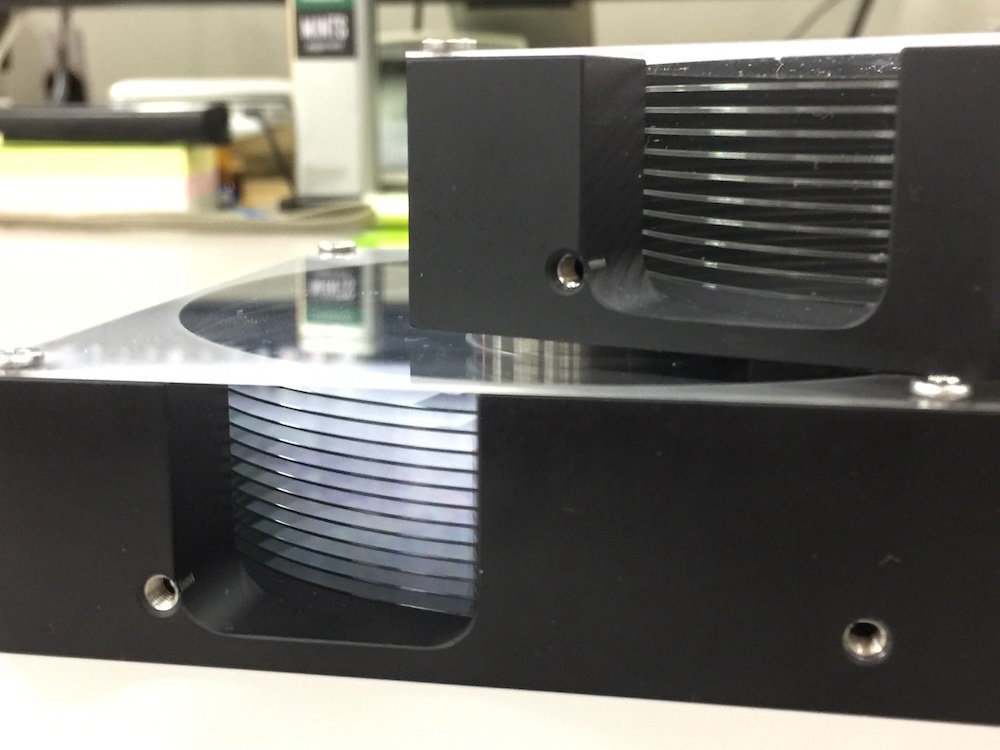
Auf dem am 17. Oktober stattfindenden IDEMA-Symposium im japanischen Kawasaki will Toshiba die 12-Disk-Stacking-Technologie näher vorstellen.
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 1 Monat
Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows














