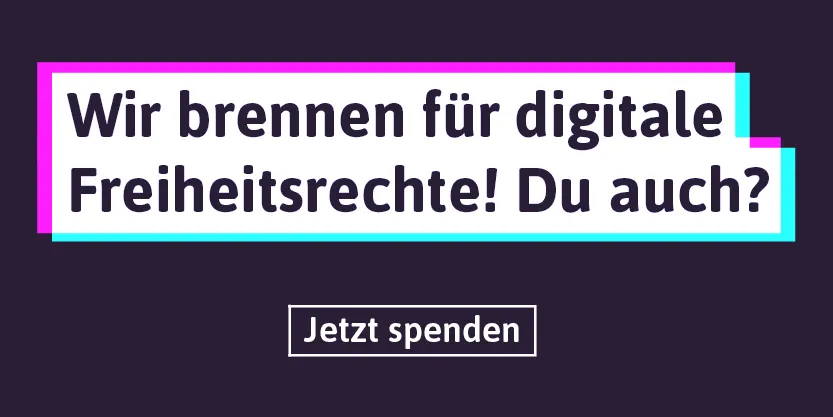„Näher an China als am Grundgesetz“, „rechts-autoritärer Entwurf“ und „bewusster Verfassungsbruch“ – die Kritik an der geplanten Novelle des Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes (SächsPVDG) war harsch und kam, angesichts der vielen neuen Polizeibefugnisse auf Kosten der Grundrechte, auch nicht überraschend.
Nun stimmt mit der SPD sogar ein Teil der Regierungskoalition in den Chor der Kritiker ein. Damit wird es immer unwahrscheinlicher, dass alle Verschärfungen aus dem Entwurf es auch in das finale Gesetz schaffen.
Die SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag kritisiert in einer Stellungnahme an das Innenministerium, die wir vorab einsehen konnten, einige der vielen Verschärfungen, die der Entwurf aus dem sächsischen Innenministerium vorsieht.
Was die SPD mitträgt
Man müsse auf die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen reagieren, schreibt Henning Homann, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, in der Einleitung der Stellungnahme. Zugleich gelte es Maß und Mitte bei einer Überarbeitung der polizeilichen Rechtsnormen zu wahren. „Denn nicht alles, was technisch möglich oder verfassungsrechtlich gerade noch zulässig ist, ist auch sinnvoll oder geboten.“
Das kann man schon als deutliche Distanzierung von dem Entwurf des Innenministeriums interpretieren, der sich teilweise mehr liest wie eine Polizeiwunschliste.
Die SPD-Fraktion begrüßt aber auch einige Punkte des Gesetzes, etwa zur Drohnenabwehr und bei Fällen häuslicher Gewalt. Kein kritisches Wort verliert sie zudem über den Abgleich von Gesichtern und Stimmen mit Daten aus dem Internet, obwohl das Vorhaben laut einem Gutachten von AlgorithmWatch nicht legal umsetzbar ist.
Doch selbst bei manchen Punkten, die die SPD laut Stellungnahme mittragen will, geht sie einen Schritt weg vom Entwurf. Laut diesem sollten Polizist:innen Bodycams künftig auch in Wohnungen einsetzen dürfen. Die SPD möchte das nicht gleich ermöglichen, sondern erstmal prüfen – und bezieht sich damit auf den Koalitionsvertrag.
Jein zu Staatstrojanern
Auch den Einsatz von Staatstrojanern (Quellen-TKÜ) „zur Abwehr erheblicher terroristischer Gefahren oder zur Verhinderung schwerster Kapitalverbrechen, bei denen der Rückgriff auf strafprozessuale Befugnisse ausscheidet“ will die SPD-Fraktion mittragen. Das haben CDU und SPD ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbart.
Kritisch sieht die SPD-Fraktion allerdings den Einsatz von Staatstrojanern gegen IT-Systeme von Dritten. Diese sollen laut Gesetzentwurf auch dann angezapft werden können, wenn „Tatsachen die Annahme rechtfertigen“, dass ein anderer Mensch das gleiche Gerät wie eine zu überwachende Person benutzt oder für ihn Meldungen weitergibt. Die SPD möchte den Staatstrojaner-Einsatz gegen Dritte weiterhin erlauben, aber nur in Fällen, in denen eine „gegenwärtige Gefahr“ besteht für die Sicherheit des Bundes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person.
Keine Auswertungssoftware von Palantir
In der Stellungnahme bekräftigt die SPD-Fraktion auch ihr Nein zu Palantir. Zwar trägt die Partei grundsätzlich die Einführung einer Polizeisoftware zur Analyse von personenbezogenen Daten mittels Künstlicher Intelligenz mit. Die Firma des Tech-Milliardärs Peter Thiel soll aber nicht nach Sachsen kommen.
„Aufgrund schwerwiegender Bedenken gegenüber dem Unternehmen, seinem Gründer und Investoren sowie dem bestehenden Missbrauchspotenzial, das die Einspeisung enormer personenbezogener Datensätze in ein solches System und der Speicherung auf Servern außerhalb der Europäischen Union bereithält, kommt für die polizeiliche Nutzung einer solchen KI-Anwendung nur ein nationales oder europäisches Produkt in Frage, das entsprechend der Unionsregelung zum Daten- und Grundrechteschutz entwickelt und ausgestaltet wurde“, hält die SPD fest.
Bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs hatte Innenminister Armin Schuster laut Sächsischer Zeitung noch gesagt, dass es keine Vorfestlegung auf Palantir oder einen anderen Anbieter gebe. Laut SPD-Fraktion habe man sich sogar darauf geeinigt, dass Palantir ausgeschlossen werde. Die CDU-Fraktion beantwortete die Frage von netzpolitik.org nach dem genauen Inhalt der Einigung nicht.
Enge Grenzen bei Trainingsdaten
Die SPD-Fraktion setzt sich auch dafür ein, dass die Polizei kein lernendes, sondern ein „austrainiertes“, also deterministisches System bekommt. Damit soll verhindert werden, dass personenbezogene Daten bei der Polizei zur Trainingsmasse der KI werden und dadurch dauerhaft im System verbleiben.
Die SPD-Fraktion will auch „kritisch überprüfen“ lassen, ob man polizeilich erhobene Daten an Dritte zum Training von KI-Systemen übermitteln soll. Insbesondere die Übermittlung an kommerzielle Dienste in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union sieht die Fraktion kritisch.
Doch keine Drohnen, die in Autos starren?
Zu den Punkten, die der SächsPVDG-Novelle mit am meisten Kritik bescherten, gehört die Videoüberwachung des öffentlichen Verkehrsraums. Das Innenministerium will, dass die sächsische Polizei künftig anlasslos in Autos filmen darf, um Menschen mit Handy am Steuer zu erwischen. Dazu soll die Polizei auch Drohnen einsetzen dürfen.
Die SPD ist hier nach eigener Aussage „grundsätzlich skeptisch […], da es bei einer solchen Maßnahme zu einer anlasslosen und massenhaften Erhebung personenbezogener Daten kommt, die tief in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung einer Vielzahl unbeteiligter Personen eingreift.“ Die Maßnahme sei nicht verhältnismäßig, es gebe auch keinen statistischen Beleg, dass Handys am Steuer eine wichtige Unfallursache seien, schreibt die SPD weiter und verweist auf die Stellungnahme der Unabhängigen Beschwerdestelle der Polizei. Letztere zweifelt auch die Gesetzgebungskompetenz des Freistaats Sachsen in dieser Frage generell an.
KI-gestützte Videoüberwachung
Ein weiterer Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung sind die geplanten Maßnahmen zur Videoüberwachung mit Künstlicher Intelligenz. Auch gegen diesen Paragrafen spricht sich die SPD aus.
Er soll zum einen ermöglichen, dass eine Software Waffen und gefährliche Gegenstände erkennt sowie Bewegungsmuster, „die auf die Begehung einer Straftat hindeuten“. Vorbild ist ein Projekt in Mannheim.
Zum anderen soll die Software auch Menschen nachverfolgen können, deren Bewegungsmuster auffällig waren, sofern ein Polizist das bestätigt. Mit richterlicher Anordnung oder bei Gefahr im Verzug darf die Polizei auch einen Abgleich der gefilmten Gesichter mit den eigenen Auskunfts- und Fahndungssystemen durchführen.
Insbesondere diese Nachverfolgung und „Echtzeit-Fernidentifizierung“ stört die SPD. Die Eingriffsschwelle sei zu niedrig und es sei auch nicht ersichtlich, „inwiefern der bloße biometrische Abgleich […] zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr dienen soll“. Dafür brauche es das aktive Einschreiten von Polizist:innen, argumentiert die SPD.
Beschränkte Erprobung von Tasern
Auch die geplante flächenmäßige Ausstattung von Polizist:innen mit Tasern soll nach dem Willen der SPD nicht flächenmäßig erfolgen, sondern sich zunächst auf zwei der fünf Polizeidirektionen beschränken. „Die Erprobung ist folgerichtig mit einer Evaluationspflicht und einer gesetzlichen Befristung zu versehen“, schreibt die sozialdemokratische Fraktion.
Außerdem will die SPD-Fraktion den im Gesetzentwurf mehrmals wiederkehrenden Begriff der „Vorfeldstraftat“ durch den juristischen Begriff der „strafbewehrten Vorbereitungshandlung“ ersetzen. Das ist wichtig, weil die „Vorfeldstraftat“ im Gesetzentwurf oft schon Überwachungsmaßnahmen erlauben.
Druck innerhalb und außerhalb der SPD
Wie kommt es nun aber, dass die SPD-Fraktion den Entwurf so deutlich kritisiert, während die SPD-Minister:innen den Entwurf im Kabinett abgesegnet haben?
Uns fehlen dieses
Jahr noch 171.843 Euro.
Bist Du auch Feuer und Flamme für Grundrechte?
Dann unterstütze jetzt unsere Arbeit mit einer Spende.
Bist Du auch Feuer und Flamme für Grundrechte?
Dann unterstütze jetzt unsere Arbeit mit einer Spende.
Möglicherweise war auch der Druck inner- und außerhalb der eigenen Partei ausschlaggebend. Mit den Jusos Sachsen hatte der eigene Jugendverband den Gesetzesentwurf schon im Oktober Punkt für Punkt scharf kritisiert. „Sicherheit entsteht durch Rechtsstaatlichkeit, Vertrauen und soziale Stabilität, nicht durch permanente Datenerhebung“, heißt es in deren Positionspapier.
Auch die 86 eingereichten Stellungnahmen von Bürger:innen über das Beteiligungsportal fielen in überwältigender Mehrheit gegen die vielen Befugniserweiterungen aus. Wir haben sie mithilfe des Sächsischen Transparenzgesetzes befreit. Zur Beteiligung über das Portal hatten unter anderem der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann sowie die Aktivistin und Piratenpolitikerin Stephanie Henkel aufgerufen.
Die SPD-Fraktion verweist in ihrer Stellungnahme zudem immer wieder auf die Einschätzungen von angefragten Fachverbänden, wie etwa der Landesdatenschutzbeauftragten, dem Bund Deutscher Kriminalbeamter und der Unabhängigen Beschwerdestelle.
SPD und CDU: Kein Widerspruch, sondern business as usual
Aus Sicht der Koalition steht die Zustimmung im Kabinett und die Stellungnahme der SPD-Fraktion in keinem Widerspruch. So sagt der sächsische SPD-Wirtschaftsminister Dirk Panter gegenüber netzpolitik.org: „Der aktuelle Entwurf ist ein Kompromiss, auf dessen Grundlage der Sächsische Landtag und die Verbände angehört werden. Das Kabinett war sich deswegen einig, dass es den Entwurf freigibt.“
Auch der Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Fischer, betont gegenüber netzpolitik.org, dass der Kabinettsbeschluss nur voraussetze, dass der Entwurf von beiden Koalitionspartnern grundsätzlich mitgetragen werde. „Mit dem Entwurf wurde aber nicht der abschließende Wille des Gesetzgebers oder der Koalitionsfraktionen festgelegt.“ Konsultationsmechanismus und parlamentarisches Verfahren seien genau dafür vorgesehen, Änderungswünsche zu formulieren und Verbände anzuhören. In anderen Worten: business as usual.
Was heißt das für die Erfolgschancen des Entwurfs?
Nichtsdestotrotz verringert die Kritik der SPD eher das Risiko, dass der Entwurf mit seinen vielen Grundrechtseinschränkungen genau so kommt, wie vom Innenministerium vorgesehen. Grund dafür ist die Mehrheitssituation im sächsischen Landtag. CDU und SPD stellen hier nur eine Minderheitsregierung, brauchen also mindestens zehn weitere Stimmen, müssen also mit einer oder mehreren Oppositionsparteien kooperieren.
Eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD würde voraussichtlich die Koalition sprengen, denn im Koalitionsvertrag heißt es: „Eine Zusammenarbeit oder eine Suche nach parlamentarischen Mehrheiten mit der AfD als gesichert rechtsextrem eingestufter Partei wird es durch die neue Regierung und die Koalitionsfraktionen nicht geben.“
Für die Verhandlungen mit den übrigen Parteien ändert sich durch die SPD-Position die Dynamik. Nun verhandelt die Regierungskoalition nicht mehr geschlossen mit einer Oppositionsfraktion, um möglichst große Teile des Entwurfs durchzubekommen. Stattdessen wollen – abgesehen vom Innenministerium und der CDU – sowohl die SPD als auch andere Fraktionen den Entwurf eher abschwächen.
BSW schweigt zu seiner Position
Grüne und Linke hatten sich besonders deutlich gegen den Entwurf geäußert, sprachen wie Rico Gebhardt (Linke) von einer „endlosen Polizeiwunschliste“ und einem „Gift der Überwachung“, welches näher an der Praxis Chinas sei als am Grundgesetz, wie Valentin Lippmann (Grüne) sagte. Zudem müssten aufgrund ihrer Größen beide Fraktionen gemeinsam überzeugt werden.
Daher liegt der Fokus auf dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Wie sich das BSW hier positionieren wird, ist aktuell unklar. Auf Anfragen von netzpolitik.org antwortete die BSW-Fraktion nicht.
In seinem Wahlprogramm zur Landtagswahl 2024 schrieb das BSW Sachsen noch: „Wir stehen für eine vernünftige Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Einen übergriffigen Staat lehnen wir ab, weshalb immer die Verhältnismäßigkeit der Mittel und die universelle Unschuldsvermutung gelten müssen. Jedermann soll sich in der Öffentlichkeit frei entfalten können, ohne Angst vor Beobachtung und Überwachung. Mehr Polizisten auf der Straße und in Problemvierteln sind im Bedarfsfall eine größere Hilfe als mehr Videokameras.“
Daran wird sich das BSW messen lassen müssen.