Datenschutz & Sicherheit
KW 34: Die Woche, in der wir Wischiwaschi-Belege entzaubert haben
Die 35. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 17 neue Texte mit insgesamt 248.128 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.
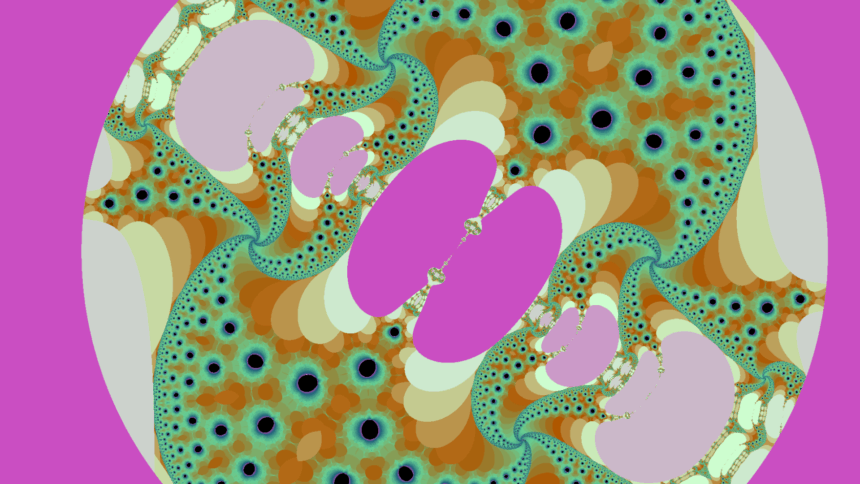
Liebe Leser:innen,
ich liebe es, wenn jemand sagt, dass etwas wissenschaftlich nachgewiesen sei. Oder dass Studien eine Behauptung belegen würden. Denn das ist immer eine Einladung nachzubohren. Denn die gern als Seriositätsverstärker erwähnten Studien, Untersuchungen und Nachweise fristen regelmäßig ein Dasein im Nebel.
Wenn man fragt, um welche Quellen es genau geht, wird es manchmal schnell weniger seriös und standfest, als man zuvor zu suggerieren versucht hat. Manchmal bekommt man dann trotz mehrmaliger Nachfragen keine konkreten Papiere, sondern Pressemitteilungen genannt. Manchmal existieren die Studien zwar, passen aber nur mittelgut zur aufgestellten These oder erweisen sich als deutlich differenzierter als die Schaufenster-Behauptung, die sie schmücken sollen.
Und manchmal führt der Verweis auf Wissenschaft und Forschung in die Irre, wie in dieser Woche bei einem Statement des Drogenbeauftragten Hendrik Streeck (CDU). Da mussten Untersuchungen zu den Auswirkungen medialer Darstellung von Drogenkonsum als Argumentationshilfe für Alterskontrollen im Allgemeinen herhalten. Mein Kollege Sebastian hat das herausgearbeitet und fragt: „Heißt das, Erotik macht Durst auf Bier?“
Ich finde es wichtig, immer wieder genau hinzusehen, wenn jemand nicht näher definierte Belege wie eine Monstranz vor sich herträgt. Denn im besten Fall lässt sich aus den Verweisen Genaueres lernen. Denn wer die Quelle kennt, kann sich selbst informieren. Und das mögen wir sehr.
Bleibt kritisch!
anna
Breakpoint: Gefangen in der Vereinzelung
Ein neoliberaler Zeitgeist rät uns zu Einsamkeit und Ignoranz, damit wir uns besser fühlen. Doch was wir brauchen, ist das genaue Gegenteil: mehr Sorge füreinander und mehr Gemeinschaft. Von Carla Siepmann –
Artikel lesen
Ransomware und IT-Störungen: Wir brauchen ein kommunales Lagebild zur Informationssicherheit
Welche digitalen Angriffe und IT-Störungen verzeichnen die Kommunen? Der IT-Situation in Städten, Gemeinden und Landkreisen widmet sich das Projekt „Kommunaler Notbetrieb“. Im Interview erklärt Initiator Jens Lange, was ihn antreibt und wie man mitmachen kann. Von Constanze –
Artikel lesen
Bundesdatenschutzbeauftragte: Streit um Facebook-Seiten der Bundesregierung geht weiter
Seit fast 15 Jahren ringen Datenschützer:innen und Behörden um Facebook-Seiten. Nachdem ein Verwaltungsgericht kürzlich der Bundesregierung grünes Licht gegeben hatte, geht die Bundesdatenschutzbeauftragte in Berufung. Von Ingo Dachwitz –
Artikel lesen
„Digitale Souveränität“: BSI-Chefin Plattner erntet Widerspruch
Die BSI-Präsidentin bekommt Gegenwind in Fragen der digitalen Unabhängigkeit. Sie schaffe mit ihren Aussagen „Verunsicherung in Politik und Wirtschaft“, so der Wirtschaftsverband OSBA. Viele Abhängigkeiten könnten sehr wohl kurzfristig abgebaut werden, wenn Lösungen aus Europa gezielter berücksichtigt würden, heißt es in einem offenen Brief. Die Angesprochene rudert zurück. Von Constanze –
Artikel lesen
Recht auf Teilhabe: Kinderhilfswerk stellt sich gegen Handyverbot an Schulen
In einem offenen Brief warnen unter anderem das Kinderhilfswerk, der Bundeselternrat und der Verein D64 vor pauschalen Smartphone-Verboten in der Schule. Stattdessen sollten Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern gemeinsame Regeln entwickeln. Von Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Gesetzentwurf: Elektronische Fußfesseln sollen Täter*innen auf Abstand halten
Durch elektronische Fußfesseln sollen Täter*innen ihren potenziellen Opfern nicht zu nahe kommen. Die Pläne aus dem Justizministerium richten sich vor allem gegen häusliche Gewalt. Fachleute weisen auf den eher begrenzten Nutzen hin. Von Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Daten beim Hotel-Check-in: Wer hat in meinem Bettchen gelegen?
Einer der mutmaßlichen North-Stream-Saboteure flog auf, weil er sich in einem italienischen Hotel anmeldete und seine Daten bei der Polizei landeten. Wie sind die Ermittler:innen an die Informationen gelangt und wie ist die Situation für Reisende bei Übernachtungen in Deutschland? Von Anna Biselli –
Artikel lesen
Datenweitergabe an die Polizei: Eure Chats mit ChatGPT sind nicht privat
Menschen vertrauen ChatGPT intimste Informationen an. Der Hersteller scannt die Chats, lässt sie von Moderator*innen lesen und gibt sie in bestimmten Fällen sogar an die Polizei weiter. Das hat das KI-Unternehmen Open AI als Sicherheitsmaßnahme nach einem Suizid eines Nutzers verkündet. Von Martin Schwarzbeck –
Artikel lesen
Bildungs-ID: Bundesregierung will Schüler zentral erfassen
Die Bundesregierung will die zentrale Schüler-ID. Doch Datenschützer*innen, Wissenschaftler*innen und Gewerkschafter*innen sind sich einig: Die Privatsphäre Minderjähriger steht auf dem Spiel. Von Esther Menhard –
Artikel lesen
Alterskontrollen im Netz: Drogenbeauftragter Streeck argumentiert unsauber
Ein Zitat des Drogenbeauftragten ging diese Woche durch große Nachrichtenmedien. Mit angeblich wissenschaftlicher Begründung sprach sich Hendrik Streeck (CDU) für Alterskontrollen im Netz aus. Doch an dem Zitat ist etwas faul. Ein Kommentar. Von Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Schüler-ID: Magischer Glaube an die zentrale Datenbank
Politiker:innen verbinden mit der zentralen Schüler-ID große Hoffnungen. Doch primär entsteht ein großes Datenschutzproblem und noch mehr Überwachung. Investitionen in Bildung könnten ganz woanders gebraucht werden. Ein Kommentar. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Umstrittene Massenüberwachung: Von diesen Ländern hängt ab, wie es mit der Chatkontrolle weitergeht
Bei der Chatkontrolle gibt es weiterhin keine Einigung der EU-Länder. Anstehende Wahlen und jüngste Regierungswechsel machen Bürgerrechtler:innen nervös. Wenn einige Länder ihre Position ändern, könnte das Überwachungsprojekt doch noch durchkommen. Ein Überblick. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Eckpunkte für mehr „Cybersicherheit“: Gefährlich unkonkret
Innenminister Dobrindt will mehr Sicherheit für IT-Systeme, das Bundeskabinett hat dafür Eckpunkte beschlossen. Während dem Ziel wohl kaum einer widersprechen würde, bleiben die Mittel beunruhigend vage. Das wird dem Thema und möglichen Folgen nicht gerecht. Von Anna Biselli –
Artikel lesen
Als erstes Bundesland: Hessen setzt Live-Gesichtserkennung ein
50 Kameras filmen das Geschehen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Die Gesichter aller Passant*innen werden mit Hilfe von KI analysiert und mit Fotos gesuchter Personen abgeglichen. Das zugrundeliegende Gesetz erlaubt noch viel mehr. Von Martin Schwarzbeck –
Artikel lesen
Referentenentwurf: Diese Behörden sollen die KI-Verordnung umsetzen
Die Bundesnetzagentur soll künftig einen Großteil der KI-Aufsicht übernehmen. Ringsum ist jedoch ein Mosaik aus weiteren Zuständigkeiten geplant. Das geht aus dem Gesetzentwurf aus dem Digitalministerium hervor, den wir veröffentlichen. Von Daniel Leisegang –
Artikel lesen
„Grenzpartnerschaft“ mit den USA: EU-Kommission will Biometriedaten aus Mitgliedstaaten freigeben
Die EU-Kommission will ein Abkommen verhandeln, das US-Behörden direkten Zugriff auf polizeilich gespeicherte Fingerabdrücke und Gesichtsbilder in Europa erlaubt. Von einer Abfrage wären potenziell alle Reisenden betroffen. Von Matthias Monroy –
Artikel lesen
Interview: „Es liegt an uns, ob wir KI Macht über uns geben“
Die KI-Branche will, dass wir ihre Tools für alles nutzen. Dafür vermarktet sie ihre Produkte als Alleskönner, der Mensch wird zum optimierungsbedürften Wesen. Im Gespräch mit netzpolitik.org erklärt die Philosoph*in Maren Behrensen, wie wir einen kritischen und kreativen Umgang mit KI finden können. Von Esther Menhard –
Artikel lesen
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Datenschutz & Sicherheit
Selbstbestimmungsgesetz: Vom Versprechen zur Gefahr
Die Pläne des Bundesinnenministerium verletzen den Kern dessen, wofür das Selbstbestimmungsgesetz steht: Schutz, Würde und ein Leben ohne ständige Angst vor Outings. Sie verwandeln den Fortschritt in eine existenzielle Bedrohung. Ein Kommentar.

Alles in Ordnung, es gibt nichts zu sehen, nur ein normaler Verwaltungsakt. So klingt es, wenn das Bundesinnenministerium über seine Pläne spricht, die früheren Vornamen und Geschlechtseinträge von Personen dauerhaft im Melderegister zu speichern. Doch damit verschleiert das Haus von Alexander Dobrindt, welche Zerstörungskraft in diesem Vorhaben steckt. Würde diese Verordnung am Freitag vom Bundesrat beschlossen, wäre das nicht die Umsetzung des Selbstbestimmungsgesetzes – es wäre seine Demontage.
Als das Gesetz im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, hatte es ein klares Ziel: Das Leben für Menschen, die trans, intergeschlechtlich oder nichtbinär sind, sich also weder ausschließlich als weiblich oder männlich verstehen, sollte einfacher und sicherer werden. Diskriminierung, Blicke, Anfeindungen sollten ihnen, wo möglich, erspart bleiben. Unfreiwillige Outings sollten der Vergangenheit angehören. Mit der Bankkarte an der Supermarktkasse. Mit dem Personalausweis am Flughafen. Das alte Ich, das für viele nie passte, sollte zur Vergangenheit werden. Das neue Ich, das richtige, sollte gelten.
Die Pläne aus dem Innenministerium höhlen dieses Ziel aus und verkehren es ins Gegenteil. Die alten Daten würden dauerhaft in den Meldedaten gespeichert bleiben und mit jedem Umzug weitergereicht. Unzählige Behörden könnten sie mit wenigen Klicks abrufen.
Betroffenen hängt das Ministerium so ein Schild um den Hals, sichtbar für jede Behörde. Und dieses Schild signalisiert: Diese Person entspricht nicht der Geschlechternorm.
Mutlosigkeit mit Ansage
Schon während der Beratungen zum Selbstbestimmungsgesetz zeigte sich die Ampelregierung mutlos. Der damalige Justizminister Marco Buschmann ist eingeknickt, ließ sich von einer radikalen Splittergruppe treiben, die in trans Menschen eine Bedrohung sieht. Dabei ist es genau umgekehrt. Trans Menschen werden bedroht. Sie sind einem ungleich höheren Risiko von Beleidigung, Angriffen und Gewalt ausgesetzt – besonders, wenn sie nicht weiß sind.
Die Transfeindlichkeit hat dennoch Einzug ins Gesetz gehalten, mit allerlei Klauseln, die dieses gesellschaftliche Misstrauen und den politischen Gegenwind abbilden, geht es nun um den Besuch im Fitnessstudio oder den Wehrdienst.
Das ist ärgerlich. Und trotzdem war es ein Meilenstein, dass dieses Gesetz endlich kam und für so viele ein selbstbestimmteres Leben mit der eigenen Identität ermöglichte.
Zwangsouting bei jedem Behördenkontakt
Wenn das Bundesinnenministerium diese neue Freiheit jetzt mit einer Meldeverordnung wieder zunichtemacht, wären all die Hoffnungen verfrüht gewesen. Statt einer Befreiung würde das Selbstbestimmungsgesetz für Betroffene vor allem neue Probleme schaffen, Unsicherheit säen und sie neuen Gefahren aussetzen.
Zum einen bliebe die Frage, ob die Person, mit der man es in Behördendeutschland gerade zu tun hat, den “Deadname”, den alten Geschlechtseintrag, kennt. Beim Bafög-Antrag, auf dem Arbeitsamt oder einfach, weil man ein geklautes Fahrrad anzeigen will. In all diesen Szenarien käme es immer wieder zu Zwangsoutings und damit auch zur Möglichkeit, immer wieder falsch angesprochen oder angefeindet zu werden. Auch 20, 30, 40 Jahre später noch.
Zum anderen ist da die berechtigte Angst, dass die neu geschaffene technische Infrastruktur – automatisierter Abruf von früheren Geschlechtseinträgen für unzählige Behörden – nur allzu gerne von jenen genutzt werden wird, die trans Menschen in Zukunft oder heute schon als Feinde sehen.
Trump macht es gerade vor
Wer kann verhindern, dass unter so vielen Behördenmitarbeitenden nicht die eine oder andere sitzt, die Listen erstellen wollte von all den Personen, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch genommen haben. Oder dass eine künftige Regierung die Möglichkeiten, die hier geschaffen werden, nutzt, um Personen zu verfolgen. Welche beängstigenden Formen das annehmen kann, sieht man derzeit in den USA, wo Donald Trumps Regierung kaum eine Möglichkeit auslässt, um trans Menschen zu schikanieren.
Dass das Bundesinnenministerium meint, dieser Sorge mit einem einzelnen Satz Rechnung tragen zu können, der nun formaljuristisch verbietet, was technisch mit wenigen Mausklicks möglich sein wird, zeugt nur von weiterer Gleichgültigkeit.
Die geplante Verordnung verletzt den Kern dessen, wofür das Selbstbestimmungsgesetz steht: Schutz, Würde und ein Leben ohne ständige Angst vor Outings. Es zeugt von einer beispiellosen Ignoranz für die Lebensrealität von trans Menschen. Wer das Innenministerium auf diese Weise agieren lässt, verwandelt den Fortschritt in eine existenzielle Bedrohung.
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Datenschutz & Sicherheit
Datenschutz gilt auch für biometrische Überwachung aus dem Ausland
Die auf biometrische Massenüberwachung spezialisierte US-Firma Clearview AI hat vor einem britischen Gericht eine empfindliche Niederlage erlitten. Demnach gelten britische Datenschutzgesetze auch für Unternehmen, die nicht in Großbritannien ansässig sind und die ihre Dienste vorrangig ausländischen Behörden oder Unternehmen anbieten. Entsprechend ist die britische Aufsichtsbehörde ICO (Information Commissioner’s Office) zuständig und kann gegebenenfalls Strafen verhängen, urteilte das Berufungsgericht Upper Tribunal in der vergangenen Woche.
Das erst vor wenigen Jahren gegründete IT-Unternehmen hat laut eigener Aussage inzwischen mehr als 60 Milliarden Bilder von Gesichtern in eine durchsuchbare Datenbank gepackt. Dabei greift Clearview AI Quellen aus dem offenen Internet ab, darunter soziale Medien. Hinzu kommt sonstiges öffentlich zugängliches Bildmaterial, etwa Fahndungsfotos. Den Zugang zu der Gesichtserkennungsdatenbank bietet die Firma vor allem US-amerikanischen Behörden an, etwa lokalen Polizeien oder der Abschiebebehörde ICE. Für viele dieser Behörden gehört der Abgleich mit solchen Datenbanken inzwischen zum Alltag.
In Europa ist die Gesichtersuchmaschine hingegen unter starken Druck geraten. Unter anderem Italien und Frankreich haben Clearview AI wegen Datenschutzverletzungen zu millionenschweren Geldbußen verdonnert. Auch in Großbritannien hat ICO dem Anbieter im Jahr 2022 eine Buße von umgerechnet rund 8 Millionen Euro aufgebrummt und zudem angeordnet, Daten britischer Bürger:innen aus der Datenbank zu löschen. Der Anbieter habe ihre Daten ohne deren Wissen und Zustimmung massenhaft abgezogen, ausgewertet und kommerziell ausgeschlachtet, führte ICO damals aus.
Streit um Geltungsbereich von Datenschutzgesetzen
Gegen den Bescheid hatte sich Clearview AI juristisch gewehrt und konnte sich zumindest anfangs durchsetzen. So hatte die erste Instanz, das sogenannte First-tier Tribunal (FTT), der ICO-Behörde grundsätzlich das Recht abgesprochen, solche Urteile zu fällen. Zwar seien britische Bürger:innen womöglich der Überwachung ihres Lebens und ihres Verhaltens ausgesetzt. Jedoch falle die Datenverarbeitung des US-Unternehmens nicht in den Geltungsbereich des an die DSGVO der EU angelehnten britischen Datenschutzgesetzes, so das FTT.
Dieser Argumentation ist das Berufungsgericht nicht gefolgt und gab der Aufsichtsbehörde ICO in den relevanten Punkten recht. Dem Urteil zufolge steht die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Clearview AI im Zusammenhang mit der Überwachung des Verhaltens von Einwohner:innen des Vereinigten Königreichs. Somit fällt dies in den Anwendungsbereich des britischen Datenschutzrechts, selbst wenn das Unternehmen seine Dienste für ausländische Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden erbringt.
Wir sind ein spendenfinanziertes Medium
Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.
Das Urteil hat Präzedenzwirkung, allerdings kann Clearview AI noch in Berufung gehen. Derweil überwies das Upper Tribunal den Fall wieder zurück an das untergeordnete Gericht. Dieses muss den Fall erneut aufrollen und dabei berücksichtigen, dass die ICO-Aufsicht Geldbußen verhängen und sonstige Auflagen wie Löschanordnungen erteilen kann.
Unklare Lage in der EU
Der Klage gegen Clearview AI hatte sich die britische Menschenrechtsorganisation Privacy International angeschlossen. Der Programmdirektor Tom West begrüßt das Urteil: Nur weil ein Unternehmen mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden oder nationalen Sicherheitsbehörden zusammenarbeite, könne es sich nicht dem Datenschutzrecht entziehen. „Es wäre ein massives Problem, wenn diese Behörden aufdringliche Datenverarbeitungen an private Akteure auslagern könnten, die nicht unter das Gesetz fallen“, so West.
Auseinandersetzungen rund um den Einsatz biometrischer Massenüberwachung könnten durchaus auch in der EU bevorstehen. Die im Vorjahr in Kraft getretene KI-Verordnung enthält zwar eine Reihe an Schutzvorkehrungen, räumt aber Ermittlungsbehörden Ausnahmen bei der biometrischen Identifikation ein. Sogar die als besonders gefährlich geltende Echtzeit-Überwachung ist nicht komplett verboten. Wie groß der Spielraum für EU-Behörden tatsächlich ist, bleibt allerdings noch unklar.
Genau das loten derzeit eine Reihe an EU-Ländern aus, darunter auch Deutschland. So will das Bundesinnenministerium die Hürden für den Einsatz von Gesichter-Suchmaschinen im Asylverfahren weiter senken. Zugleich sollen Bundeskriminalamt und Bundespolizei künftig kommerzielle Gesichtersuchmaschinen wie Clearview oder PimEyes im Polizeialltag nutzen können, geht es nach Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Auf der Wunschliste stehen zudem weitere Datenanalysetools, etwa Palantir aus dem Hause des Trump-Verbündeten Peter Thiel.
Gegen die Pläne regt sich zunehmend Widerstand aus der Zivilgesellschaft. Erst heute haben die Nichtregierungsorganisationen AlgorithmWatch, Amnesty International, der Chaos Computer Club und die Gesellschaft für Freiheitsrechte gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, ihre Zweifel an deren Rechtmäßigkeit deutlich gemacht. In der vorliegenden Form wären die Gesetzentwürfe nicht mit EU-Recht vereinbar, so die Expert:innen.
Datenschutz & Sicherheit
Wie eine neue Verordnung zur Bedrohung für Betroffene wird
Es ist das Jahr 2045 und Dennis meldet sich nach einem Umzug in der neuen Stadt an. Laut Personalausweis ist Dennis ein Mann. Die Person auf dem Amt sieht allerdings mit einem Blick in seine Meldedaten, dass Dennis früher anders hieß und auch einen anderen Geschlechtseintrag hatte. Sie sieht, dass er zwanzig Jahre zuvor seine Daten nach dem Selbstbestimmungsgesetz hat ändern lassen. Sie sieht: Dennis ist trans.
So würde es in Zukunft ablaufen, wenn eine Verordnung aus dem Bundesinnenministerium an diesem Freitag verabschiedet wird. Sie soll die praktische Umsetzung des Selbstbestimmungsgesetzes im Meldewesen regeln. Also: Wie und wo wird in amtlichen Registern festgehalten, dass eine Person ihren Vornamen und Geschlechtseintrag geändert hat?
Bislang gilt: Ein neuer Datensatz wird angelegt, der alte mit einem Sperrvermerk versehen. Laut den Plänen aus dem Haus von Alexander Dobrindt (CSU) soll sich das ändern. Der alte Vorname, das frühere Geschlecht, das Datum der Änderung – all das soll jetzt in eigenen Datenfeldern im aktuellen Datensatz gespeichert werden.
Noch dazu für immer, denn die Daten sollen außerdem bei jedem Umzug automatisch mit auf die Reise gehen. Sie könnten von unzähligen weiteren Behörden jederzeit automatisiert abgerufen werden. Die Folgen für die Betroffenen wären weitreichend.
Ministerium nennt es notwendig, Verbände nennen es absurd
Das Bundesinnenministerium argumentiert, die Änderungen seien notwendig, um Menschen eindeutig identifizieren zu können. Außerdem würden die Informationen gebraucht, um das sogenannte Offenbarungsverbot einhalten zu können. Es soll Menschen vor unfreiwilligen Outings schützen, etwa am Arbeitsplatz oder im Sportverein.
Unter den Menschen, für deren Wohlergehen und Rechte das Selbstbestimmungsgesetz gedacht war, sorgen die Pläne hingegen für große Unruhe. Alle Verbände, die sich zum Entwurf geäußert haben, sind sich einig in ihrer Kritik. Das eigentliche Ziel des Gesetzes – ein Leben mit weniger Diskriminierung in der neuen Identität – wäre damit torpediert. Das sagt der Bundesverband Trans*, davor warnt auch die Deutsche Gesellschaft für Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit.
Die Argumente des Ministeriums nennen sie fadenscheinig. Seit den 1980er-Jahren kann man in Deutschland den eigenen Geschlechtseintrag ändern. Nie sei es dabei zu Schwierigkeiten bei der Identifikation gekommen.
Was als Befreiung gedacht war, könnte zur Datenspur fürs Leben werden
„Aus unserer Sicht wäre die Einführung dieser Verordnung ein Bruch des Offenbarungsverbots“, sagt Gabriel_Nox Koenig vom Bundesverband Trans*. Dass die Daten laut der Begründung aus dem Innenministerium mitgeführt werden sollen, um das Offenbarungsverbot achten zu können, findet er unlogisch. „Personen können mich ja dann allein deswegen misgendern und mit meinem alten Namen ansprechen, weil diese dauerhaft in meinem Meldedaten sichtbar sind.“ Egal wie oft man dann innerhalb Deutschlands umziehe, diese Daten würden einen auf ewig verfolgen.
Auch der LSVD Verband Queere Vielfalt nennt die Begründung paradox. „Dadurch entsteht faktisch ein Mechanismus, der das ‚alte Geschlecht‘ dauerhaft mitführt, obwohl das SBGG gerade darauf abzielt, dass Menschen nach einer Änderung nicht mehr an ihren früheren Geschlechtseintrag gebunden sind.“
„Altes Ich zementiert“: Familienausschuss übt scharfe Kritik
Trotz der Kritik aus den Verbänden hat das Ministerium die Verordnung nahezu unverändert zur Abstimmung in den Bundesrat geschickt. Die Länderkammer muss zustimmen, weil die Umsetzung im Meldewesen Sache der Länder ist. Eine Abstimmung steht für diesen Freitag auf der Tagesordnung, Ausgang: ungewiss.
Zumindest der Familienausschuss hat jedoch bereits empfohlen, der Verordnung nicht zuzustimmen. Die Begründung deckt sich mit der vernichtenden Kritik aus den Verbänden. Um Menschen zu identifizieren und das Offenbarungsverbot einzuhalten, sei die Verordnung nicht erforderlich. „Vielmehr missachtet sie den besonderen Schutzbedarf der betroffenen Personengruppe und setzt sie einem erhöhten Diskriminierungsrisiko aus.“
Die Regelung zementiere faktisch ein „altes Ich“, das dauerhaft mitgeführt werden müsse. Personen blieben in zentralen amtlichen Registern „technisch und datenseitig mit ihrer früheren geschlechtlichen Identität verbunden“ – ohne dass dies ein konkreter Verwaltungszweck rechtfertige. Die Anerkennung der neuen Geschlechtsidentität werde dadurch dauerhaft erschwert, das Ziel des Selbstbestimmungsgesetzes konterkariert.
Kritisch sieht der Ausschuss auch, wie viele öffentlichen Stellen in Zukunft automatisiert Zugang zu den sensiblen Informationen haben werden. „In der Praxis bedeutet dies, dass Betroffene keinen Überblick mehr darüber haben, welche Stellen von der Änderung ihres Geschlechtseintrags Kenntnis erlangen.“
Dobrindt plant Zwangsouting per Verordnung
Wie leicht sensible Daten künftig zugänglich werden
Was dieser automatisierte Abruf in der Praxis bedeutet, dazu kann Rhandos Auskunft geben. Die Verwaltungsjuristin ist aktiv im Chaos Computer Club Hamburg und hat Einblick in das Handeln von Behörden. Wer bislang aus einer Behörde Zugriff auf Informationen wie den früheren Namen oder Geschlechtseintrag haben wollte, sagt sie, musste dafür beantragen, den Sperrvermerk zu umgehen. Solche Anfragen wurden von der Meldebehörde für jeden Einzelfall geprüft.
In Zukunft würde es hingegen ausreichen, das entsprechende Datenfeld „Geschlechtseintrag vor Änderung“ oder „Vornamen vor Änderung“ anzuklicken. Schon könne man sich diese Information anzeigen lassen – oder etwa eine Liste aller Personen in den Kommunen des eigenen Bundeslandes erstellen, bei denen dieses Feld befüllt ist.
„Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie leicht dieser Zugriff theoretisch ist“, sagt Rhandos. Behörden dürften auf alle Daten aus dem Melderegister zugreifen, wenn es „erforderlich ist für die Erfüllung ihrer Aufgaben“. Das ließe sich weit auslegen. In der Suchmaske könnten alle im Datensatz für das Meldewesen vorhandenen Datenfelder einfach ausgewählt werden. Als Begründung müsse man nur einen beliebigen Text in ein Freitextfeld eingeben.
Zwar besteht eine Protokollierungspflicht, eine regelmäßige Kontrolle dieser Protokolle schreibt das Gesetz aber nicht vor. „Das ist ein Scheunentor“, sagt Rhandos, „Das ist die Büchse der Pandora, die hier geöffnet wird.“
Innenministerium ergänzt nur einen Satz
All diese Bedenken hatten Fachleute schon geäußert, nachdem der Entwurf Mitte Juli bekannt wurde. Im Bundesinnenministerium fanden sie damit kaum Gehör. Einen einzigen Satz hat man dort hinzugefügt, bevor der Entwurf an den Bundesrat ging. Im Teil, der den automatisierten Abruf der Daten zwischen Behörden regelt, steht nun: „Eine Suche zur Erstellung einer Ergebnisliste, die ausschließlich Personen anzeigt, die ihren Geschlechtseintrag geändert haben, ist ausgeschlossen.“
Diese „Klarstellung“ solle den Bedenken aus den Verbänden Rechnung tragen, heißt es auf Nachfrage, „insbesondere um die gezielte Suche in den Melderegistern durch Behörden oder öffentliche Stellen nach allen Personen, die ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen nach den Vorschriften des SBGG, geändert haben, auszuschließen.“
Wir sind ein spendenfinanziertes Medium
Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.
Auf die Frage, wie das Verbot technisch umgesetzt werden soll, antwortet das Innenministerium nur ausweichend: Es bestehe bereits heute Erfahrung im Meldewesen im Umgang mit besonders schutzbedürftigen Daten.
Der Staat sollte Betroffene schützen, nicht ihre sensiblen Daten breiter teilen
Verbände hatten gewarnt, dass mit der neuen Verordnung faktisch jene Personen im Register markiert werden, für die das Selbstbestimmungsgesetz eigentlich Diskriminierung abbauen soll.
Trans-, intergeschlechtliche und nicht binäre Menschen würden dadurch einem höheren Risiko von Diskriminierung ausgesetzt, zu einer Zeit, in der queer- und transfeindliche Straftaten zunehmen. „In dieser Lage ist der Staat verpflichtet, die Betroffenen zu schützen – nicht, ihre sensibelsten Daten breiter zu verteilen“, schreibt etwa der Bundesverband Trans*.
Auch Rhandos sieht als betroffene Person zwei Bedrohungsszenarien: Mitarbeitende bei Behörden könnten die Daten einzelner für rechtsextreme und transfeindliche Organisationen abfragen. Technisch wäre mit der Verordnung zudem vorbereitet, dass eine künftige autoritäre Regierung Menschen anhand der Daten aus dem Melderegister verfolgen könnte.
Betroffen wären alle, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch nehmen
Welche Behörden jeweils automatisierten Zugriff auf die Daten bekommen, das legen die einzelnen Bundesländer fest. Auch deswegen herrscht weiter große Verwirrung in der Frage, wer nun was zu sehen bekäme. Was sieht die Person beim Jobcenter, was der Sachbearbeiter auf dem Bürgeramt, was die Polizistin, bei der man eine Zeugenaussage macht?
Das BMI zeigt sich auf diese Fragen wortkarg: Ein Abruf der Daten sei nur dann zulässig, soweit sie der jeweiligen Stelle „zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt sein müssen“.
Verwirrung herrschte auch zur Frage, wer genau von den neuen Regeln betroffen wäre: Greifen sie erst mit dem Inkrafttreten der Verordnung ab November 2026 oder auch rückwirkend für all jene, die bereits vorher ihre Daten ändern lassen? Hier macht das Ministerium eine klare Aussage: Die neue Verordnung zeichne lediglich die Entscheidungen technisch nach, die mit der Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes schon getroffen wurden. Die Regelung würde somit alle Menschen betreffen, die das Selbstbestimmungsgesetz seit seinem Inkrafttreten im November 2024 in Anspruch genommen haben – egal zu welchem Zeitpunkt.
Wer hingegen nach dem alten „Transsexuellengesetz“ seit 1981 seinen Vornamen und Geschlechtseintrag hat ändern lassen, für den gelten weiterhin die Auskunftssperren.
Chaos Computer Club Hamburg warnt vor “Kartei”
Mit offenen und persönlichen Briefen an die Minister*innen im Rat versuchen Aktivist*innen und Organisationen die Änderungen noch abzuwenden. So fordert etwa der Chaos Computer Club Hamburg die dortige Landesregierung dazu auf, den Entwurf abzulehnen.
Eine Kartei von Personen, die das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch genommen hätten, stelle trans* Personen unter Generalverdacht, heißt es dort. Dass Informationen zu vorherigen Namen und Geschlechtseinträgen praktisch sämtlichen Mitarbeitenden aller Behörden mit Zugriff auf das Melderegister zugänglich würden, verstoße gegen jedes Verständnis von Datenschutz.
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 1 Monat
Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen
-

 Online Marketing & SEOvor 3 Monaten
Online Marketing & SEOvor 3 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows














