Datenschutz & Sicherheit
Entwickler*innen erzählen, warum Games über Sex wichtig sind
Unter Gamer*innen und Entwickler*innen gab es Ende Juli einen internationalen Aufschrei, als tausende Videospiele für Erwachsene von den Marktplätzen Steam und Itch.io verschwunden sind. Betroffen waren sogenannte NSFW-Spiele („not safe for work“), die teils erotisch oder pornografisch sind, teils andere Themen für Erwachsene behandeln.
Als Grund für die Entfernung solcher Erwachsenen-Spiele („Adult Games“) nannten Steam und Itch.io Druck von Zahlungsanbietern, die damit gedroht haben sollen, den Plattformen andernfalls ihre Dienstleistungen zu entziehen. Auf diese Weise können Unternehmen wie Visa, Mastercard und PayPal indirekt beeinflussen, welche Inhalte öffentlich verfügbar sind und welche nicht. Druck auf die Zahlungsanbieter kam wiederum von der australischen Anti-Porno-Gruppe „Collective Shout“. Deren Aktivist*innen setzen sich unter anderem gegen Inhalte ein, die sie als schädliche Sexualisierung einstufen.
In einem Statement auf der eigenen Website schrieb Itch.io: „Es tut uns wirklich leid“. Die Plattform habe alle NSWF-Spiele aus den Suchergebnissen entfernt, also de-indexiert. Um weiter Zahlungen durchführen zu können, habe man schnell handeln müssen. Die Plattform kündigt an, alle Spiele zu prüfen. Inzwischen sollen zumindest kostenlose Titel wieder über itch.io zu finden sein. Mastercard hatte öffentlich bestritten, Druck auf Steam-Anbieter Valve ausgeübt zu haben. Valve wiederum verwies auf Druck durch Partnerbanken von Mastercard.
Der Streit um die verschwundenen NSWF-Spiele ist nur ein weiteres Beispiel für Overblocking von Inhalten, die um Sexualität, Erotik, sexualisierte Gewalt oder Queerness kreisen. Overblocking nennt man es, wenn eigentlich unbedenkliche Inhalte einer Sperrung zum Opfer fallen. Oftmals kritisieren Betroffene, dass damit wichtige Stimmen verloren gehen. Deshalb hat netzpolitik.org nun Spielentwickler*innen aus verschiedenen Ländern gebeten, ihre Perspektive aufzuschreiben. Sie sprechen über den kulturellen Wert von NSFW-Games und die Gefahr von Selbstzensur.
Arden Osthof: „Vorsorglich Selbstzensur betreiben“
Arden ist Game Developer aus Deutschland.
„Visa und Mastercard verbreiten durch das erzwungene Entfernen der betroffenen Spiele vor allem Unsicherheit. Welche Inhalte sind erlaubt und welche nicht? Die Regeln sind schwammig und widersprüchlich. Es genügt nicht, sich mit Gesetzen und Plattform-Richtlinien von Steam und Itch.io auszukennen, wenn aus heiterem Himmel auch noch Zahlungsdienstleister den Geldhahn abdrehen können.
Wer sein Spiel nicht auf einem der große Marktplätze verkaufen kann, steht kommerziell vor dem Aus. Es braucht klare Regeln, um planen zu können, sonst riskiert man jahrelange Arbeit für nichts. Es bleibt also nur, auf Nummer sicher zu gehen, vorsorglich Selbstzensur zu betreiben und lieber keine riskanten und tabuisierten Themen behandeln. Darunter leiden unsere Kunst, Kultur und Demokratie.
Gerade Itch.io war bislang überlebenswichtig für Spiele, die sich mit Sexualität und Pornografie beschäftigen. Das bahnbrechende Spiel ‚Ladykiller in a Bind‘ von Christine Love erzählt zum Beispiel eine Geschichte voller Intrigen, Drama und lesbischem BDSM. Es war zu seinem Release nicht auf Steam sondern nur Itch.io erhältlich. Auch Werke von Robert Yang, die queere Subkulturen und Geschichte (wie ‚The Tearoom‘, in dem es um historisches Cruising und moderne Überwachung geht) behandeln, werden immer wieder von Plattformen wie Steam und Twitch verboten.
Noch sind diese Werke auf Itch.io verfügbar. Aber offenbar werden nun sexuelle und erotische Inhalte von Zahlungsdienstleistern willkürlich als ‚akzeptabel‘ oder ‚ekelhaft‘ eingeteilt. Was bedeutet das für queeren Sex, für Kink oder Fetische? Es ist gerade bei diesen Themen so wichtig, uns gegen rechte Attacken zu wehren. Denn jede Einschränkung, die auf gefühlter Bedrohung statt auf Wissenschaft und Realität baut, untergräbt am Ende unsere Kunstfreiheit und Demokratie.“
Alice Ruppert: „Eine Frage des Prinzips“
Alice ist Game Designer aus der Schweiz.
„Das Eingreifen der Zahlungsanbieter ins Geschäft von Plattformen wie Steam und Itch.io auf Druck der christlichen Rechten ist ein Affront. Ich entwickele zwar selbst keine Erwachsenen-Spiele, aber ihre Existenz ist für mich eine Frage des Prinzips. Bloß, weil mich durchschnittliche Porno-Spiele als bisexuelle Frau nicht besonders ansprechen, ist das kein Grund für eine Zensur. Es ist vielmehr ein Argument für mehr Sex-Spiele, für mehr Diversität im Markt.
Sex, Intimität, Liebe, aber auch sexualisierte Gewalt und deren Folgen dürfen, sollen, müssen in unseren Medien thematisiert werden. Alleine schon, um Überlebenden den Raum zu geben, durch Kunst ihr Erlebtes zu verarbeiten. Ich wünsche mir, dass diese Darstellungen diskutiert, analysiert und kritisiert werden, aber keinesfalls, dass sie verboten oder zensiert werden.“
KB: „Wie sollen wir noch über Sex reden?“
KB ist Game Developer aus den USA.
„Ich mache feministische Aufklärungsarbeit, und wenn dabei etwas schädlich ist, dann ist es Sex-Negativität. Wenn man Pornografie und Erotik verbannt, dann verbannt man auch den Ausdruck von Sex und Sexualität. Dadurch macht man sexuelle Aufklärungsarbeit noch schwerer. Wie sollen wir noch über Sex reden, wenn wir keine ehrlichen Ausdrucksweisen mehr nutzen können?
Ich entwickle Spiele über sexuelle Gesundheit und Aufklärung sowie über Prävention sexueller Gewalt. Auch Spiele zu solchen Themen wurden entfernt, ebenso wie erotische Spielen. Porno-Spiele zu verbieten, ist schädlich, Punkt. Wo verläuft schon die Grenze zwischen erotischen Medien und Bildungsmedien? Ich glaube, viele konservativ denkende Menschen stufen schon die reine Existenz von queeren Menschen als ‚pornografisch‘ ein.“
Taylor McCue: „Durch mein Spiel konnte ich endlich darüber sprechen“
Taylor ist Indie Game Developer aus den USA.
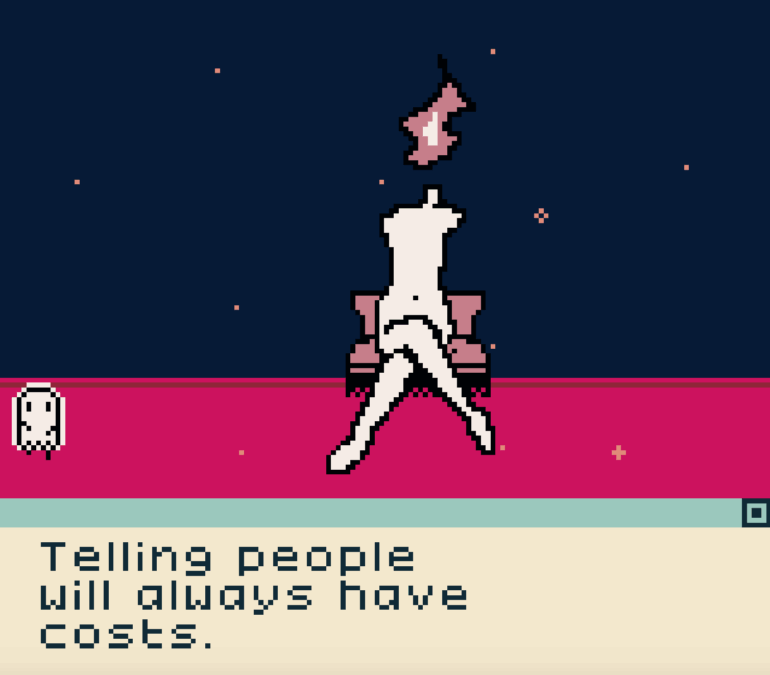
„Bei Erwachsenen-Spielen geht es nicht nur um persönliche Befriedigung. Die Spiele schaffen Räume, um Dinge wie Sex oder sexuelle Gewalt zu thematisieren. Verbietet man Erwachsenen-Spiele, dann verschwinden auch diese Räume. Es gibt wirklich noch nicht viele Game Developer, die überhaupt Spiele über sexuelle Traumata entwickeln. Gerade weil solche Spiele gebannt werden, habe manche es bereits aufgegeben. Das macht mir besonders Sorgen.
In meinem Spiel ‚HFTGOOM‘ habe ich über meine Erfahrungen mit Sexarbeit und sexuellen Traumata gesprochen. Jede*r verarbeitet Traumata anders. Autor*innen schreiben ein Buch über ihre Erfahrungen, Künstler*innen malen ein Bild und Spieleentwickler*innen programmieren eben ein Spiel darüber. Für die anderen sind Traumata ein akzeptierter Teil ihrer Werke, während Game Developer wie ich sich dabei auf sehr dünnem Eis bewegen.
Ich musste alle Zahlungsmöglichkeiten entfernen, damit mein eigenes Spiel wieder auf der Plattform spielbar ist. Dabei ist mein Spiel grundsätzlich kostenlos. Es hatte lediglich eingebaute Bonus-Features für Spieler*innen, die mir etwas spenden.
Bevor ich ‚HFTGOOM‘ entwickelt habe, hatte ich mich geschämt. Ich hatte Angst, über meine Erfahrungen mit Sexarbeit und Traumata zu sprechen. Erst durch mein Spiel konnte ich endlich darüber sprechen, und das hat mein Leben gerettet. Andere Leute haben mir in E-Mails von ähnlichen Erfahrungen erzählt. Das Spiel hat ihnen geholfen, sich weniger einsam zu fühlen. Wenn solche Spiele aus dem Internet verschwinden, dann werden sich Menschen wie ich einsam und isoliert fühlen.“
Lucy Blundell: „Es limitiert nur unser gesellschaftliches Verständnis dieser Themen“
Lucy ist Game Developer aus England.
„Ich habe Glück, dass meine Spiele bisher – noch – nicht entfernt wurden. Queere Spiele, die meine Arbeit inspiriert haben, sind jedoch entfernt worden. Oft stehen Spiele, die sich mit Geschlecht, Sex und Sexualität beschäftigen, stehen im Fadenkreuz der Zensur. Diese Spiele werden häufig von Frauen und marginalisierten Menschen entwickelt und behandeln Themen, über die ohnehin selten öffentlich gesprochen wird.
Als weibliche, behinderte Spieleentwicklerin verdiene ich meinen Lebensunterhalt mit der Entwicklung von Spielen. Seit fast zwei Jahren arbeite ich an meinem nächsten Projekt, und nun fürchte ich, dass diese Arbeit umsonst gewesen sein könnte – obwohl es sich lediglich um queere Inhalte handelt und nicht um NSFW-Material.
Da die meisten Videospiele von Männern geleitet und gestaltet werden, ist es selten, dass eine weibliche Hauptfigur Spieler*innen schockiert, provoziert oder herausfordert. Genau das passiert in meinem Spiel ‚One Night Stand‘. Ich habe es entwickelt, um meine Sorgen darüber auszudrücken, wie sich Menschen nach einem One-Night-Stand manchmal abgelehnt fühlen. Das Spiel erinnert daran, dass die andere Person trotz der zwanglosen Natur eines One-Night-Stands Gedanken und Gefühle hat.
Videospiele sind für mich ein wichtiges Werkzeug, um Empathie zu fördern, weil sie es den Spieler:innen ermöglichen, in die Rolle anderer zu schlüpfen. Deshalb ist es entscheidend, dass Frauen und andere marginalisierte Menschen nicht zensiert werden. Die Zensur von Spielen über Intimität, Nacktheit oder Sex schmälert nicht nur das Einkommen marginalisierter Menschen, sie beschränkt auch unser gesellschaftliches Verständnis dieser Themen.“
Datenschutz & Sicherheit
Drohnenverteidigung soll Menschen an Grenzen abwehren
Geht es nach den Plänen der EU-Kommission, sollen Drohnenabwehrsysteme künftig die Außengrenzen der Europäischen Union schützen. Die geplante Aufrüstung richtet sich jedoch nicht nur gegen potenziell militärische Bedrohungen etwa aus Russland, sondern auch gegen Menschen auf der Flucht. Recherchen von netzpolitik.org zeigen, dass sich zuständige Behörden mit konkreten Plänen bedeckt halten – während Menschenrechtler*innen eindringlich warnen.
Die Pläne zur europäischen Drohnenabwehr sehen aktuell ein EU-weites System zur Erkennung, Verfolgung und Neutralisierung von fremden Drohnen vor. Allerdings soll es auch für zivile Zwecke eingesetzt werden. Demnach soll es „helfen, nicht verteidigungsbezogene Bedrohungen oder andere Gefahren zu bewältigen, die an jeder EU-Grenze auftreten können“, heißt es im Vorschlag der EU-Kommission. Dazu gehören neben dem Schutz kritischer Infrastrukturen auch transnational organisierte Kriminalität und die „Instrumentalisierung von Migration“.
Umfassendes Aufrüstungsprogramm
Das europäische Anti-Drohnensystem ist eines von vier zentralen Projekten eines umfassenden Aufrüstungsprogramms „Defense Readiness Roadmap 2030“, mit dem sich die EU-Kommission etwa auf einen potenziellen Angriff Russlands vorbereiten will. Die militärische Großmacht überzieht die Ukraine seit nunmehr knapp vier Jahren unter anderem mit massiven Luftangriffen. Den 16-seitigen Entwurf stellte die Kommission am 16. Oktober vor.
Neben der „Europäischen Drohnenabwehr-Initiative“ sieht dieser Fahrplan für die Verteidigung des Staatenbundes auch die „Eastern Flank Watch“ vor, die die Verteidigung östlicher Mitgliedstaaten verbessern soll, sowie einen Raketenabwehrschirm und ein Weltraumschutzschild. Die Drohnenabwehr hat demnach besondere Dringlichkeit und soll bis Ende 2027 voll funktionsfähig sein.
Technisch soll das System aus einer Mischung aus Maschinengewehren und Kanonen, Raketen, Flugkörpern und Abfangdrohnen bestehen, die feindliche Drohnen rammen oder in deren Nähe explodieren können. Auch die Ausstattung mit elektronischen Störsystemen und Laserwaffen ist geplant.
Wie alles begann
Angesichts des gehäuften Eindringens mutmaßlich russischer Drohnen in den EU-Luftraum seit September dieses Jahres sind Rufe nach einer verstärkten Drohnenabwehr laut geworden.
Die NATO setzt bislang vor allem millionenteure Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Patriot-Raketen ein, um feindliche Drohnen abzuschießen, die nur wenige Tausend Euro kosten. Das Militärbündnis hat auch Kampfflugzeuge nach Estland entsandt, nachdem jüngst drei russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen waren.
Weitere Vorfälle von nicht identifizierten Drohnen über Flughäfen in Dänemark und Deutschland in den zurückliegenden Wochen bestärkten die europäischen Staats- und Regierungschefs offenkundig darin, dass die EU dringend einen besseren Schutz vor Flugsystemen ohne Pilot*innen benötigt.
Zu Beginn hatten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Vertreter*innen östlicher EU-Staaten noch für einen sogenannte Drohnenwall an der östlichen EU-Flanke geworben. Diese Idee hatte von der Leyen am 1. Oktober bei einem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen vorgestellt.
Wir sind ein spendenfinanziertes Medium
Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.
Vom „Drohnenwall“ zur „European Drone Defence Initiative“
Allerdings reagierten die Vertreter*innen etlicher EU-Staaten sowohl auf das Konzept als auch auf den Namen skeptisch. In den darauffolgenden Tagen zweifelte unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron an, dass sich entlang der rund 3.000 Kilometer langen EU-Außengrenze mit Russland ein solcher Drohnenwall errichten lasse. Die Regierungschef*innen Italiens und Griechenlands, die Postfaschistin Giorgia Meloni und der Konservative Kyriakos Mytsotakis, kritisierten, dass von dem Militärprojekt vor allem östliche Mitgliedsländer profitieren würden. Andere Regierungsvertreter*innen mahnten, dass Brüssel sich damit zu sehr in Fragen der nationalen Verteidigung einmische.
Die Kommission weitete das Projekt daraufhin auf die gesamte EU aus und versah ihn zugleich mit einem neuen Namen: European Drone Defence Initiative. Außerdem überzeugte sie offenbar zögerliche EU-Mitgliedsstaaten mit dem Argument, dass das neue Drohnenabwehr-System künftig auch beim Grenzschutz und gegen undokumentierte Migration eingesetzt werden soll.
Waffen gegen „Migration als Waffe“?
Damit traf sie offenkundig einen Nerv. Anfang Oktober hatte das Europäische Parlament in seinem Beschluss zu den wiederholten Verletzungen des Luftraums der EU-Mitgliedstaaten betont, dass auch die Südflanke der EU vor „direkten Sicherheitsherausforderungen“ stehe.
Knapp zwei Wochen später plädierte Meloni dafür, dass die EU auch gegen jene Bedrohungen aufrüsten müsse, „die aus den Konflikten und der Instabilität im Nahen Osten, in Libyen, im Sahel und am Horn von Afrika entstehen.“ In Anspielung auf Putin sagte sie: „Wir wissen, dass unsere Rivalen in diesen Regionen ebenfalls sehr aktiv sind. Gleichzeitig sind wir uns der Risiken bewusst, die aus dem Terrorismus und der Instrumentalisierung von Migration erwachsen können.“
Mit dem wachsenden Einfluss Russlands in Libyen warnten Politiker*innen wie Meloni, aber auch der EU-Migrationskommissar Magnus Brunner, dass Russland die Migration aus dem nordafrikanischen Land als „Waffe“ gegen die EU instrumentalisieren könnte. Seit Jahren werfen sowohl die Kommission als auch verschiedene europäische Regierungschefs Russland und Belarus vor, einen „hybriden Krieg“ gegen die EU zu führen, indem sie fliehende Menschen aus dem Mittleren Osten und Afrika an die polnische EU-Grenze schleusen und sie zu einem undokumentierten Übertritt nötigen. NGOs gehen davon aus, dass Dutzende Menschen wegen dieser Politik ihr Leben verloren haben.
Rüstungsunternehmen als „die wahren Profiteure des Vertreibungskreislaufs“
Dass Menschen, die sich auf den Weg zu den EU-Grenzen machen, als Bedrohung gesehen werden, die es zu neutralisieren gilt, stelle eine ernste Gefahr für Migrant*innen in ohnehin prekären Situationen dar, warnt Chris Jones, Leiter der britischen Bürgerrechtsorganisation Statewatch gegenüber netzpolitik.org. „Der Einsatz von Drohnenabwehr-Systemen zur Überwachung und Kontrolle von Migration würde im Kontext der aktuellen Migrationspolitik Menschen unweigerlich in extreme Gefahr bringen“, so Jones weiter.
Chloé Berthélémy von der Bürgerrechtsorganisation European Digital Rights (EDRi) kritisiert, dass die Verschmelzung von militärischen und zivilen Anwendungen „vor allem dem militärisch-industriellen Komplex“ zugutekomme. „Diese florierende Industrie ist für viele Waffenexporte aus Europa in andere Regionen der Welt verantwortlich, die wiederum die Ursachen für Vertreibung vorantreiben: Menschen sind gezwungen, vor Konflikten, Krieg und Armut zu fliehen“, sagt Berthélémy. Dieselben Unternehmen erzielten nun zusätzliche Gewinne, indem sie Überwachungs- und Verteidigungstechnologien als vermeintliche Lösung für Migration verkaufen.
„Die Rüstungsunternehmen erweisen sich damit als die wahren Profiteure des Vertreibungskreislaufs“, so Berthélémy weiter. „Das Geld, was die EU für den Ausbau von Militär- und Überwachungssystemen ausgibt, könnte stattdessen in die tatsächliche Unterstützung und Aufnahme von Menschen investiert werden, die Schutz suchen.“
Projekt soll Anfang 2026 starten
Am 23. Oktober einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Gipfeltreffen in Brüssel vorerst darauf, für konkrete Projekte zur besseren Verteidigung gegen Drohnen zusammenzuarbeiten. Die in der Abschlusserklärung gefundene Formulierung bleibt dabei deutlich hinter dem ambitionierten Plan der EU-Kommission zurück – weder der Name noch die Fristen zur Fertigstellung haben hier Eingang gefunden.
Laut Gipfelerklärung will die EU ihre Drohnenabwehr-Initiative mit Hilfe zweier Quellen finanzieren: Einerseits will sie auf das 150 Milliarden Euro schwere „Security Action For Europe“-Darlehen (SAFE) zugreifen, andererseits auf das Programm für die europäische Verteidigungsindustrie (EDIP), das insgesamt 1,5 Milliarden Euro bereitstellt. Das SAFE-Darlehen ist ein Kreditprogramm der Europäischen Union, das es Mitgliedstaaten ermöglicht, zu niedrigen Zinsen Kredite aufzunehmen, um etwa Waffen zu kaufen.
Bis zum Ende dieses Jahres sollen sich Mitgliedsstaaten, die die Drohnenabwehr-Initiative anführen wollen, zunächst in einer sogenannten „Fähigkeitskoalition“ einfinden. Lettland und die Niederlande haben sich bereits dazu bereit erklärt. Der Start des Projekts ist auf Anfang 2026 terminiert.
Bundespolizei setzt bereits Drohnen ein
Wir haben uns bei den Regierungen verschiedener EU-Staaten erkundigt, wie sie zu der geplanten zivilen Anwendung der Drohnenabwehr stehen.
Das lettische Verteidigungsministerium schrieb uns daraufhin nur, dass „die nationale Verteidigung und die Stärkung der kollektiven Sicherheit die vorrangigen Ziele bleiben“.
Das polnische Verteidigungsministerium schrieb, dass es bereits über ein breites Spektrum an Technologien verfüge, das zur Überwachung und Verteidigung der eigenen Grenzen zum Einsatz komme. Im Hinblick auf die mögliche zivil-militärische Anwendung der Drohnenabwehr hoffe das Ministerium, dass die „Umsetzung dieses wichtigen Vorzeigeprojekts unsere Bemühungen zur Sicherung der gemeinsamen EU- und NATO-Grenzen unterstützt wird.“
Die Bundespolizei setzt jetzt schon Drohnen für die Grenzfahndung entlang von grenzüberschreitenden Straßen „zur Dokumentation und Aufklärung relevanter Vorfälle“ ein.
Weder das deutsche Verteidigungsministerium noch das Bundesinnenministerium (BMI) wollte sich zu unserer Anfrage äußern, ob die Bundesrepublik plant, die europäische Drohnenabwehr im Kampf gegen undokumentierte Migration einzusetzen.
Auf unsere Frage, mit welcher Position sich die Regierung in die Diskussion des Projekts eingebracht hat, schrieb eine BMI-Sprecherin nur, dass die genaue Ausgestaltung der geplanten Drohnenabwehr derzeit noch Gegenstand laufender Abstimmungen auf nationaler und europäischer Ebene sei. Und ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte gegenüber netzpolitik.org mit, dass das deutsche Verteidigungsministerium in den kommenden Jahren 10 Milliarden Euro in Drohnen und Drohnenabwehr investieren werde.
Datenschutz & Sicherheit
Operation Endgame 3: 1025 Server von Netz genommen
Internationale Strafverfolger aus verschiedenen Ländern haben erneut einen Schlag gegen Malware, Botnets und Server der Infrastruktur cyberkrimineller Vereinigungen ausgeführt. Damit haben sie die VenomRAT, Elysium und 1025 Server aus dem Netz genommen und vorerst lahmgelegt.
Weiterlesen nach der Anzeige
Auf der Webseite zur Aktion gegen Cybercrime „Operation Endgame“ begrüßt die Besucher zunächst ein KI-Video, das sich über die Cyberkriminellen hinter dem Rhadamanthys-Infostealer lustig macht. Auch sonst ist die Webseite recht martialisch aufgemacht. „Staffel 3 der Operation Endgame hat begonnen“, schreiben die Strafverfolger dort recht markig.
Nicht nur Infostealer im Visier
Die Operation lief zwischen dem 10. und 13. November 2025 und wurde aus dem Europol-Hauptquartier in Den Haag koordiniert. Im Visier der Ermittler war nicht nur der Infostealer Rhadamanthys, sondern auch der Remote-Access-Trojaner VenomRAT sowie das Botnetz Elysium. Allen komme eine Schlüsselrolle im internationalen Cybercrime zu, erörtern die Beamten. Die Behörden haben diese drei großen Cybercrime-Beihelfer ausgeschaltet.
Der Hauptverdächtige hinter der Fernzugriffs-Malware VenomRAT wurde bereits am 3. November in Griechenland festgenommen. Die abgeschaltete Infrastruktur zeichnete für hunderttausende Infektionen von Opfern mit Malware weltweit verantwortlich, erklären die Strafverfolger weiter. Hinter der lahmgelegten Infrastruktur verbargen sich hunderttausende infizierte Computer, die ihrerseits mehrere Millionen gestohlener Zugangsdaten enthielten. Viele Opfer wüssten nichts von der Infektion ihrer Rechner. Der Hauptverdächtige hinter dem Rhadamanthys-Infostealer hatte Zugriff auf mehr als 100.000 Krypto-Wallets, die diesen Opfern gehörten und möglicherweise Millionen von Euros wert seien. Auf der Webseite der niederländischen Polizei sowie bei Have-I-Been-Pwned können Interessierte prüfen, ob ihre E-Mail-Adresse Teil der kriminellen Beutezüge ist.
Alon Gal, Geschäftsführer des israelischen Threat-Intelligence-Spezialisten Hudson Rock, kennt sich in der Infostealer-Szene aus. Die Nervosität der Kriminellen halte sich in Grenzen, stellt er im Gespräch mit heise security fest: „Diese Leute haben eine hohe Risikobereitschaft und lassen sich von werbewirksamen Aktionen der Strafverfolger nicht entmutigen“.
Die zweite Operation-Endgame-Aktion fand Ende Mai dieses Jahres statt. Dort haben die internationalen Strafverfolger 20 Haftbefehle erlassen und allein in Deutschland 50 Server aus dem Netz genommen und 650 Domains der Kontrolle der Cyberkriminellen entrissen. Die Ermittler haben bei der Analyse 15 Millionen E-Mail-Adressen und 43 Millionen Passwörter von Opfern gefunden, die das Have-I-Been-Pwned-Projekt in seinen Fundus aufgenommen hat.
Weiterlesen nach der Anzeige
(dmk)
Datenschutz & Sicherheit
EU-Kommission unterstellt Google Diskriminierung von Nachrichtenseiten

Die EU-Kommission hat heute ein neues Verfahren gegen Alphabet, den Mutterkonzern von Google, eröffnet. Grund dafür ist ein möglicher Verstoß gegen den Digital Markets Act (DMA). Demnach vermutet die Kommission, dass die weltgrößte Suchmaschine manche Nachrichten-Websites diskriminiert.
Das EU-Gesetz schreibt besonders großen Online-Diensten vor, dass sie ihre Marktmacht nicht missbrauchen dürfen, um dem Wettbewerb im digitalen Raum zu schaden. Doch in der Google Suche, die von der EU-Kommission als sogenannter Gatekeeper eingestuft wurde, würden möglicherweise keine fairen und diskriminierungsfreien Verhältnisse herrschen. Immer wieder würden Medienseiten in den Ergebnissen ausgeblendet oder heruntergestuft. Doch warum passiert das?
Google hat seit dem Vorjahr eine neue Spam-Richtlinie im Einsatz: die Richtlinie zum Missbrauch des Website-Rufs („Site Reputation Abuse Policy“). Damit soll erkannt werden, wenn bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) getrickst wird. Konkret geht es beispielsweise darum, dass Websites Inhalte von Drittanbietern hosten, die laut Google eigentlich nicht zu ihren Inhalten passen und Nutzende „verwirren“ würden. Drittanbieter würden dabei den Ruf und die Vertrauenswürdigkeit der Site nutzen, um in den Suchergebnissen weiter oben aufzutauchen. Als Beispiel gibt Google eine gekaperte medizinische Website an, die die Werbeseite eines Drittanbieters zu den „besten Casinos“ hostet.
Medien verlieren wichtige Einnahmen
Die EU-Kommission sieht darin ein Problem. In der Praxis könne die Richtlinie dazu führen, dass Inhalte wie Preisvergleiche oder Produktbewertungen auf einer Nachrichtenseite fälschlicherweise als Spam erkannt und die betreffenden Subdomains aus den Suchergebnissen ausgeblendet würden. Dadurch würden Nachrichtenseiten Besuche auf ihre Website („Traffic“) verlieren und dementsprechend auch Einnahmen, sagte ein Kommissionsbeamter am Donnerstag gegenüber der Presse. Außerdem hätten die Nachrichtenseiten kaum Möglichkeiten, sich gegen potenzielle Fehlentscheidungen von Google zu wehren.
Google argumentiert, dass es qualitativ hochwertige Suchergebnisse anzeigen will und deswegen so handelt. Das Problem ist durchaus real, die Frage ist nur, ob Google damit diskriminierungsfrei umgeht.
Konkrete Fälle, die geschätzte Anzahl betroffener Medien und die ungefähre Höhe der Einnahmeverluste will die Kommission aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht preisgeben. Sie erklärt zudem, dass Google News nicht Teil der Untersuchung sei, weil der Dienst kein Gatekeeper sei und nicht vom DMA erfasst werde. Ebenso werde die KI-Zusammenfassung in der Google Suche, die auch zu einem Verlust von Klicks auf Webseiten führt, nicht konkret untersucht. Jedoch behalte man Marktentwicklungen im Auge, so ein Kommissionsbeamter.
Früheres Verfahren läuft noch
Das Verfahren soll in 12 Monaten zum Abschluss kommen. Wie in solchen Untersuchungen üblich, wird die Kommission vorläufige Ergebnisse mit Alphabet teilen, ebenso denkbare Vorschläge, was der Konzern ändern sollte. Zugleich will sich die EU-Kommission mit Herausgebern austauschen. Parallel dazu läuft noch ein anderes Verfahren gegen Alphabet. Dieses bezieht sich auf die Bevorzugung von Google-eigenen Angeboten in den Suchergebnissen.
Sollte die Kommission am Ende ihrer Ermittlungen einen Verstoß feststellen, kann sie eine Strafe von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des Konzerns verhängen.
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets
-

 Social Mediavor 3 Monaten
Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenHarte Zeiten für den demokratischen Rechtsstaat
-

 UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 4 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online
-

 Entwicklung & Codevor 3 Monaten
Entwicklung & Codevor 3 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
















