Apps & Mobile Entwicklung
ChatGPT als Chrome-Konkurrent: OpenAI will bald eigenen Web-Browser veröffentlichen
OpenAI steht kurz davor, einen eigenen Web-Browser zu veröffentlichen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Dieser soll bereits in den kommenden Wochen erscheinen und ist explizit als Konkurrent zu Googles Chrome-Browser geplant.
Reuters beruft sich bei dem Bericht auf drei Quellen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Der komplette Browser soll demnach eine Benutzeroberfläche haben, der Besuch von Webseiten würde damit in den Hintergrund rücken.
Für OpenAI zählt der Browser laut dem Reuters-Bericht zu der Strategie, die KI-Dienste tiefer im Alltag der Nutzer zu verankern. Die AI-Hardware, die man gemeinsam mit dem Design-Büro von Jony Ive entwickeln will, ist ein weiterer Baustein.
Googles Chrome-Browser im Visier
Nutzer sollen KI-Dienste also möglichst ohne Umwege nutzen, was für Anbieter wie OpenAI verschiedene Vorteile hat. Einer davon ist auch, dass man über einen Browser mehr Nutzerdaten sammeln kann. Bei Google ist Chrome ein zentraler Bestandteil für das Werbegeschäft, weil viele Suchen direkt über den Browser laufen.
Mit einem weltweiten Marktanteil von knapp 70 Prozent dominiert Google auch den Browser-Markt. Allerdings sind deswegen bereits die amerikanischen Wettbewerbsbehörden aktiv. Im Rahmen des Monopolverfahrens, das Google verloren hat, steht auch die Forderung im Raum, dass Google den Chrome-Browser abspalten muss. OpenAI hatte sich da bereits als potenzieller Käufer ins Gespräch gebracht.
Der eigene Browser ist Reuters zufolge nun ein Versuch, mit eigenen Mitteln Marktanteile abzugraben.
AI Browser Wars
Sollte OpenAI den Browser tatsächlich veröffentlichen, drängt man auf einen Markt, den zahlreiche Firmen ins Visier nehmen. Was sich anbahnt, ist eine neue Generation von Browsern. Bis dato sind diese dazu da, Webseiten zu laden, erklärt etwa Josh Miller, CEO der Browser Company, die den Arc Browser entwickelt und nun am Dia-Projekt arbeitet. Je mehr Funktionen wie Recherchen, Datenanalyse, Bildgestaltung und Nachrichten-Konsum sich auf die KI-Chatbots verlagert, desto mehr stehen die in Konkurrenz mit Browser.
Für die KI-Anbieter ist daher zu verlockend, eine Anwendung zu haben, in der sich die digitale Welt praktisch vollständig abspielt. Wer diesen Markt dominiert, kann mit Vorteilen rechnen, so wie es bei Google mit dem Chrome-Browser der Fall ist. Branchenbeobachter wie Platformer-Journalist Casey Newton sprechen daher bereits von einem sich anbahnenden AI Browser War.
Wie KI-Browser funktionieren können
Bis dato setzen KI-Browser vor allem auf eine Sidebar, um den KI-Assistenten zu integrieren. Dieser läuft nebenher und man kann sich etwa eine Zusammenfassung zur jeweils aufgerufenen Website geben lassen und weitergehende Fragen stellen.
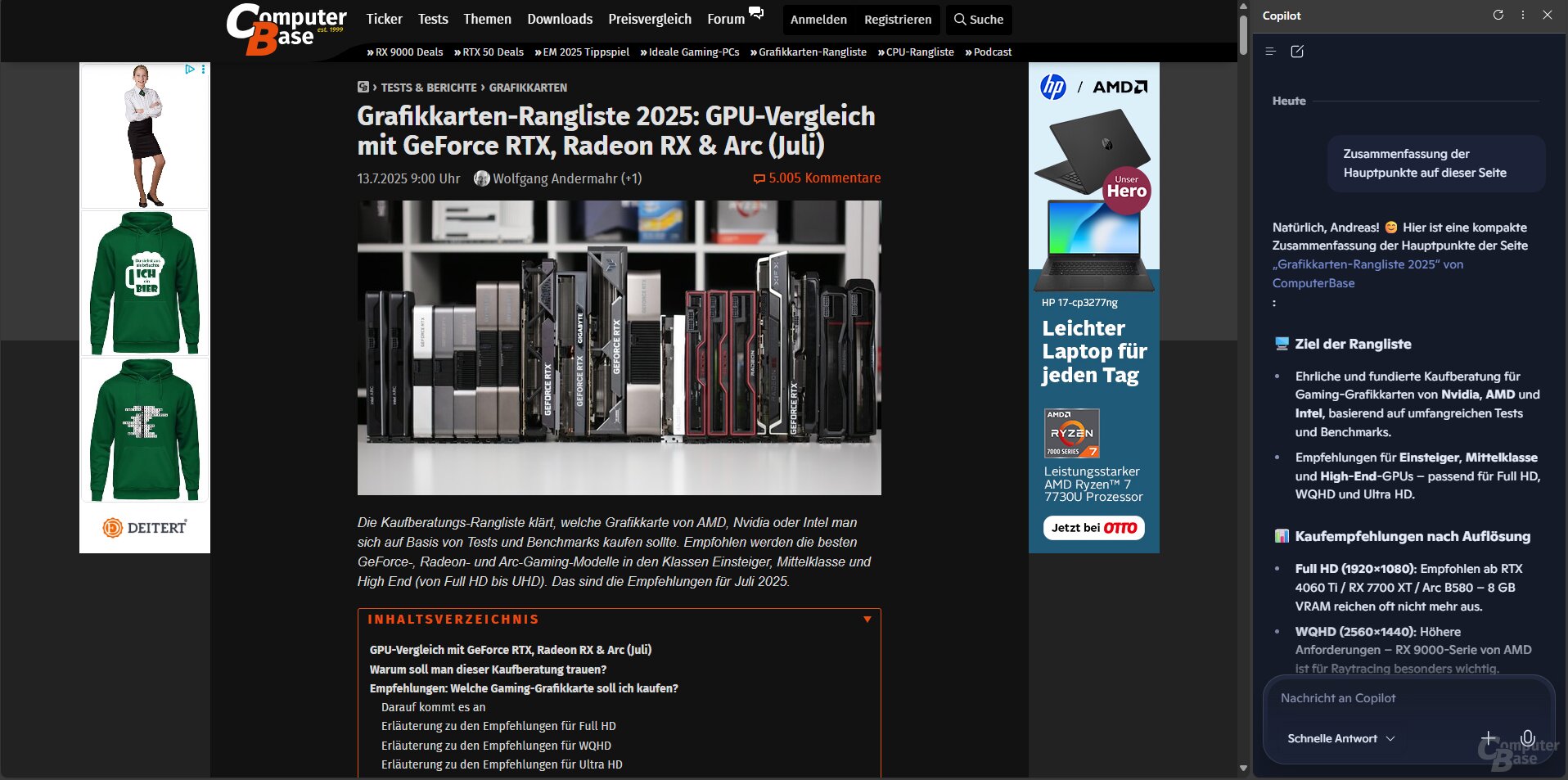
Absehbar ist aber: Agenten rücken künftig in den Mittelpunkt. Es handelt sich also um KI-Assistenten, die selbständig mehrstufige Aufgaben übernehmen und beispielsweise selbst Webseiten bedienen können. Einen Vorgeschmack liefert der Comet-Browser, den Perplexity in dieser Woche präsentiert hat.
Der Analyst und Autor Marcel Weiß hat bereits die aktuelle Version getestet. Im Neunetz-Newsletter schildert er, wie die Agenten-Funktionen des Come-Browsers bereits in der Lage sind, die Zutaten von einem Chefkoch-Rezept auszulesen, beim Anbieter Knuspr den Warenkorb mit den Produkten zu füllen und den Gesamtpreis zu berechnen. Das klappe schon vielversprechend.
Insbesondere das Online-Shopping sieht Weiß weitreichende Konsequenzen durch KI-Browser. Es sind aber noch wesentlich mehr Anwendungsgebiete möglich. Ein Beispiel betrifft etwa Abonnenten von Zeitschriften wie dem Spiegel oder dem Economist, zahlende Kunden haben dort Zugang zu einem vollständigen Archiv. Ein KI-Browser ist nun in der Lage, das komplette Archiv zu einem bestimmten Thema auszuwerten.
Um eine Frage zu beantworten, sucht man in solchen Fällen also nicht mehr einzelne Webseiten auf. Stattdessen ist es der KI-Agent im Browser, der benötigte Informationen sammelt und etwa Warenkörbe bedient. Es ist also eine Entwicklung, die laut Weiß das Internet-Ökosystem noch mehr verändern könnte, als es schon mit Chatbots und Suchmaschinen der Fall ist.
KI-Browser: Von Perplexity bis zum Microsoft Edge
Noch befindet sich die Entwicklung aber in einer frühen Phase. Wer Comet nutzen will, benötigt etwa ein Perplexity-Max-Abonnent, das 200 US-Dollar im Monat kostet. Ein weiterer Anbieter bei den KI-Browsern ist The Browser Company, deren Dia-Projekt befindet sich derzeit aber noch in einer offenen Beta. Opera hat derweil mit Neon einen KI-Browser im Angebot, Microsoft entwickelt derweil den Edge-Browser laufend weiter.
Der Edge soll künftig ebenfalls einen KI-Agenten erhalten, der einen beim Surfen im Netz unterstützt. Mit Copilot Vision hat dieser zudem eine Screensharing-Funktion, die ebenfalls einen Ausblick auf das gibt, was Browser künftig machen. Denn der KI-Assistent analysiert auf diese Weise, was auf dem Bildschirm passiert, und kann basierend auf den Inhalten direkt Vorschläge machen. Das Ziel ist also ein Assistent, der einem praktisch immer über die Schulter schaut.
Apps & Mobile Entwicklung
Luft oder Wasser: Wie kühlt ihr euren Desktop-PC und was ist mit AiO-Kühlern?
Die Leistungsaufnahme neuer Hardware ist in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Wie begegnet ihr der höheren Abwärme bei der Kühlung eures Desktop-Systems? Setzt ihr noch auf Luft oder schon auf Wasser? Und welche Gründe sprechen für oder gegen eine AiO-Wasserkühlung für den Prozessor?
Reicht noch Luft oder muss es schon Wasser sein?
Ob der Blick auf Prozessoren oder Grafikkarten fällt, eines hat die Next-Gen-Hardware der letzten Jahre weitestgehend gemeinsam: Der Stromverbrauch ist gestiegen. Heute soll es drei Jahre nach der ersten Sonntagsfrage zu diesem Thema erneut um den Umgang mit dem Übel des hohen Verbrauchs gehen. Denn ist die Leistung einmal im System drin, will sie als thermische Verlustleistung wieder heraus.
Dass die ComputerBase-Leser zunehmend auch Wasserkühlungen verbauen, geht bereits aus der jährlichen Hardwareumfrage hervor. Im Dezember 2024 gaben rund 35 Prozent der Teilnehmer an, eine Wasserkühlung im Einsatz zu haben – Tendenz steigend. Wie sieht es im Herbst 2025 konkret aus: Ist der Anteil entsprechender Lösungen dem Trend folgend weiter gestiegen?
Wie kühlen ComputerBase-Nutzer mit Wasser?
Einleitend sei dementsprechend gefragt, ob ihr euren Desktop-PC auch oder sogar ausschließlich mit Wasser kühlt. Die historischen Daten dieser und der nachfolgenden Umfragen beziehen sich jeweils auf den Stand von vor drei Jahren. Wer nicht über einen Desktop-PC verfügt, sollte sich diese Woche bei sämtlichen Umfragen enthalten.
-
Mein PC kommt ohne aktive Kühlung aus.
Historie: 0,6 %
-
Ich kühle meinen PC ausschließlich mit Luftkühlern.
Historie: 62,2 %
-
Ich setze für eine Komponente auch auf eine Wasserkühlung.
Historie: 21,7 %
-
Meine Hardware kühle ich gleich in mehreren Fällen mit Wasser.
Historie: 15,4 %
-
Aktiv gekühlt werden Komponenten bei meinem PC ausschließlich mit Wasser.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, auf welche Art von Wasserkühlung die ComputerBase-Leser zurückgreifen, wenn denn eine verbaut ist. Die allermeisten werden in das Thema mit sogenannten All-in-One-Wasserkühlungen einsteigen, die insbesondere für CPUs beliebt sind und eine entsprechende Kühleinheit, zumeist mit Pumpe, über zwei Schläuche fest an einen Radiator binden. Doch wie hoch ist der Anteil an Custom-Wasserkühlungen mit Soft- oder gar Hardtubes?
-
Ich verwende ausschließlich AiO-Wasserkühlungen.
Historie: 55,5 %
-
Mein System wird von einer Custom-Wasserkühlung mit Schläuchen (Softtubes) gekühlt.
Historie: 35,8 %
-
Ich habe eine Custom-Wasserkühlung mit Hardtubes verbaut.
Historie: 8,7 %
Interessant ist zudem, welche Bauteile eigentlich unter Wasser gesetzt werden. Abseits der erwähnten CPU-Kühler finden sich vermehrt auch Grafikkarten mit All-in-One-Kühlung. Monoblocks für Mainboards oder Wasserkühlungen für RAM- und SSD-Speicher sind allerdings inzwischen ebenfalls ein Thema.
-
Ich vertraue für meine CPU auf eine Wasserkühlung.
Historie: 98,1 %
-
Ich habe meine Grafikkarte unter Wasser gesetzt.
Historie: 43,7 %
-
Mein Mainboard, also Chipsatz oder Spannungswandler, kommt in den Genuss einer Wasserkühlung.
Historie: 8,7 %
-
Ich kühle meinen Arbeitsspeicher mit Wasser.
Historie: 2,4 %
-
Sogar meine SSD ist wassergekühlt!
Historie: 1,1 %
Wie viele Lüfter stecken im Gehäuse?
Eine Frage, die wiederum nicht nur Besitzer von PC-Systemen mit Wasserkühlung betrifft, ist die nach der Anzahl der verbauten Gehäuselüfter. Dass insbesondere Grafikkarten mit einer Leistungsaufnahme von weit über 300 Watt auf einen kräftigen Luftstrom im Gehäuse angewiesen sind, um die erzeugte Abwärme außer Reichweite des GPU-Kühlkörpers zu bringen, hat ComputerBase mit dem bisherigen Negativ-Rekord von 575 Watt TDP bei der GeForce RTX 5090 erneut thematisiert.
-
Keine.
Historie: 2,2 %
-
Einen.
Historie: 3,2 %
-
Zwei.
Historie: 10,5 %
-
Drei.
Historie: 24,3 %
-
Vier.
Historie: 18,0 %
-
Fünf.
Historie: 13,3 %
-
Sechs.
Historie: 10,9 %
-
Sieben.
Historie: 6,0 %
-
Acht.
Historie: 2,9 %
-
Neun.
Historie: 2,5 %
-
Zehn.
Historie: 2,5 %
-
Elf.
Historie: 0,6 %
-
Zwölf.
Historie: 0,8 %
-
Mehr als Zwölf.
Historie: 2,3 %
Mitgezählt werden dabei auch Lüfter auf einem Radiator, wenn an dessen Stelle ohne Wärmetauscher trotzdem Gehäuselüfter installiert wären. Nicht mitgezählt werden allerdings Lüfter, die sich beispielsweise auf dem Kühlkörper einer Grafikkarte befinden.
Im High-End-Segment und dem steigenden Stromverbrauch geschuldet sind inzwischen auch in der Mittelklasse drei Lüfter auf einer Grafikkarte Standard. Für Einsteigerkarten oder ältere Lösungen gilt das aber mitnichten. Daher lautet die nächste Frage: Auf wie viele Lüfter kommt eure Grafikkarte?
CPU-Luftkühler oder All-in-One-Wasserkühlung?
Sogenannte All-in-One-Wasserkühlungen für den Prozessor, die in der Regel als fest verbundenes Komplettpaket aus Kühlblock, Reservoir, Pumpe und Radiator mit Lüftern zu kaufen sind, gewinnen in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit. Falls auch ihr eine AiO-Kühlung für die CPU verbaut habt, wieso habt ihr euch dafür entschieden?
-
Höhere Kühlleistung als bei einem Luftkühler
-
In meinem Gehäuse wäre für einen Tower-Kühler zu wenig Platz
-
Ich wollte freien Blick auf Mainboard und RAM haben
-
Mir gefallen AiO-Kühler optisch besser als CPU-Luftkühler
-
Ich hatte schlicht und ergreifend Lust auf Wasser im PC und wollte das mal ausprobieren
-
Ich war auf die zusätzliche Funktionalität aus: Display, Sensoren oder Lüftersteuerung
-
Eine Eigenbau-Wasserkühlung war mir zu teuer
-
Eine Eigenbau-Wasserkühlung war mir zu kompliziert oder zeitaufwändig
-
Andere Gründe, siehe meinen Kommentar im Forum
Oder welche Gründe sprachen dagegen, falls ihr euch klassisch für einen Luftkühler entschieden habt?
-
Eine AiO war mir zu teuer
-
Eine AiO war mir (im Einbau) zu kompliziert
-
Mein Gehäuse ist dafür nicht ausgelegt
-
Ich habe keine Lust auf die Pumpengeräusche
-
Ich sorge mich um die Haltbarkeit
-
Ich brauche die Kühlleistung schlicht und ergreifend nicht
-
Ich finde AiOs optisch nicht ansprechend
-
Andere Gründe, siehe meinen Kommentar im Forum
Zwei weitere Umfragen richten sich speziell an diejenigen Teilnehmer, die eine AiO-Kühlung verbaut haben. Erstens: Wie groß ist der Radiator eures Modells?
-
120 mm
-
240 mm
-
280 mm
-
360 mm
-
420 mm
Und zweitens: Wie lange habt ihr eure AiO-Wasserkühlung schon in Betrieb?
Von welchem Hersteller kommt der CPU-Kühler?
Egal ob Luftkühler oder AiO, in beiden Fällen stellt sich die Frage, welchem Hersteller die Community auf ComputerBase vertraut. Los geht es mit den Luftkühlern. Wer auf eine AiO oder Custom-Wasserkühlung setzt, sollte sich entsprechend enthalten.
-
Alpenföhn
-
AMD
-
Arctic
-
be quiet!
-
Cooler Master
-
DeepCool
-
Endorfy
-
Enermax
-
ID-Cooling
-
Intel
-
Noctua
-
Scythe
-
Silverstone
-
Thermalright
-
Thermaltake
-
Xilence
-
Anderer Hersteller
Wer eine AiO-Kühlung für den Prozessor einsetzt, darf sich jetzt zum Hersteller äußern. Nutzer eines Luftkühlers oder mit Custom-Wasserblock sollten sich enthalten.
-
Alpenföhn
-
Alphacool
-
Arctic
-
Asus
-
Cooler Master
-
Corsair
-
Endorfy
-
Lian Li
-
MSI
-
NZXT
-
Phanteks
-
Thermalright
-
Thermaltake
-
Xigmatek
-
Xilence
-
Anderer Hersteller
Muss eure Kühlung leise sein und seid ihr damit zufrieden?
Ein Aspekt, der beim Thema PC-Kühlung keinesfalls fehlen darf, ist die Lautstärke. Einigen Nutzern sind die Geräuschemissionen ihres Systems beim Spielen mit geschlossenem Headset herzlich egal, andere hingegen schwören auf Silent-PCs. Wie wichtig ist ComputerBase-Lesern eine möglichst lautlose Kühlung? Seid ihr sogar dazu bereit, Kompromisse bei Temperatur oder gar Leistung einzugehen und habt ihr eurer Grafikkarte dementsprechend enge Fesseln bei Takt und Power-Limit angelegt? Ausführliche Kommentare dazu sind wie immer erwünscht.
-
Die Lautstärke ist mir egal – Leistung und niedrige Temperaturen stehen im Fokus.
Historie: 3,6 %
-
Ich bin da eher unempfindlich, kaufe aber dennoch vorzugsweise leise Hardware.
Historie: 26,9 %
-
Ich mag es gerne etwas leiser und zu diesem Zweck darf es mit höherem Temperaturziel auch heißer werden.
Historie: 41,1 %
-
Eine niedrige Lautstärke ist für mich das wichtigste – ich habe alles zu diesem Zweck optimiert und nehme auch Einbußen bei der Leistung hin.
Historie: 28,4 %
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr persönlich ganz andere Ansichten vertretet, die von den bei den Umfragen im Artikel gegebenen Antwortmöglichkeiten nicht abgedeckt werden, könnt ihr davon ebenfalls im Forum berichten. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.
Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind im Forum häufig nach wie vor spannende Diskussionen im Gange.
Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht
Motivation und Datennutzung
Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.
Apps & Mobile Entwicklung
Diese Powerstation soll ein wichtiges Problem lösen!
Powerstations sollen als tragbare Stromlösung nicht nur beim Camping eine optimale Energie-Lösung bieten. Auch im Falle eines Stromausfalls oder „Blackouts“ können die Geräte Eure wichtigsten Geräte weiterhin versorgen. Jackery hat mit der Explorer 500 v2 jetzt allerdings ein Modell auf den Markt gebracht, das ein nerviges Problem bewältigen soll. Wir haben die Powerstation für Euch einem Kurztest unterzogen.
Powerstations sind häufig recht sperrig und schwer. Dadurch geht die Möglichkeit der „tragbaren“ Stromlösung häufig mit nahenden Rückenschmerzen einher. Genau das soll die Jackery Explorer 500 v2 nun ändern. Das Gerät bietet nicht nur ein geringes Gewicht von gerade einmal 5,7 kg, was ungefähr einem kleinen Kasten Wasser entspricht, sondern kann auch mit seiner Vielseitigkeit glänzen.
Preis & Verfügbarkeit der Jackery Explorer 500 v2
Stellt sich natürlich die Frage, wie viel der Hersteller für ein solches Gerät verlangt. Während Flaggschiff-Modelle nicht selten 500 Euro oder mehr kosten, seid Ihr bei der leistungsstarken Mini-Powerstation deutlich günstiger unterwegs. Aktuell bekommt Ihr die Explorer 500 v2 bereits für 319 Euro* direkt beim Hersteller geboten. Möchtet Ihr Euch ein SolarSaga 100-Solarmodul zusätzlich schnappen, werden gerade einmal 449 Euro fällig.
Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Jackery. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.
Kompakt, preiswert, praktisch?
Mit der Explorer 500 v2 knüpft Jackery an den Bestseller Explorer 500 an. Statt eines schwerfälligen Geräts erwartet Euch ein Leichtgewicht mit nur 5,7 Kilogramm. Das Gerät ist rund 27 Prozent kleiner als vergleichbare Modelle – und passt damit locker in den Kofferraum oder sogar unter den Schreibtisch. Wer bisher gezögert hat, in ein Modell zu investieren, weil er keine Powerstation „schleppen“ wollte, dürfte somit in diesem portablen Stromspeicher eine gelungene Alternative finden.
Im Inneren stecken 512 Wattstunden Kapazität und bis zu 500 Watt Ausgangsleistung. Sechs Anschlüsse sorgen dafür, dass Ihr Laptops, Smartphones, Lampen und selbst kleinere Kühlboxen problemlos versorgen könnt. Neben zwei AC-Ausgängen findet Ihr zwei USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Anschluss sowie einen Zigarettenanzünder-Anschluss. Für Camping, Garten oder kleine Notfälle im Haushalt ist das Gerät damit bestens aufgestellt. Auch preislich ist die Jackery Exolorer 500 v2 eine günstige Gelegenheit.
Zurzeit ist das Modell für lediglich 319 Euro* direkt bei Jackery verfügbar. Inklusive des 100 Watt Solarmoduls SolarSaga 100 zahlt Ihr 449 Euro. Dadurch gestaltet sich die Explorer 500 v2 zu einem attraktiven Einsteigermodell, wenn für Euch nicht nur die eigene Stromproduktion relevant ist, sondern zugleich auch eine möglichst freie Verfügbarkeit des Stroms. Wer hingegen die Stromkosten im Haushalt senken möchte, kommt für denselben Preis an ein Solarmodul mit mehr Watt inklusive Wechselrichter. Hier ist entscheidend, was für Euch die größere Bedeutung hat: die Menge der Stromausbeute oder die Flexibilität.

Alltagseinsatz statt Muskeltraining
Viele Powerstations sind so schwer, dass Ihr fast einen Gabelstapler braucht. Die Explorer 500 v2 dagegen begleitet Euch mühelos durch den Garten oder auf einen Wochenendtrip. Auch das passende Solarmodul SolarSaga 100 ist leicht zu transportieren. So wird die kleine Box schnell zum flexiblen Energielieferanten – egal ob für Eure Campinglampe oder die Gartenbeleuchtung. Gerade diese Flexibilität ist in meinen Augen ein echter Zugewinn. Denn auch wenn ich gern den Solarstrom aus Powerstations nutze, wo immer es geht, habe ich wenig Freude daran, die meisten durch Garten und Haus zu tragen.
Beachtet jedoch: Eine Kaffeemaschine oder einen Wasserkocher wird die Powerstation nicht stemmen können. Aber für kleinere Verbraucher ist sie mehr als ausreichend. Gerade für Einsteiger ist das die wohl angenehmste Art, mobile Stromversorgung auszuprobieren. Kombiniert mit dem geringeren Einstiegspreis, ist die Hürde zur mobilen Energieversorgung zugleich gesunken.
Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Jackery verspricht bis zu 6.000 Ladezyklen. Bei einer Ladung im 2-Tages-Rhythmus soll laut Hersteller so eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren möglich sein. Realistisch hängt das natürlich stark davon ab, wie oft Ihr den Speicher auf- und entladet. Eine 5-Jahres-Garantie gibt euch Jackery aber in jedem Fall mit.
Praktisch: Dank Stromsparmodus verliert die Powerstation kaum Energie, wenn Ihr sie mal nicht nutzt. Eine Woche Pause nach der letzten Ladung? Kein Prozentverlust. Eine App-Unterstützung gibt es zwar nicht, dafür zeigt das Display präzise an, wie viel Energie Ihr gerade verbraucht oder noch zur Verfügung habt. Es ist auch nicht verwunderlich, dass diese Powerstation nicht wie andere der Hersteller mit einer App-Unterstützung angeboten wird. Mit ihren 512 Wattstunden ist die Speicherkapazität geringer und auch die Aufrechterhaltung von Funksignalen benötigt Energie. So bleibt mehr Leistung der Powerstation für die Versorgung von Elektrogeräten übrig.

Grenzen der Explorer 500 v2
Trotz vieler Vorteile bleibt die Leistung begrenzt. Mit 500 Watt Ausgangsleistung versorgt Ihr zwar Akkus, Laptops oder eine Kühlbox, aber keine großen Küchengeräte oder Werkzeuge. Heimwerker, die regelmäßig zur Bohrmaschine greifen, stoßen hier schnell an Grenzen. Wollt Ihr also elektronisches Werkzeug oder Gartengeräte mit Solarstrom betreiben, müsst Ihr auf ein leistungsstärkeres Modell aus Jackerys Sortiment setzen.
Doch die Explorer 500 v2 hat ein Ass im Ärmel: Sie reagiert in nur 10 Millisekunden als Notstromversorgung. Bei Stromausfällen übernimmt sie sofort und hält Licht, Router oder Computer am Laufen. Für manche von Euch kann das schon den entscheidenden Unterschied machen.
Fazit: Klein, leicht und ein guter Einstieg
Die Jackery Explorer 500 v2 ist kein Kraftprotz, aber ein cleveres Einstiegsmodell. Sie kombiniert geringes Gewicht, lange Haltbarkeit und viele praktische Einsatzmöglichkeiten. Dank 5,6 kg löst sie also vor allem das Problem der tragbaren Stromlösung. Für Camping, Garten oder als Backup bei Stromausfällen ist sie demnach eine smarte Wahl.
Eines ist sicher: Für alle, die den ersten Schritt in Richtung mobiler Stromversorgung wagen wollen, ist die Explorer 500 v2 ein handlicher Begleiter, den Ihr problemlos tragen könnt.
Was haltet Ihr von der Powerstation? Könnte sich die Explorer 500 v2 durchsetzen? Lasst es uns wissen!
Apps & Mobile Entwicklung
Linux-News der Woche: Ubuntu 25.10 mit GNOME 49 & Kernel 6.17, ROCm für RX 9060

Ubuntu 25.10 ist – mit GNOME 49 und Kernel 6.17 ausgestattet – erschienen. Dabei finden immer mehr Module auf Rust-Basis Einzug. AMD aktualisierte wiederum ROCm um Radeon-RX-9060-Unterstützung. Qt6.10 nutzt ab sofort PipeWire für Multimedia und erleichtert die Bedienbarkeit. Das neue CLUDA ermöglicht OpenCL über CUDA.
Ubuntu 25.10 „Questing Quokka“
Ubuntu 25.10 ist da. Questing Quokka – so der Codename – kommt mit GNOME 49 und zahlreichen weiteren Neuerungen. Rust-basierte Anwendungen gewinnen mehr an Bedeutung im neuen Release. So ziehen die Rust-Implementierung von sudo und coreutils in Ubuntu ein.
Ebenfalls mehr Verwendung findet das TPM-Modul, das TPM-basierte Festplattenverschlüsselung bietet. Durch den Einsatz des Kernels 6.17 wird auch aktuelle Hardware vom Betriebssystem unterstützt und bringt neue Softwareversionen von OpenJDK (25), Python (3.14 RC3), Golang (1.25), GCC (15) und Rust (1.85/1.88). Die vollständigen Änderungen finden sich in Canonicals Blogeintrag.
AMD ROCm mit RX-9060-Unterstützung
Mit ROCm 7.0.2 unterstützt AMD nun die noch nicht im Retail-Markt erhältliche RX 9060 phne „XT“. Offiziell verfügbar ist das Softwarepaket für Debian 13, Oracle Linux 10 und RHEL 10.0. Mit dem Update werden auch offiziell zwei neue KI-Frameworks unterstützt, konkret FlashInfer und llama.cpp. Die vollständigen Patch-Notes finden sich im AMD-Blog.
Qt 6.10 mit Multi-Media-Verbesserungen
Qt 6.10 ist erschienen und bietet unter Linux ein verbessertes Multimedia-Erlebnis. Ab sofort setzt Qt auf PipeWire und verspricht sich davon bessere Performance und niedrigere Latenz. Container-Anwendungen werden unterstützt und generell die Kontrolle über die Verarbeitung und Hardware gestärkt. Weitere Neuerungen finden sich bei den Kontrastoptionen für einfachere Bedienbarkeit und das neue FlexboxLayout für einfacher gestaltbare UIs. Die vollständigen Änderungen finden sich im Qt-Blog.
CLUDA – OpenCL über CUDA
Wie Phoronix berichtet, hat Karol Herbst jüngst eine Merge Request für CLUDA eingereicht. Dabei handelt es sich um eine Gallium3D-API-Implementierung auf Basis der Nvidia-API CUDA. Auf diese Weise wird eine vollständige Umsetzung von OpenCL möglich.
„Somebody“ mentioned to me at XDC (yes, I started this project like last week once I got home and got access to an Nvidia GPU) that implementing OpenCL on top of CUDA in mesa could help out with something. I can’t really talk about that something here, but rest assured it wasn’t me having this idea. But anyway, if somebody wants to run OpenCL against the propriety driver and they miss a few OpenCL extension that are super important to them, they could use this OpenCL implementation I guess? Or add more extensions if they wanted to? I dunno really. Anyway, this is my first project targeting CUDA, and so I also learned about CUDA and PTX quite a bit here.
Der Merge-Request lässt sich auf der Seite des Mesa-Projekts nachlesen.
Downloads
-

4,6 Sterne
Ubuntu ist die bekannteste Linux-Distribution, der Fokus liegt auf einfacher Bedienung.
- Version 25.10 „Questing Quokka“ Deutsch
- Version 24.04.3 LTS „Noble Numbat“ Deutsch
-

 UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten
UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience
-

 UX/UI & Webdesignvor 1 Monat
UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online
-

 Social Mediavor 2 Monaten
Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R
-

 Entwicklung & Codevor 1 Monat
Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events
-

 UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen
UX/UI & Webdesignvor 4 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen
-

 Online Marketing & SEOvor 2 Monaten
Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows
















