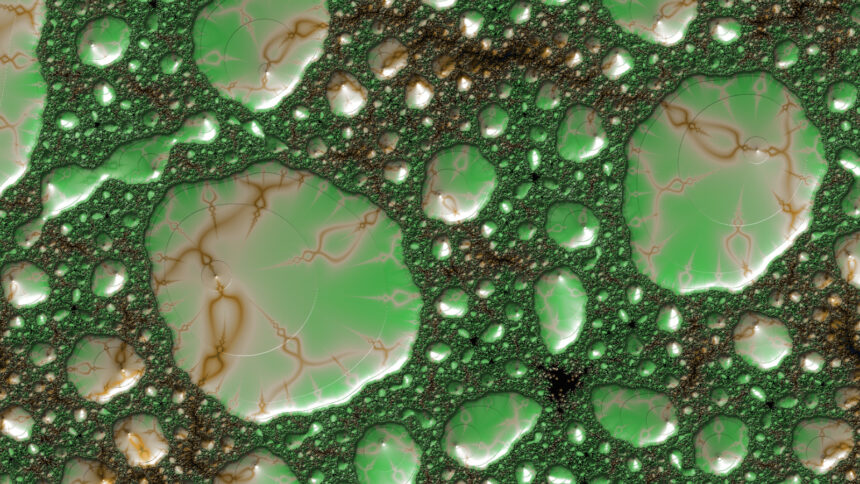Liebe Leser*innen,
diese Woche hat meine Kollegin Karoline einen Text darüber geschrieben, wie Menschen anhand ihrer Art zu gehen eindeutig identifiziert werden können. In Russland und China wird solche Gangerkennung schon lange eingesetzt, auch deutsche Polizeibehörden beschäftigen sich bereits mit dem Thema.
Amnesty International und AlgorithmWatch warnen davor, dass die Technologie das Ende der Anonymität im öffentlichen Raum bedeuten könnte. Denn gegen Gangerkennung hilft – anders als gegen Gesichtserkennung – keine Maskierung. Vor der Technologie kann man sich nicht verstecken.
KI, die menschliche Bewegungen analysiert, wird in Mannheim seit sieben Jahren getestet. Das ist die technologische Grundlage, die zur Gangerkennung nötig ist. Seit 1. September wird sie auch in Hamburg eingesetzt. Zahlreiche weitere Länder und Städte haben Interesse angemeldet. Die Technologie ist dazu gedacht, Straftaten zu detektieren, etwa Schlagen oder Treten. Die Erkennung weiterer Bewegungsabfolgen, etwa derer, die bei einem Drogendeal ausgeführt werden, ist geplant. Von da ist es nur ein kleiner Schritt bis zur Analyse der jeweils persönlichen Art zu gehen.
Die Technologie wird als besonders privatsphärenfreundlich beworben, weil sie die Bilder der betroffenen Menschen zu Strichzeichnungen abstrahiert. Weder Gesicht noch Statur spielen dabei eine Rolle. Doch wie der Text von Karoline zeigt, können genau solche Strichmännchen und die persönliche Art, die Glieder zu bewegen, Menschen eben doch eindeutig identifizieren.
Das ist ein Problem. Denn mit dem Argument, dass die Verhaltenserkennung ja so privatsphärenfreundlich sei, wird der Aufbau neuer Überwachungskameras deutlich erleichtert. Wenn die dann aber doch zur Identifikation von Personen eingesetzt werden können, schlägt der versprochene Privatsphärenvorteil ins Gegenteil um.
Viel Spaß beim Lesen!
Martin
Wir sind ein spendenfinanziertes Medium
Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.