Datenschutz & Sicherheit
HPE OneView: Kritische Lücke erlaubt Codeschmuggel aus dem Netz
In HPE OneView klafft eine kritische Sicherheitslücke, durch die Angreifer Schadcode einschleusen und ausführen können. Da das ohne vorherige Anmeldung aus dem Internet möglich ist, erhält die Schwachstelle die höchstmögliche Risikoeinstufung.
Weiterlesen nach der Anzeige
HPEs OneView dient zur zentralen Verwaltung von IT-Infrastrukturen wie Servern, Speichersystemen und Netzwerken. Die Schwachstellenbeschreibung vom Dienstag erörtert lediglich knapp: „Ein Remote-Code-Execution-Problem besteht in HPE OneView“ (CVE-2025-37164, CVSS 10.0, Risiko „kritisch“). Eine Sicherheitsmitteilung auf der HPE-Website ist kaum hilfreicher, nennt jedoch zumindest Randbedingungen: „Eine mögliche Sicherheitslücke wurde in der Hewlett Packard Enterprise OneView-Software erkannt. Die Schwachstelle könnte missbraucht werden, sie ermöglicht unauthentifizierten Nutzern aus dem Netz, Code aus der Ferne auszuführen“.
Worin die Schwachstelle konkret besteht und wie Angriffe aussehen könnten, erklärt HPE nicht. Betroffen sind jedoch alle Fassungen vor Version 11.00, die jüngst veröffentlicht wurde. HPE stellt sie im HPE-Software-Center zum Download bereit.
Hotfixes für ältere Versionen
Außerdem will HPE im Software-Center Hotfixes für ältere Versionen von OneView zwischen 5.20 und 10.20 zur Verfügung stellen. Der Hotfix muss nach einem Upgrade von OneView 6.60.xx auf 7.00.00 erneut angewendet werden, außerdem nach Anwenden von HPE Synergy Composer, ergänzt der Hersteller.
Aufgrund des Schweregrads der Sicherheitslücke sollten IT-Verantwortliche die Aktualisierung umgehend herunterladen und installieren.
Zuletzt mussten Admins eine hochriskante Sicherheitslücke in OneView für VMware vCenter mit Updates stopfen. Angreifer konnten dadurch ihre Nutzerrechte ausweiten und Befehle als Admin ausführen. Anfang 2024 gab es ebenfalls kritische Sicherheitslücken in HPE OneView, dort allerdings durch mitgelieferte Drittanbietersoftware wie den Apache HTTP-Server.
Weiterlesen nach der Anzeige
(dmk)
Datenschutz & Sicherheit
BSW auf Zustimmungskurs zu massiver Verschärfung
Stell dir vor, Du machst ein Polizeigesetz – und keiner macht mit. Vor diesem Szenario, so schien es auf den ersten Blick, stand die sächsische Regierung im vergangenen Herbst. Damals stellte sie ihren Entwurf für die Novelle des Polizeivollzugsdienstgesetzes (SächsPVDG) vor, der die Polizeibefugnisse auf Kosten der Grundrechte erheblich erweitern würde.
Die Liste der geplanten Maßnahmen ist lang und enthält unter anderem:
- Verhaltensscanner,
- automatisierte Datenanalyse durch eine Plattform wie Palantir,
- Staatstrojaner zur Gefahrenabwehr (Quellen-TKÜ),
- der Abgleich von Gesichtern und Stimmen mit dem Internet,
- die Ausweitung der automatisierten Kennzeichenerfassung,
- das Filmen in Autos (auch mit Drohnen), um gegen „Handy-Sünder:innen“ am Steuer vorzugehen.
Da die schwarz-rote Regierung in Sachsen keine eigene Mehrheit hat, ist sie auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Dafür hat die sächsische Regierung einen sogenannten Konsultationsmechanismus etabliert. In diesem Verfahren schicken die Fraktionen sowie einige Interessengruppen ihre Position zu einem geplanten Gesetz an die Regierung. Diese überlegt dann, was sie davon übernimmt – auch mit Blick auf die Mehrheitssuche im Landtag.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen hat kaum Einwände gegen die deutliche Verschärfung des SächsPVDG. Das geht aus einer Stellungnahme der Fraktion hervor, die netzpolitik.org durch des Sächsische Transparenzgesetzes erhalten hat. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass das BSW der sächsischen Minderheitskoalition zur Mehrheit verhilft.
Bisher schwieg das BSW zu seiner Position
Über das Sächsische Transparenzgesetz haben wir 24 der 26 abgegebenen Stellungnahmen erhalten. Wir veröffentlichen die Dokumente auf der Plattform FragDenStaat.
Enthalten sind alle Stellungnahmen fast aller Fraktionen im Landtag. Die AFD-Fraktion hat keine Stellungnahme abgegeben; sie hat sich öffentlich gegen den Konsultationsmechanismus ausgesprochen. Bei zwei Stellungnahmen verweigerten laut Bescheid die Urheber:innen „aus dem Bereich der wissenschaftlichen Forschung“ die Veröffentlichung zum „Schutz ihres geistigen Eigentums“.
Die Stellungnahme der BSW-Fraktion zeigt erstmals öffentlich die Position des Bündnisses zur SächsPVDG-Novelle. Nachdem Grüne und Linke frühzeitig harsche Kritik an dem Entwurf der Staatsregierung geübt hatten – und bereits gegen das bisher geltende SächsPVDG geklagt hatten –, rückten Beobachter:innen das BSW als potenzielle Mehrheitsbeschafferin in den Fokus.
Was das BSW Sachsen über den Entwurf denkt, war bisher allerdings unklar. In der Vergangenheit kündigte das Bündnis lediglich an, den Entwurf zu prüfen. Inhaltliche Nachfragen von netzpolitik.org beantwortete das BSW in der Vergangenheit nicht. Seine Stellungnahme bestätigt jetzt, dass es zwischen Schwarz-Rot und den Wagenknecht-Anhänger:innen erhebliche Schnittmengen gibt.
Im Unterschied zu anderen Fraktionen hat das Bündnis Sahra Wagenknecht eine eher kurze Stellungnahme abgegeben. Auf nicht mal vier vollen Seiten kritisiert die BSW-Fraktion lediglich sieben Punkte des weitreichenden Vorschlags des Sächsischen Innenministeriums. Sie bleibt damit nicht nur hinter den ebenfalls oppositionellen Grünen und Linken zurück, sondern sieht den Gesetzentwurf sogar weniger kritisch als die mitregierende SPD-Fraktion.
BSW kritisiert „Vorfeldstraftat“
Doch welche Punkte will das BSW abändern? In ihrer Stellungnahme wendet sich die Fraktion gegen das Konzept der „Vorfeldstraftat“, die in der SächsPVDG-Novelle eingeführt wurde. Eine Vorfeldstraftat ist laut Gesetzentwurf ein Straftatbestand,
der Verhaltensweisen erfasst, die vom Gesetzgeber als generell gefährlich für Individualrechtsgüter oder Kollektivrechtsgüter bewertet werden, aber als einzelne Handlungen in räumlicher oder zeitlicher Hinsicht noch vor einer konkreten oder konkretisierten Gefährdung oder gar Verletzung solcher Rechtsgüter liegen können und damit strafbewehrte Vorbereitungshandlungen darstellen.
Der Begriff ist wichtig, weil an ihn eine Vielzahl alter und neuer Polizeibefugnisse im SächsPVDG-Entwurf geknüpft ist.
Das BSW sieht in der „Vorfeldstraftat“ eine „fragwürdige Vorverlagerung polizeilicher Eingriffsbefugnisse“. Es drohe „eine Kriminalisierung von bloßen Verdachtsmomenten oder sozial auffälligem Verhalten sowie die Verwischung der Grenze zwischen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung“. Nicht nur das BSW hatte hier Bedenken, selbst die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) sieht die entworfene Definition als zu weit gefasst an.
Nein zur Echtzeit-Identifizierung, Ja zum Verhaltensscanner
Das BSW lehnt auch einen Teil der KI-gestützten Videoüberwachung ab, die sogenannte biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung. Dabei sollen Polizist:innen unter bestimmten Voraussetzungen einen Echtzeitabgleich von „live“ gefilmten Menschen mit ihren eigenen Datenbeständen vornehmen. Das ist laut BSW ein „besonders schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte“ und „eröffnet die Gefahr einer faktischen Massenüberwachung im öffentlichen Raum“.
Die im gleichen Paragrafen eingeführten Verhaltensscanner begrüßt die BSW-Fraktion hingegen. Man erkenne die „Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit“ dieser Regelung an und teile sie, heißt es in der Stellungnahme.
Nur anonyme Polizeidaten fürs KI-Training
Dass KI-Modelle mit Daten der Polizei trainiert werden können, will das BSW nur dann erlauben, wenn diese Daten anonymisiert sind. Der Entwurf hatte auch personenbezogene Daten für das KI-Training freigegeben, wenn eine Pseudonymisierung oder Anonymisierung nicht möglich gewesen wäre.
Außerdem möchte das BSW die Schwelle für Öffentlichkeitsfahndungen erhöhen (von einer „Gefahr“ zu einer „dringenden Gefahr“ für Leib, Leben oder Freiheit eines Menschen) sowie die automatisierte Erfassung von Nummernschildern auf die Verhinderung von Straftaten mit Grenzbezug beschränken.
Nach dem Willen der BSW-Abgeordneten soll das Filmen von Bodycams in Wohnungen auf drei Jahre befristet und umfassend evaluiert werden. Ebenfalls evaluiert werden soll der Einsatz von Tasern. Hier spricht sich das BSW gegen einen flächendeckenden Roll-out aus. Stattdessen sollen Polizist*innen zunächst nur in einem Revier im ländlichen Raum sowie in einem „Großstadtrevier“ Taser bekommen. Auch die SPD-Fraktion hatte sich für eine Erprobung in lediglich zwei Polizeidirektionen ausgesprochen, bevor alle Polizist:innen im Land Taser erhalten.
Kein Änderungsbedarf bei Palantir-Paragrafen
Spannender als die Punkte, die das BSW abgeändert sehen will, sind jene Teile des Entwurfs, auf die das BSW nicht eingeht. Bei diesen sehe man keinen Änderungsbedarf, bestätigt die Pressesprecherin der Fraktion auf Anfrage von netzpolitik.org. Die Stellungnahme sei auch heute noch aktuell, so die Sprecherin.
Ein Streitpunkt ist Palantir. Der Entwurf der SächsPVDG-Novelle sieht die Einführung einer Plattform zur automatisierten Datenanalyse vor. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und NRW setzen hier auf Produkte der Firma Palantir.
Während eine solche Plattform für automatisierte Datenanalyse für grundsätzliche Kritik von Datenschützer:innen sorgt – der IT-Sicherheitsexperte Manuel Atug spricht von „Rasterfahndung by design“ – richtet sich die Kritik auch konkret gegen Palantir.
Wir sind communityfinanziert
Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.
So hilft die Firma der Abschiebehörde ICE in den USA bei der Jagd auf Migrant*innen. Laut einem Bericht der Schweizer Armee ist es zudem möglich, dass die US-Regierung und die Geheimdienste die Daten einsehen können. Außerdem ist Palantir Mit-Gründer Peter Thiel ein Unterstützer Donald Trumps und glaubt nach eigener Aussage nicht daran, „dass Demokratie und Freiheit noch kompatibel sind“.
Die SPD in Sachsen hat sich mehrfach gegen die Beschaffung einer Palantir-Software ausgesprochen, zuletzt in ihrer Stellungnahme zum Konsultationsverfahren. Das BSW springt den Sozialdemokrat:innen hier offenbar nicht bei, sie müssen sich also in den Verhandlungen selbst durchsetzen.
Mit Drohnen auf Spatzen schießen
Ebenso ignoriert das BSW die Kritik an der Videoüberwachung von Autofahrer:innen. Nach dem Entwurf der SächsPVDG-Novelle soll die Polizei auch in Autos filmen dürfen, um Handy-Nutzer:innen am Steuer zu erwischen. Dafür sollen auch Drohnen eingesetzt werden können. Die Nutzung eines Handys beim Fahren ist eine Ordnungswidrigkeit, dementsprechend unverhältnismäßig ist der Einsatz von Drohnen und anderen Videokameras.
Nicht nur die SPD kritisiert diesen Teil des Gesetzentwurfs, auch die sächsische Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert äußert sich deutlich: „Angesichts der auf der Hand liegenden Unverhältnismäßigkeit der Befugnis sei nur am Rande erwähnt, dass die vorgesehene Offenheit, also Erkennbarkeit der Videoüberwachung des fließenden Straßenverkehrs dann kaum umzusetzen wäre, wenn sie mittels Drohnen erfolgen soll.“ Die Vorschrift sei „offensichtlich verfassungswidrig und sollte ersatzlos gestrichen werden“, schreibt Hundert in ihrer Stellungnahme.
Kein kritisches Wort zu Staatstrojanern
Ebenfalls keine Probleme hat das BSW mit dem erweiterten Einsatz von Staatstrojanern. Die sächsische Regierung will die Quellen-TKÜ auch zur Gefahrenabwehr ermöglichen. Ginge es nach der CDU, soll das gleiche auch für die Online-Durchsuchung gehen.
Auch zur Erkennung von Gesichtern und Stimmen mit Internet-Daten formuliert das BSW keine Position, obwohl es Zweifel daran gibt, dass diese Befugnis rechtlich haltbar wäre. Laut einem Gutachten von AlgorithmWatch ist es technisch nicht umsetzbar, frei verfügbare Bilder aus dem Internet für einen Abgleich praktikabel durchsuchbar zu machen, ohne eine Datenbank dieser Bilder zu erstellen. Das wiederum verbietet die KI-Verordnung der EU.
Wie es weitergeht
Was heißt das alles für das finale Gesetz? Zwar sieht das BSW ebenfalls Änderungsbedarf bei einzelnen problematischen Paragrafen, es positioniert sich aber etwas weniger kritisch als die mitregierende SPD-Fraktion und ist noch weiter entfernt von der umfassenden Kritik von Grünen und Linken. Das erleichtert die Kompromissfindung mit der CDU und dem von ihr geführten Innenministerium, macht allerdings ein SächsPVDG unwahrscheinlicher, das die Grundrechte schont.
Inwiefern das Innenministerium auf die Wünsche des BSW, aber auch der Regierungsfraktionen eingehen wird, ist aktuell unklar. Daher verspricht das BSW auch noch keine Zustimmung zum Gesetz. „Es hängt davon ab, ob wir uns hinsichtlich der abweichenden Auffassungen annähern können“, schreibt eine Pressesprecherin der BSW-Fraktion gegenüber netzpolitik.org.
Das sächsische Innenministerium erklärt auf Anfrage, dass das Konsultationsverfahren abgeschlossen sei. Bisher wurde der überarbeitete Entwurf dem Parlament aber noch nicht übermittelt. „Voraussetzung für die Zuleitung des Gesetzesentwurfs an den Sächsischen Landtag ist die zweite Kabinettsbefassung“, teilt das Innenministerium auf Anfrage von netzpolitik.org mit.
Die nächste reguläre Sitzung des Innenausschusses ist am 12. März. Dann könnten die Abgeordneten eine Sachverständigenanhörung im Landtag ansetzen. Insgesamt haben Regierung und Parlament bis Ende Juni Zeit, dass SächsPVDG abzuändern. Andernfalls verliert die Polizei einige ihrer Befugnisse, weil der sächsische Verfassungsgerichtshof das aktuelle Polizeigesetz an einigen Stellen für verfassungswidrig erklärt hatte.
Datenschutz & Sicherheit
KW 5: Die Woche, als die Regierung sich an Automatisierung berauschte
Die 5. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 16 neue Texte mit insgesamt 117.090 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.
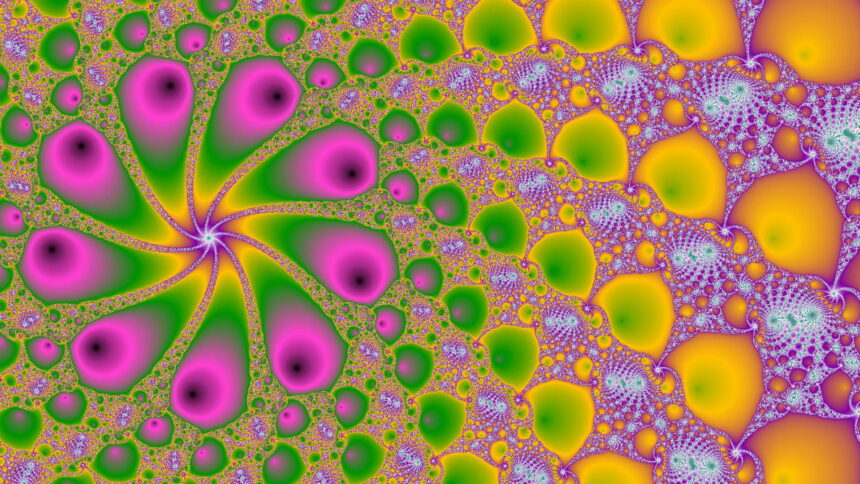
Liebe Leser:innen,
eine Kommission hat in dieser Woche Arbeitsministerin Bärbel Bas Empfehlungen übergeben, wie der Sozialstaat „modernisiert“ werden könnte.
Digitalisierung spielt darin eine zentrale Rolle: Behörden sollen untereinander mehr Daten austauschen, dafür soll der komplexe Datenschutz weg und eine Personenkennziffer her. Verfassungsrechtlich ist das höchst fragwürdig.
Außerdem schlägt die Kommission vor, Verwaltungsvorgänge mit sogenannter Künstlicher Intelligenz zu automatisieren. Auch bei Ermessensspielräumen – also wenn es etwa darum geht, wie viel Unterstützung eine Person vom Amt bekommt. Und weil bei „KI“ bekanntlich immer Wahres, Schönes, Gutes rauskommt, sollen die Ergebnisse weniger gegengeprüft werden. Die Wohlfahrtsverbände halten davon herzlich wenig, sondern befürchten zusätzliche Diskriminierung.
Auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger sieht es buchstäblich als seine Mission an, tausende „outdated“ Fachverfahren in der Verwaltung zu automatisieren. Helfen soll dabei Agentische Künstliche Intelligenz, die so eine Art KI-Heinzelmännchen für Behördenprozesse antreiben soll.
Dafür brachte das Digitalministerium in dieser Woche den Agentic AI Hub an den Start. Man habe „eine große Tasche“, versicherte Wildberger den anwesenden „Start-up- und Scale-up-Vertreter:innen“ bei der Auftaktveranstaltung. Und man wolle Pilotprojekte möglichst schnell skalieren, sekundierte sein Staatssekretär Thomas Jarzombek.
Bei allem Automatisierungsrausch fehlte auch hier der Raum, um über Risiken, Kontrolle und – ja – Ethik zu sprechen. Dabei haben andere Länder KI-Systemen bereits das Steuer in der Verwaltung überlassen und sind damit alles andere als gut gefahren. Vielleicht skalieren wir das mal.
Habt ein schönes Wochenende!
Daniel
Breakpoint: Grundrechte sind nicht FSK 16
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Information und Teilhabe – auch auf sozialen Medien. Wenn Erwachsene sie per Social-Media-Verbot von solchen Orten der Meinungsbildung ausschließen, werden sie ihrer Verpflichtung nicht gerecht. Von Carla Siepmann –
Artikel lesen
Deepfake-Skandal: EU-Kommission leitet Untersuchung gegen Grok und X ein
Nach einer Flut sexualisierter Grok-Deepfakes auf X prüft nun die EU-Kommission, ob Elon Musks Unternehmen gegen den Digital Services Act verstoßen haben. Erste Studien liefern derweil Details über das Ausmaß der produzierten sexualisierten Bilder. Von Laura Jaruszewski –
Artikel lesen
ADINT: Überwachungsfirmen können Menschen mit „anonymen“ Werbe-IDs ausspionieren
Meist im Verborgenen bereiten Unternehmen Daten aus der Online-Werbung für Geheimdienste auf. Manche prahlen damit, praktisch jedes Handy verfolgen zu können. Eine Recherche von Le Monde gewährt seltene Einblicke in eine Branche, die auch europäische Sicherheitsbehörden umwirbt. Von Ingo Dachwitz –
Artikel lesen
Anhörung zum Gesetzentwurf: Bundespolizei soll Staatstrojaner nutzen dürfen
Der neue Anlauf zur Reform des Bundespolizeigesetzes traf im Innenausschuss des Bundestags auf Kritik. Die Bundespolizei soll künftig Staatstrojaner nutzen dürfen, ohne dass für diese Hacking-Werkzeuge ein IT-Schwachstellenmanagement existiert. Von Constanze –
Artikel lesen
Hinweise gesucht: „Wir wollen die Verbreitung sexualisierter Deepfakes einschränken“
Per Mausklick lassen sich Fotos bekleideter Personen in Nacktbilder verwandeln. Die Organisation AlgorithmWatch bittet nun um Hinweise auf solche Apps und Websites, um systematisch dagegen vorzugehen. Wie das klappen soll, erklärt Forschungsleiter Oliver Marsh im Interview. Von Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Österreichische Datenschutzbehörde: Microsoft hat illegal Minderjährige getrackt
Microsoft hat auf dem Rechner einer österreichischen Schülerin ohne deren Zustimmung Tracking-Cookies installiert und so persönliche Daten abgegriffen. Die österreichische Datenschutzbehörde hat nun festgestellt, dass der Datenabfluss illlegal war. Auch andere Microsoft-Nutzende können von illegalen Microsoft-Cookies betroffen sein. Von Martin Schwarzbeck, Ben Kumi –
Artikel lesen
Phishing-Angriff: Zahlreiche Journalist:innen im Visier bei Attacke über Signal-Messenger
Mit einem Phishing-Angriff versucht ein bislang unbekannter Akteur, offenbar gezielt Zugriff auf die Signal-Konten von Journalist:innen und Aktivist:innen zu bekommen. Wir erklären, wie der Angriff funktioniert und wie man sich vor ihm schützen kann. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Kehrtwende in UK: Pornhub widersetzt sich britischen Alterskontrollen
Ein halbes Jahr lang hat sich Pornhub den britischen Alterskontrollen gebeugt und massenhaft Nutzer*innen überprüft. Jetzt macht der Konzern eine Kehrtwende und kündigt seinen Rückzug aus dem Vereinigten Königreich an. Dahinter steckt ein geschickter PR-Stunt. Die Analyse. Von Sebastian Meineck –
Artikel lesen
Phishing attack: Numerous journalists targeted in attack via Signal Messenger
In a phishing attack, unknown actors are apparently attempting to gain access to accounts of journalists and activists on the Signal messaging service. We explain how the attack works and how you can protect yourself against it. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Diskussionspapier: Tech-Unternehmen sollen legalen Extremismus suchen
Internet-Dienste sollen nicht nur sexuellen Kindesmissbrauch suchen, sondern auch andere Inhalte wie Extremismus. Das fordern Deutschland, Frankreich und die Niederlande in einem Diskussionspapier. Tech-Unternehmen lehnen es ab, ihr System zum Datenaustausch auf solche Inhalte auszuweiten. Von Andre Meister –
Artikel lesen
ChatGPT: Polizeigewerkschaft bebildert Pressemitteilung mit generiertem Schockerfoto
Der sächsische Landesverband der Gewerkschaft der Polizei nutzt ein KI-generiertes Bild mit einem blutenden Polizisten, um eine Pressemitteilung zu illustrieren. Begründet wird dies mit Persönlichkeitsrechten und laufenden Ermittlungen, das Bild sei eine „symbolische Illustration“. Von Markus Reuter –
Artikel lesen
Sozialstaatsreform: Kommission empfiehlt Abbau von Grundrechten
Eine Fachkommission der Bundesregierung hat Empfehlungen vorgelegt, die den Sozialstaat bürgernäher und digitaler machen sollen. Dafür will sie den Datenschutz aufweichen und Verfahren mit Hilfe sogenannter Künstlicher Intelligenz automatisieren. Wohlfahrtsverbände warnen vor zusätzlicher Diskriminierung. Von Daniel Leisegang –
Artikel lesen
Berlin: Undurchsichtige Gesundheitsdatenbank-Pläne nach Brandbrief vorerst gestoppt
CDU und SPD wollen in Berlin eine zentrale Gesundheitsdatenbank an der Charité aufbauen. Doch die Berliner Datenschutzbeauftragte kritisierte das Vorhaben der Koalition scharf und fordert Nachbesserungen. Wir veröffentlichen ihren Brandbrief. Von Laura Jaruszewski –
Artikel lesen
Digitaler Omnibus: „Die EU-Kommission rüttelt an den Grundpfeilern des Datenschutzes“
Die EU-Kommission will pseudonymisierte Daten teilweise von der Datenschutzgrundverordnung ausnehmen. Jetzt äußert sich erstmals eine deutsche Datenschutzbeauftragte. Meike Kamp übt deutliche Kritik an den Plänen und glaubt, die Kommission habe ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes missverstanden. Von Ingo Dachwitz –
Artikel lesen
EUDI-Wallet: Digitale Brieftasche geht in Testphase
Anfang 2027 soll in Deutschland eine staatliche EUDI-Wallet bereitstehen. In einer Testumgebung können Behörden und Unternehmen deren Funktionen nun testen. Parallel dazu läuft ein Pilotprojekt in Sachsen. Von Daniel Leisegang –
Artikel lesen
Trilog zu Alterskontrollen: Warnung vor „Ausweispflicht für weite Teile des Internets“
Sowohl der Rat als auch das EU-Parlament haben Nein gesagt zur verpflichtenden Chatkontrolle. Aber die umstrittene Verordnung birgt weitere Risiken für digitale Grundrechte – und zwar flächendeckende Alterskontrollen. Worüber Kommission, Parlament und Rat jetzt verhandeln. Von Sebastian Meineck, Chris Köver –
Artikel lesen
Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.
Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.
Datenschutz & Sicherheit
Sicherheitslücke: Tausch weiterer elektronischer Heilberufsausweise in Arbeit
Infolge der Umstellung der Verschlüsselung von RSA auf Elliptic Curve Cryptography (ECC) müssen zahlreiche Komponenten wie elektronische Heilberufsausweise ausgetauscht werden. Nach einer Fristverlängerung muss dies bis spätestens Ende Juni 2026 passieren. Einigen Ärzten, die bereits über ECC-Karten verfügen, droht jedoch ein weiterer Tausch: „Karten mit dem betroffenen Infineon-Chip, die das ECC-Verfahren nutzen, dürfen nur noch bis spätestens 30. Juni 2026 für qualifizierte elektronische Signaturen eingesetzt werden“, heißt es in der Information von D-Trust. Wie viele das betrifft, sagen die Verantwortlichen nicht.
Weiterlesen nach der Anzeige
Die Gematik schreibt dazu: „Die Schwachstelle betrifft ausschließlich den Verschlüsselungsalgorithmus ECC eines Kartenproduktes eines bestimmten Herstellers und ist mittlerweile behoben. Alle betroffenen Karten sind also bereits ECC-fähig. Im Rahmen der Umstellung von RSA zu ECC wurden den Kund:innen Karten ausgeliefert, die nicht von der Schwachstelle betroffen sind“.
Die Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung zwischen BSI, Bundesnetzagentur und Gematik. Aus regulatorischen und technischen Gründen werden alle betroffenen eHBAs sukzessive bis zu dem genannten Datum gesperrt.
Betroffen sind eHBA der Generation 2.1 der Anbieter SHC+Care und D-Trust, die auf Karten des Herstellers Idemia mit Infineon-Chips basieren. Für diese Chips war im September 2024 eine Schwachstelle in der ECDSA-Implementierung der Infineon-Kryptobibliotheken bekannt geworden (EUCLEAK). Die Gematik entzog den betroffenen Karten daraufhin im Januar 2025 durch einen Verwaltungsakt die Zulassung.
Während D-Trust nach dem Entzug der Zulassung kurzfristig auf Karten des Herstellers Giesecke+Devrient umstellen konnte, ging SHC+Care juristisch gegen die Entscheidung der Gematik vor. Das Unternehmen klagte gegen den Zulassungsentzug der betroffenen Idemia-Karten und bekam vor dem Sozialgericht Schleswig Recht. Später bestätigte das Landessozialgericht Schleswig-Holstein das Urteil (Aktenzeichen: L 5 KR 38/25 B ER). Das Sozialgericht habe zudem festgestellt, dass die Telematikinfrastruktur selbst nicht betroffen sei und keine akute Gefahr bestehe.
Auch mit den betroffenen Karten ließen sich weiterhin gültige qualifizierte elektronische Signaturen erzeugen. Für die erfolgreiche Seitenkanalattacke EUCLEAK wären sowohl physischer Zugriff auf den Ausweis als auch die Kenntnis der individuellen PIN sowie Spezialausrüstung und Expertenwissen erforderlich.
Weiterlesen nach der Anzeige
So erkennen Betroffene ihre Karte
Nach Angaben von D-Trust lassen sich betroffene Karten einfach identifizieren: Auf der Rückseite ist der Schriftzug „Idemia“ aufgedruckt. Karten mit dem Schriftzug „G&D“ stammen vom Hersteller Giesecke+Devrient und sind nicht betroffen. Diese liefert D-Trust bereits seit Februar 2025 aus. Kunden mit betroffenen Karten werden laut D-Trust direkt per E-Mail informiert und müssen nicht selbst aktiv werden. Erste Ärzte sind nach Kenntnissen von heise online bereits von D-Trust informiert worden.
„Der Austausch der betroffenen eHBAs hat im Januar 2026 gestartet. Dafür werden alle Kundinnen und Kunden persönlich kontaktiert und über die Austauschmöglichkeiten informiert“, heißt es von D-Trust auf Anfrage. Betroffene könnten „ihren bisherigen eHBA kostenfrei gegen eine Ersatzkarte mit identischer Laufzeit eintauschen. Alternativ kann auch eine Folgekarte mit einer neuen Laufzeit von fünf Jahren bestellt werden. Für die meisten Berufsgruppen gilt für Folgekarten auch ein Preisnachlass von 20 Prozent. Ebenfalls von der Schwachstelle betroffene Signatur- und Siegelkarten der D-Trust wurden bereits bis Ende 2025 ausgetauscht“, so D-Trust und verwies auf seine FAQ.
Laut SHC betreffe der Austausch „nur einen begrenzten Teil der von uns ausgegebenen eHBA“. Der Austausch sei bereits 2025 gestartet. „Ein signifikanter Teil der betroffenen Karten wurde bereits ausgetauscht, die verbleibenden erfolgen sukzessive“. Das Unternehmen will sicherstellen, alle Karten vor Fristende auszutauschen. „Der Austausch erfolgt so, dass den betroffenen Kundinnen und Kunden keinerlei Nachteile finanzieller Art oder im Praxisbetrieb entstehen“, sagte SHC gegenüber heise online.
(mack)
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac
-

 Künstliche Intelligenzvor 1 Monat
Künstliche Intelligenzvor 1 MonatSchnelles Boot statt Bus und Bahn: Was sich von London und New York lernen lässt
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenHuawei Mate 80 Pro Max: Tandem-OLED mit 8.000 cd/m² für das Flaggschiff-Smartphone
-

 Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten
Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFast 5 GB pro mm²: Sandisk und Kioxia kommen mit höchster Bitdichte zum ISSCC
-

 Entwicklung & Codevor 2 Monaten
Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommentar: Anthropic verschenkt MCP – mit fragwürdigen Hintertüren
-

 Social Mediavor 1 Monat
Social Mediavor 1 MonatDie meistgehörten Gastfolgen 2025 im Feed & Fudder Podcast – Social Media, Recruiting und Karriere-Insights
-

 Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten
Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenSyncthing‑Fork unter fremder Kontrolle? Community schluckt das nicht
-

 Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten
Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenWeiter billig Tanken und Heizen: Koalition will CO₂-Preis für 2027 nicht erhöhen
















